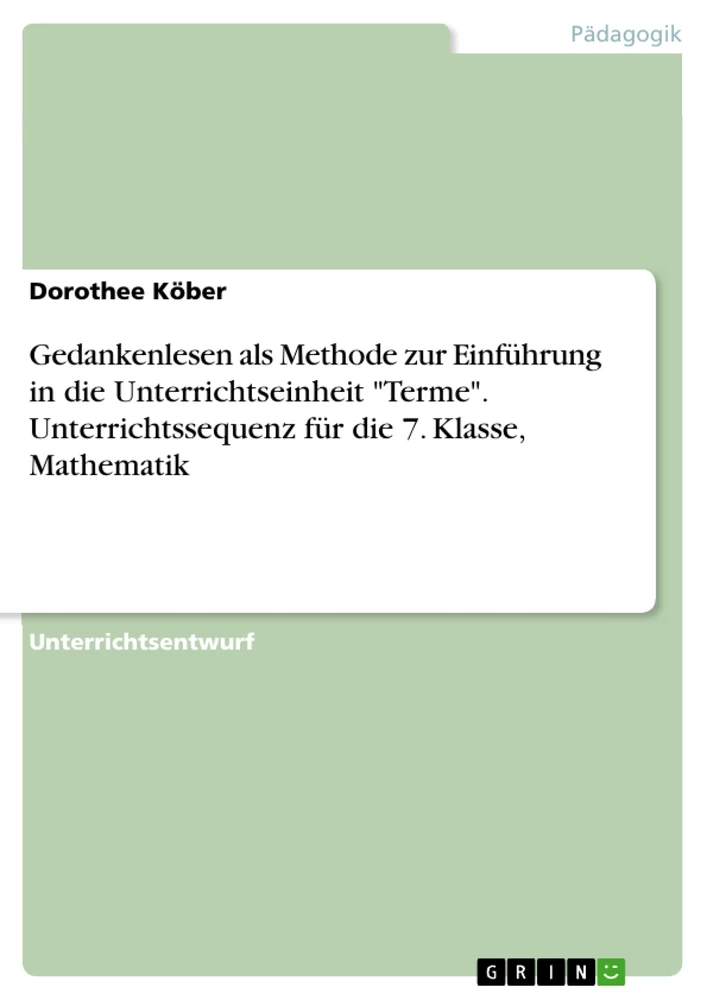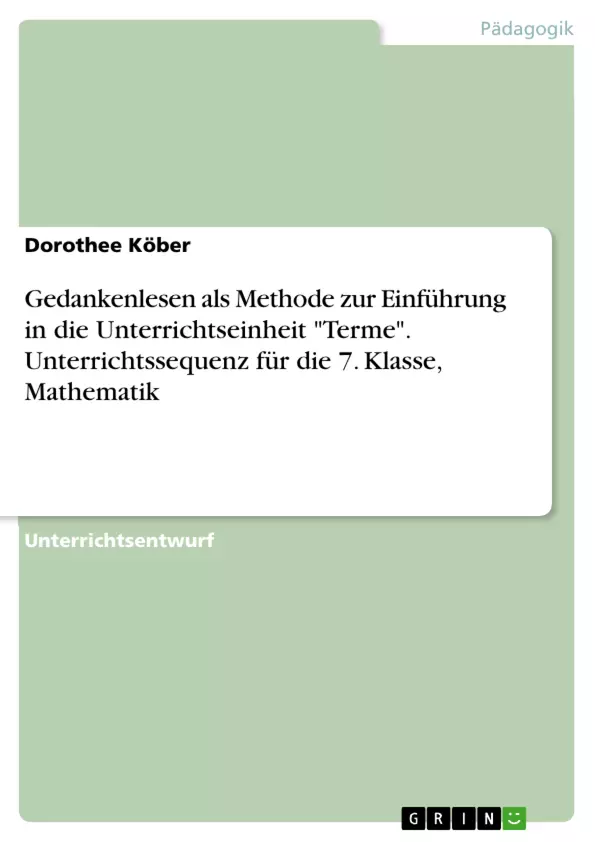Die dargestellte Stunde ist die Einführungsstunde in die Unterrichtseinheit "Terme". Im Hinblick auf die Unterrichtsstunde sind den Schülern einfache Terme hauptsächlich aus der Flächen- und Umfangsberechnung von Figuren bekannt. Für die Einführungsstunde hat sich die Autorin für das Gedankenlesen entschieden. Das Ziel der Stunde liegt darin, einen Überblick über das Vorwissen der Schüler zum Thema "Terme" zu bekommen. Es wird eine Standortbestimmung durchgeführt. Das Problem der Stunde ist eine sogenannte "Überforderungsaufgabe". Das heißt, den Schülern steht zum Lösen des Problems die eigentlich notwendige Kompetenz, einen Term aufstellen zu können, noch nicht zur Verfügung. Sie sollen jedoch durch Problemlösen, Knobeln und den Austausch untereinander Lösungswege aufstellen und diskutieren. Es wird sich hierbei zeigen, was die Schüler bisher für Wissen mitbringen. Daher liegt der Schwerpunkt der Zielsetzung der Stunde auf den prozessbezogenen Kompetenzen. Für die Kompetenzen, die im Bildungsplan zu Termen genannt werden, wird durch Begriffsklärungen in der Sicherungsphase ein Fundament gelegt.
Terme dienen dazu, eine allgemeingültige Beschreibung von inner- und außermathematischen Prozessen abzugeben. Sie bieten außerdem die Möglichkeit, eine Situation zu explorieren und allgemeine Einsichten zu bekommen. Die abstrakte Problemlösung ist hierdurch planbar und Probleme können allgemein gelöst werden. Es wird außerdem möglich, allgemeingültige Argumentationen wie Beweise durchzuführen. Das Wissen kann auf abstrakter Ebene kommuniziert werden. Es zeigt sich: Terme sind ein wichtiges Instrument der Mathematik. Dies gilt es den Schüler in der Unterrichtseinheit zu vermitteln und ihnen so den Umgang mit Termen und deren Nützlichkeit näher zu bringen. Des Weiteren sind die Terme als eine wichtige Vorstufe für das Arbeiten mit Gleichungen anzusehen.
Inhaltsverzeichnis
- Reflexionen zur Lerngruppe
- Allgemeines
- Zusammensetzung der Klasse
- Der Leistungsstand der Klasse im Hinblick auf den Inhalt
- Nennung der zu fördernden und zu erreichenden Kompetenzen
- Einordnung des Themas im Bildungsplan
- Ziele, die zur Erreichung dieser Kompetenzen dienen
- Überlegungen zum Inhalt und zur Sache
- Didaktische Analyse
- Didaktische Begründung der Themenauswahl
- Einbettung der Stunde in den übergeordneten unterrichtlichen Kontext
- Didaktische Hinweise und Prinzipien
- Methodische Überlegungen
- Begrüßung
- Einstieg
- Hinführung
- Erarbeitungsphase
- Sicherungsphase
- Erweiterung
- Unterrichtsverlauf
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Unterrichtsentwurf legt den Fokus auf die Einführung des Themas „Terme“ in einer Hauptschulklasse. Ziel ist es, den Schülern den Begriff „Term“ und seine Bedeutung näherzubringen, ihnen die Anwendung von Variablen zu erläutern und ihnen anhand eines Problems das Arbeiten mit Termen zu ermöglichen. Die Stunde soll das Problemlösen, Argumentieren und Kommunizieren in und über Mathematik fördern.
- Einführung des Begriffs „Term“ und seiner Bedeutung
- Erläuterung des Begriffs „Variable“
- Anwenden von Termen zur Lösung eines Problems
- Förderung von Problemlösen, Argumentieren und Kommunizieren im Mathematikunterricht
- Einordnung des Themas „Terme“ im Bildungsplan
Zusammenfassung der Kapitel
- Reflexionen zur Lerngruppe: Die Klasse 7 besteht aus 13 Schülern, die ein unterschiedliches Arbeits- und Sozialverhalten zeigen. Es wird ein Überblick über die Zusammensetzung der Klasse, ihre Stärken und Schwächen sowie über ihren Leistungsstand im Bereich der Mathematik gegeben. Besonders hervorgehoben werden Schüler mit herausragenden Leistungen sowie Schüler, die zusätzliche Unterstützung benötigen.
- Nennung der zu fördernden und zu erreichenden Kompetenzen: Es werden die im Bildungsplan für Mathematik festgelegten Kompetenzen im Bereich der Terme genannt, die in dieser Unterrichtseinheit erreicht werden sollen. Zudem werden die prozessbezogenen Kompetenzen wie Problemlösen, Argumentieren und Kommunizieren beleuchtet, die in dieser Unterrichtseinheit gefördert werden sollen.
- Überlegungen zum Inhalt und zur Sache: Hier werden zentrale Definitionen zum Thema „Term“ und „Variable“ erläutert. Die Verwendung von Variablen in Termen sowie die Möglichkeit, Terme zu vereinfachen, wird ebenfalls erklärt.
- Didaktische Analyse: Dieser Abschnitt beleuchtet die Bedeutung von Termen in der Mathematik sowie im Alltag. Es wird argumentiert, warum das Thema „Terme“ relevant für Schüler ist und welche Vorteile der Umgang mit Termen bietet. Des Weiteren wird der Bezug zum Bildungsplan hergestellt und die Einbettung der Unterrichtseinheit in den übergeordneten unterrichtlichen Kontext erläutert.
- Methodische Überlegungen: Der letzte Abschnitt des Entwurfs gibt einen Überblick über die verschiedenen methodischen Ansätze, die für diese Unterrichtseinheit eingesetzt werden sollen. Die Planung des Unterrichtsverlaufs wird beschrieben, wobei die Phasen Begrüßung, Einstieg, Hinführung, Erarbeitungsphase, Sicherungsphase und Erweiterung beleuchtet werden.
Schlüsselwörter
Der Unterrichtsentwurf fokussiert auf die zentralen Themen Terme, Variablen, Problemlösen, Argumentieren und Kommunizieren im Kontext der Mathematik. Er befasst sich mit der didaktischen und methodischen Herangehensweise an die Einführung des Themas „Terme“ in der Hauptschule. Der Bildungsplan für Mathematik bildet dabei den Rahmen für die Auswahl der zu fördernden Kompetenzen und den Unterrichtsverlauf.
- Citar trabajo
- Dorothee Köber (Autor), 2015, Gedankenlesen als Methode zur Einführung in die Unterrichtseinheit "Terme". Unterrichtssequenz für die 7. Klasse, Mathematik, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/508604