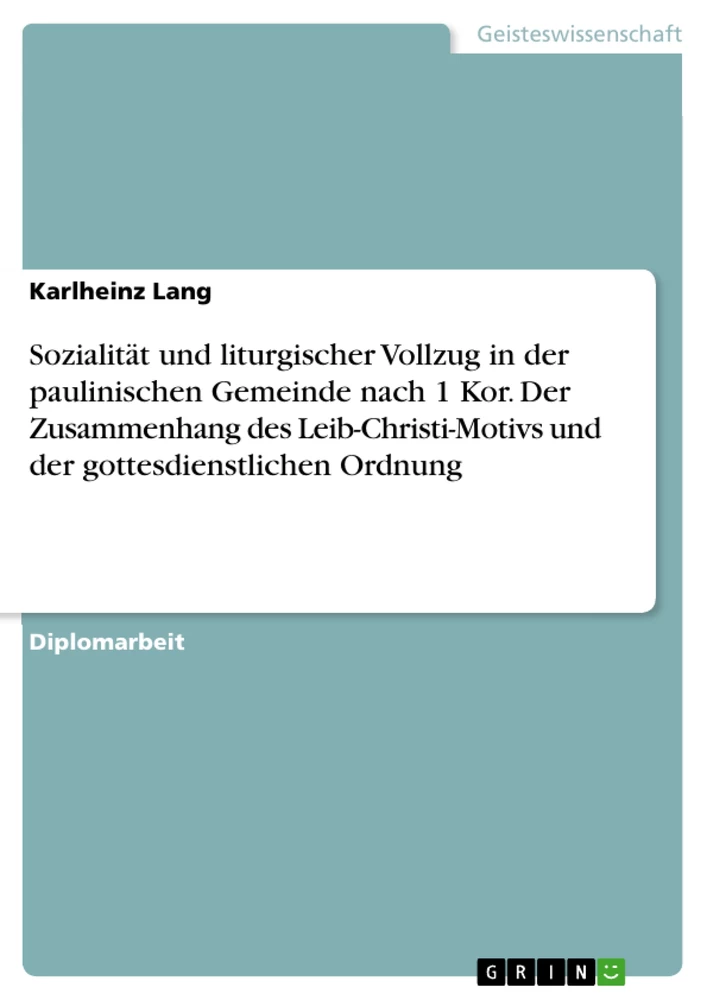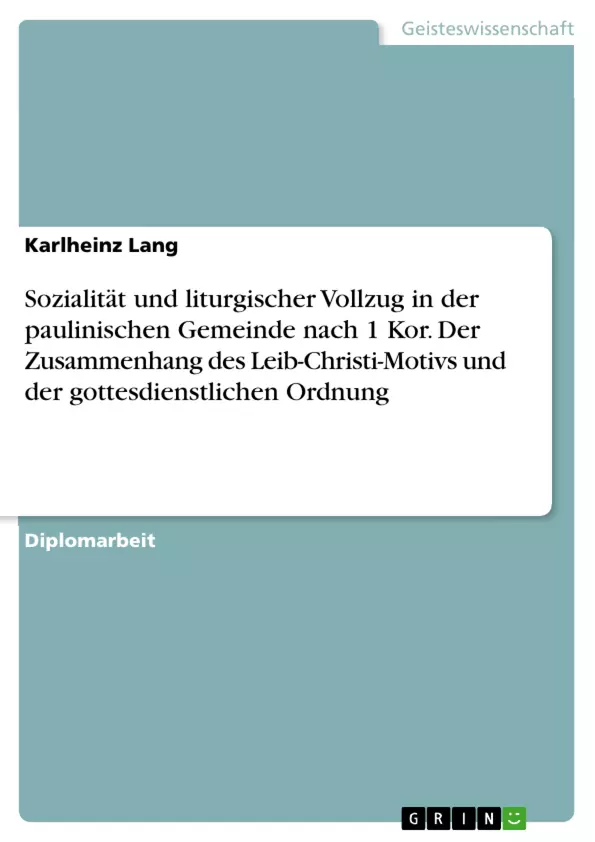In den Kapiteln 11-14 des 1. Korintherbriefs findet sich die ausführlichste Beschreibung eines frühchristlichen Gottesdienstes im Neuen Testament. Deshalb wollen wir dieses Dokument näher betrachten, und zwar unter folgenden Hinsichten: Wie haben wir uns die Gemeindeversammlung kurze Zeit nach Gemeindegründung durch Paulus in Korinth vorzustellen? (siehe 3.) Welche besondere Bedeutung kommt dem von ihm im Kap. 12 seines Briefes breit ausgeführten Motiv vom Leibe Christi zu? (siehe 4.) Welche Anweisungen gibt der Apostel der jungen Gemeinde in diesem Zusammenhang für die Ordnung ihrer Gemeindeversammlung? (siehe 5.) Zuvor ist aber zu klären, was wir über die Stadt und die Gemeinde von Korinth zur Zeit des Paulus wissen und darüber, welche Vorstellung Paulus überhaupt mit einem Begriff wieevkklhsi,averbindet. (siehe 2.) Wir wollen versuchen, diese Fragen schrittweise zu beantworten.
Da es zu den Themenkreisen aber mittlerweile eine überaus große Menge an Sekundärliteratur gibt, die den Umfang einer Diplomarbeit sprengen würde, werden wir uns auf wesentliche, einschlägige Werke beschränken, um die Zusammenhänge herauszuarbeiten. Voraussetzung ist dabei eine ebenfalls strenge Beschränkung bei den Quellen: in unserer Arbeit insbesondere auf den 1. Korintherbrief (1 Kor). Dabei gehen wir davon aus, dass 1 Kor im Wesentlichen eine literarische Einheit darstellt1und ca. ein Jahr nach Gemeindegründung um 54/55 n. Chr. in Ephesus abgefasst wurde.2Weitere Briefe von Paulus, die je in ihrer eigenen Situation gesehen werden müssen, werden wir nur dann heranziehen, wenn es von der Sache her besonders geboten scheint. Auf Bezugnahmen zu Epheser- und Kolosserbrief verzichten wir fast durchweg, da die aktuelle Forschung zumeist gegen eine paulinische Verfasserschaft argumentiert.
Die griechischen Schriftzitate der Arbeit folgen der Edition von Nestle/Aland; die deutschen, sofern nicht anders vermerkt, dem Münchener Neuen Testament, allerdings auf neue Rechtschreibung abgewandelt.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Überblick über die korinthische Gemeinde
- Die Stadt Korinth
- Die christliche Gemeinde in Korinth
- Frühchristlicher Gottesdienst in Korinth
- Grundsätzliche Erwägungen
- Versammlungsort und -zeit
- Versammlungsablauf
- Deipnon
- Symposion
- Das Leib-Christi-Motiv
- Das Leib-Motiv in der vorpaulinischen Antike
- In der Rede des Menenius Agrippa
- Bei Seneca und Cicero
- Bei Platon und Aristoteles
- Im Judentum
- Religionsgeschichtliche Herkunftsmöglichkeiten des Motivs
- Der gnostische Anthroposmythos
- Die Allgott-Vorstellung
- „Corporate personality“ und rabbinische Adam-Spekulation
- Innerchristliche Herleitungsversuche
- Das Leib(-Christi)-Motiv bei Paulus
- Textbefund in 1 Kor
- Das Leib-Christi-Motiv in 1 Kor 12
- Die gottesdienstliche Ordnung
- Pauli Anweisungen für das Deipnon
- Pauli Anweisungen für das Symposion
- Die Charismen im Einzelnen
- Apostel (avpo,stoloi)
- Propheten (profh/tai)
- Lehrer (dida,skaloi)
- Wunderkräfte (evnergh,mata duna,mewn)
- Heilungen (cari,smata ivama,twn)
- Hilfeleistungen (avntilh,myeij)
- Leitungen (kubernh,seij)
- Zungenrede (glw,ssaij lalei/n) und deren Auslegung (e`rmhnei,a glwssw/n)
- Unterscheidungen der Geister (diakri,seij pneuma,twn)
- Das,,Hohelied der Liebe\" 1 Kor 13
- Theologisches Resümee
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert den frühchristlichen Gottesdienst in Korinth anhand des 1. Korintherbriefs. Sie zielt darauf ab, die Gemeindeversammlungen im frühen Christentum zu rekonstruieren, wobei das Leib-Christi-Motiv als zentrales Element der Ordnung des Gottesdienstes untersucht wird. Dabei werden die Anweisungen des Apostels Paulus für den Ablauf der Versammlungen im Licht der damaligen gesellschaftlichen und religiösen Kontexte beleuchtet.
- Die soziale und liturgische Praxis der paulinischen Gemeinde in Korinth
- Die Rolle des Leib-Christi-Motivs im frühen Christentum
- Die Bedeutung der Charismen und ihrer Integration in den Gottesdienst
- Die Rekonstruktion des frühchristlichen Gottesdienstes aus dem 1. Korintherbrief
- Der Zusammenhang zwischen sozialer Praxis und liturgischer Ordnung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in den Kontext des 1. Korintherbriefs und den Forschungsstand zum Thema. Kapitel 2 gibt einen Überblick über die Stadt Korinth und die christliche Gemeinde in Korinth zur Zeit des Paulus. Kapitel 3 befasst sich mit dem frühchristlichen Gottesdienst in Korinth, beleuchtet Aspekte wie den Versammlungsort, die -zeit und den -ablauf. Kapitel 4 untersucht das Leib-Christi-Motiv, analysiert seine Bedeutung in der vorpaulinischen Antike und im Judentum und setzt es in Beziehung zum Paulusbrief. Kapitel 5 analysiert die gottesdienstliche Ordnung, die Paulus in seinen Anweisungen für das Deipnon, das Symposion und die einzelnen Charismen vorschreibt.
Schlüsselwörter
Frühchristlicher Gottesdienst, Korinth, 1. Korintherbrief, Leib-Christi-Motiv, Gemeindeversammlung, Charismen, Deipnon, Symposion, soziale Praxis, liturgische Ordnung, Paulus, Textbefund, Religionsgeschichte, vorpaulinische Antike, Judentum.
Häufig gestellte Fragen
Wie sah ein frühchristlicher Gottesdienst in Korinth aus?
Er bestand aus zwei Teilen: dem gemeinschaftlichen Sättigungsmahl (Deipnon) und einem anschließenden rituellen Teil mit Gebet, Lehre und Charismen (Symposion).
Was bedeutet das "Leib-Christi-Motiv" bei Paulus?
Es beschreibt die Gemeinde als einen Organismus, in dem jedes Mitglied eine wichtige, gottgegebene Funktion hat, ähnlich den Gliedern eines Körpers.
Welche Probleme gab es in der korinthischen Gemeinde?
Paulus kritisiert soziale Spaltungen beim Abendmahl, bei denen Reiche aßen, während Arme hungerten, sowie Unordnung durch unkontrollierte Zungenrede.
Was sind "Charismen" im biblischen Kontext?
Gnadengaben des Heiligen Geistes wie Prophetie, Lehre, Heilung oder Zungenrede, die zum Nutzen der gesamten Gemeinde eingesetzt werden sollen.
Warum schrieb Paulus den 1. Korintherbrief?
Um auf Anfragen der Gemeinde zu antworten und Missstände in der gottesdienstlichen Ordnung sowie theologische Streitigkeiten zu klären.
- Citation du texte
- Karlheinz Lang (Auteur), 2005, Sozialität und liturgischer Vollzug in der paulinischen Gemeinde nach 1 Kor. Der Zusammenhang des Leib-Christi-Motivs und der gottesdienstlichen Ordnung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/50863