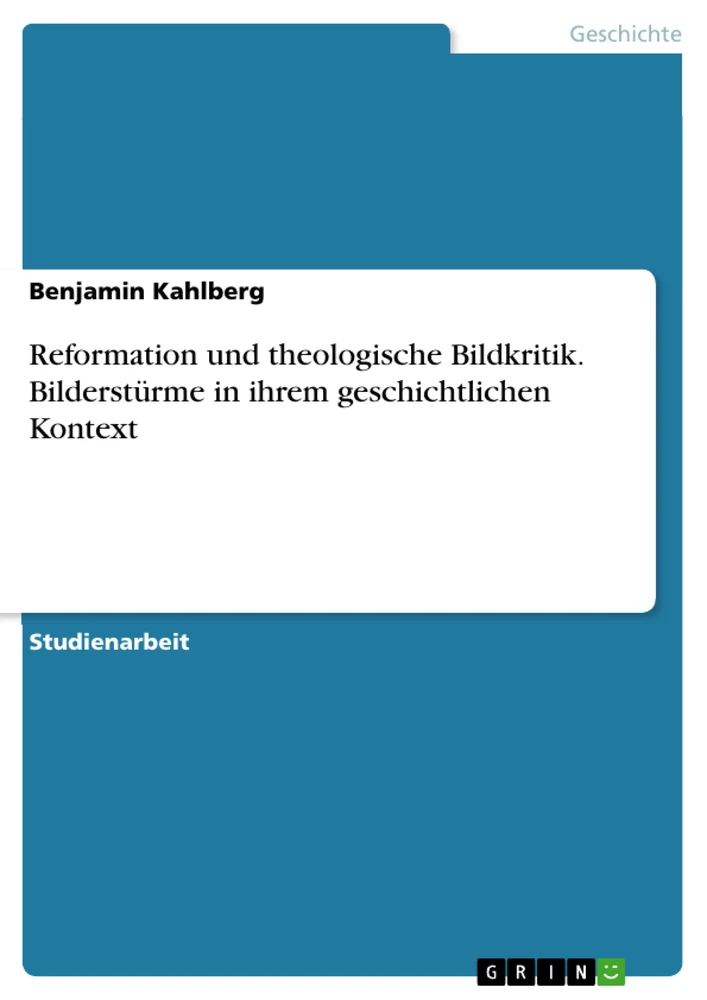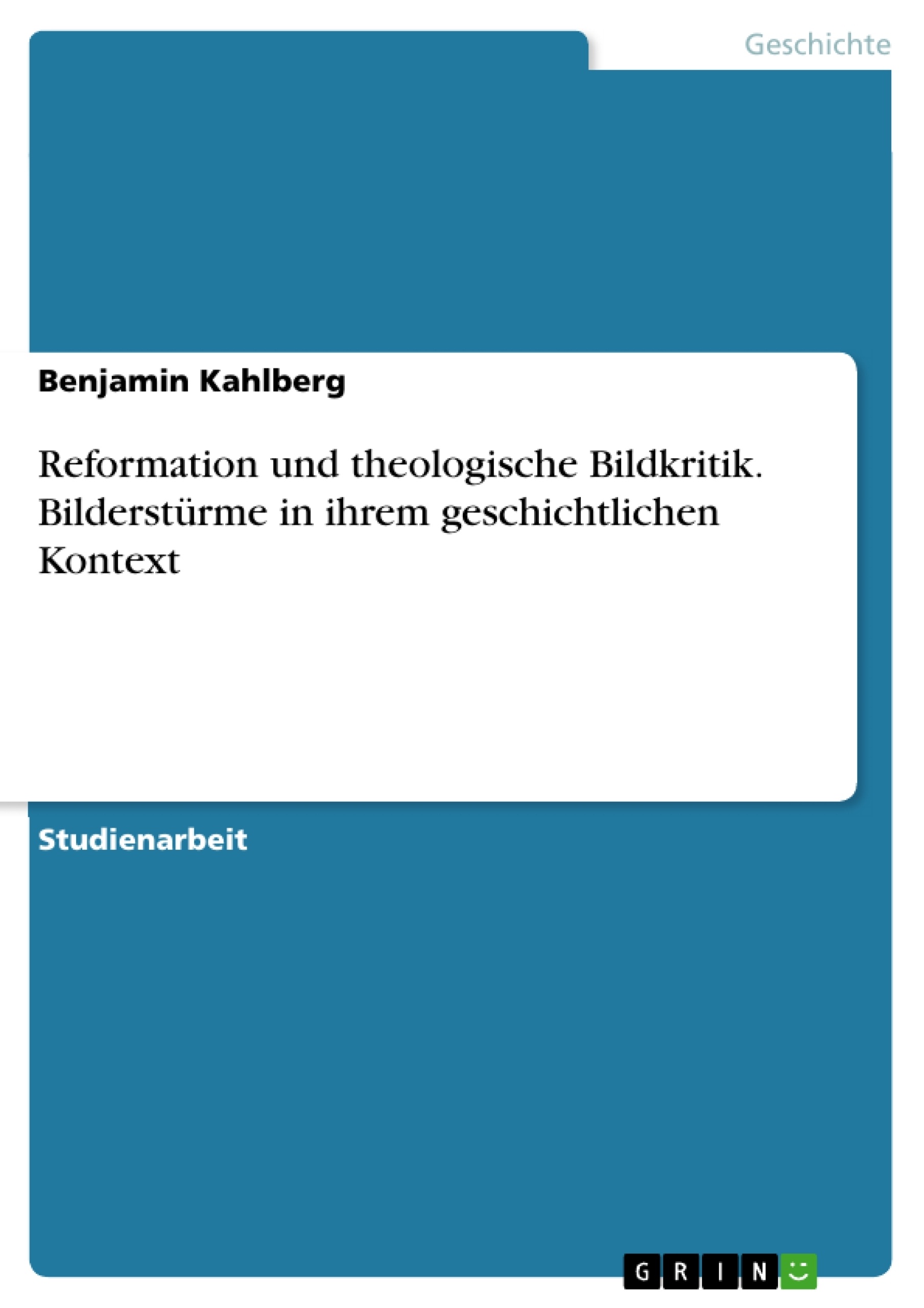Diese Arbeit behandelt die Bilderstürme zur Zeit der Reformation. Schwerpunkt sind dabei die Bedeutung Karlstadts und Luthers für den Beginn und Verlauf der Bilderstürme. Zum Thema des reformatorischen Bildersturms sind im Laufe der letzten Jahre viele Arbeiten veröffentlicht worden. Der Bildersturm der Reformationszeit wurde lange von der historischen Forschung lediglich als eine Randerscheinung oder eine natürliche Folge der religiösen Umbrüche der Zeit gesehen. Die Verantwortlichkeit für die Ereignisse wurde im Allgemeinen den Ungebildeten und den wild agierenden unteren Volksschichten zugeschrieben. In der neueren Geschichtsschreibung hat man jedoch festgestellt, dass es bei den Bilderstürmen Beteiligte aus allen Volksschichten gab, besonders aus dem Bürgertum. Auch Jugendliche und Frauen konnten an den Aktionen beteiligt sein. Die Untersuchungen von Sergiusz Michalski zeigen beispielhaft, dass die Motive, der Ablauf, das Ausmaß und die für die Handlungen Verantwortlichen, regional sehr unterschiedlich sein konnten.
Das Phänomen des reformatorischen Bildersturms nimmt seinen eigentlichen Anfang in den sogenannten Wittenberger Unruhen, Ende 1521 - Anfang 1522, wo es unter dem Einfluss von Andreas Bodenstein von Karlstadt zu einigen Bilderstürmen kam. Im Folgenden sollen die wichtigsten theologischen Einflüsse und Positionen, die zum reformatorischen Bildersturm in Wittenberg geführt haben, dargestellt werden. Im Zusammenhang damit wird auf die Frage eingegangen, wie die theologischen Auseinandersetzungen sich auf den unmittelbaren Verlauf der Ereignisse in der Stadt und darüber hinaus auf die Reformation in Deutschland, ausgewirkt haben, welche Position sich letztendlich durchsetzen konnte und auch weshalb.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung: Fragestellung & Forschungsstand
- 2. Die Wittenberger Unruhen: Ursachen - Verlauf - Folgen
- 2.1. Die Bilderstürme in ihrem geschichtlichen Kontext
- 2.2. Karlstadts Bilderlehre
- 2.3. Luthers Einschreiten und die theologische Auseinandersetzung
- 3. Die Folgen des Einschreitens Luthers
- 3.1. Unmittelbar auf Wittenberg und Karlstadt
- 3.2. Langfristige Folgen für den Reformationsverlauf
- 3.3. Regionale Differenzierung der Folgen der Wittenberger Unruhen und des Einschreitens Luthers
- 4. Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den reformatorischen Bildersturm, insbesondere die Ereignisse in Wittenberg 1521/22. Sie beleuchtet die Ursachen, den Verlauf und die Folgen dieser Unruhen, unter Berücksichtigung der unterschiedlichen theologischen Positionen und deren Auswirkungen auf die Reformation. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Rolle Andreas Bodensteins von Karlstadt und seinem Einfluss auf die ikonoklastischen Handlungen.
- Theologische Grundlagen des Bildersturms
- Die Rolle von Andreas Bodenstein von Karlstadt
- Auswirkungen der Wittenberger Unruhen auf den Reformationsverlauf
- Regionale Unterschiede im Umgang mit Bildern während der Reformation
- Definition und Differenzierung von "Bildersturm", "Bildentfernung" und "Bilderfrevel"
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Fragestellung & Forschungsstand: Die Einleitung betont die bisherige Forschungslücke bezüglich des reformatorischen Bildersturms, der oft als Randerscheinung betrachtet wurde. Sie hebt die Bedeutung neuerer Forschung hervor, die die Beteiligung verschiedener Bevölkerungsschichten und die regionale Varianz der Ereignisse betont. Der Text führt den wichtigen Begriff der Differenzierung zwischen "Bildersturm", "Bildentfernung" und "Bilderfrevel" ein, um die Komplexität der Ereignisse zu verdeutlichen und die vielfältigen Motive hinter den ikonoklastischen Handlungen zu beleuchten. Die Bedeutung lokaler Faktoren und ihrer Interaktion mit theologischen und sozioökonomischen Aspekten wird als Forschungsgegenstand hervorgehoben.
2. Die Wittenberger Unruhen: Ursachen - Verlauf - Folgen: Dieses Kapitel analysiert die Wittenberger Unruhen von 1521/22 als den Ausgangspunkt des reformatorischen Bildersturms. Es setzt die Ereignisse in den Kontext der lutherischen Reformation und der Ablassdebatte, wobei Luthers Bruch mit der katholischen Kirche und die daraus resultierenden Veränderungen im kirchlichen Leben dargestellt werden. Die zentrale Rolle Andreas Bodenstein von Karlstadts und seine theologischen Positionen, die zu den Bilderstürmen führten, werden ausführlich behandelt. Der Text beschreibt den Verlauf der Unruhen, die Einführung neuer Gottesdienstordnungen und die Herausbildung unterschiedlicher Positionen innerhalb der Reformation.
3. Die Folgen des Einschreitens Luthers: Das Kapitel erörtert die unmittelbaren und langfristigen Konsequenzen von Luthers Eingreifen in die Wittenberger Unruhen. Es untersucht die Auswirkungen sowohl auf Wittenberg und Karlstadt selbst als auch auf den weiteren Verlauf der Reformation in Deutschland. Die regionale Differenzierung der Folgen wird analysiert, wobei gezeigt wird, dass die Reaktion auf den Bildersturm und die Umsetzung der neuen theologischen Ansichten stark von Ort zu Ort variierte. Der Text betont die komplexen und weitreichenden Auswirkungen der Ereignisse auf die religiöse und soziale Landschaft des 16. Jahrhunderts.
Schlüsselwörter
Reformatorischer Bildersturm, Wittenberg, Andreas Bodenstein von Karlstadt, Martin Luther, Ikonoklasmus, Theologie der Reformation, Ablassstreit, Religiöse Umbrüche, Soziale Geschichte, Regionale Differenzierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Die Wittenberger Unruhen und der Reformatorische Bildersturm
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den reformatorischen Bildersturm, insbesondere die Ereignisse in Wittenberg 1521/22. Sie analysiert die Ursachen, den Verlauf und die Folgen dieser Unruhen, berücksichtigt die unterschiedlichen theologischen Positionen und deren Auswirkungen auf die Reformation und legt einen Schwerpunkt auf die Rolle Andreas Bodensteins von Karlstadt.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die theologischen Grundlagen des Bildersturms, die Rolle Karlstadts, die Auswirkungen der Wittenberger Unruhen auf den Reformationsverlauf, regionale Unterschiede im Umgang mit Bildern während der Reformation und die Definition und Differenzierung von "Bildersturm", "Bildentfernung" und "Bilderfrevel".
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Eine Einleitung mit Fragestellung und Forschungsstand, ein Kapitel zu den Wittenberger Unruhen (Ursachen, Verlauf, Folgen), ein Kapitel zu den Folgen des Eingreifens Luthers (unmittelbare und langfristige Auswirkungen, regionale Differenzierung) und eine Zusammenfassung mit Ausblick.
Was wird in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung beleuchtet die bisherige Forschungslücke zum reformatorischen Bildersturm, hebt die Bedeutung neuerer Forschung hervor, die die Beteiligung verschiedener Bevölkerungsschichten und die regionale Varianz betont. Sie führt den Begriff der Differenzierung zwischen "Bildersturm", "Bildentfernung" und "Bilderfrevel" ein und betont die Bedeutung lokaler Faktoren in Interaktion mit theologischen und sozioökonomischen Aspekten.
Was ist der Inhalt des Kapitels über die Wittenberger Unruhen?
Dieses Kapitel analysiert die Wittenberger Unruhen von 1521/22 als Ausgangspunkt des reformatorischen Bildersturms. Es setzt die Ereignisse in den Kontext der lutherischen Reformation und der Ablassdebatte, beschreibt die zentrale Rolle Karlstadts und seine theologischen Positionen, den Verlauf der Unruhen, die Einführung neuer Gottesdienstordnungen und die Herausbildung unterschiedlicher Positionen innerhalb der Reformation.
Worüber handelt das Kapitel zu den Folgen des Eingreifens Luthers?
Dieses Kapitel erörtert die unmittelbaren und langfristigen Konsequenzen von Luthers Eingreifen in die Wittenberger Unruhen. Es untersucht die Auswirkungen auf Wittenberg und Karlstadt sowie auf den weiteren Verlauf der Reformation in Deutschland und analysiert die regionale Differenzierung der Folgen, die stark von Ort zu Ort variierte.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Reformatorischer Bildersturm, Wittenberg, Andreas Bodenstein von Karlstadt, Martin Luther, Ikonoklasmus, Theologie der Reformation, Ablassstreit, Religiöse Umbrüche, Soziale Geschichte, Regionale Differenzierung.
Welche Forschungslücke schließt diese Arbeit?
Die Arbeit schließt die Forschungslücke bezüglich des reformatorischen Bildersturms, der oft als Randerscheinung betrachtet wurde, indem sie die Beteiligung verschiedener Bevölkerungsschichten und die regionale Varianz der Ereignisse betont.
Welche Rolle spielt Andreas Bodenstein von Karlstadt?
Andreas Bodenstein von Karlstadt spielt eine zentrale Rolle, da seine theologischen Positionen zu den Bilderstürmen führten und ausführlich behandelt werden.
- Citation du texte
- Benjamin Kahlberg (Auteur), 2005, Reformation und theologische Bildkritik. Bilderstürme in ihrem geschichtlichen Kontext, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/508685