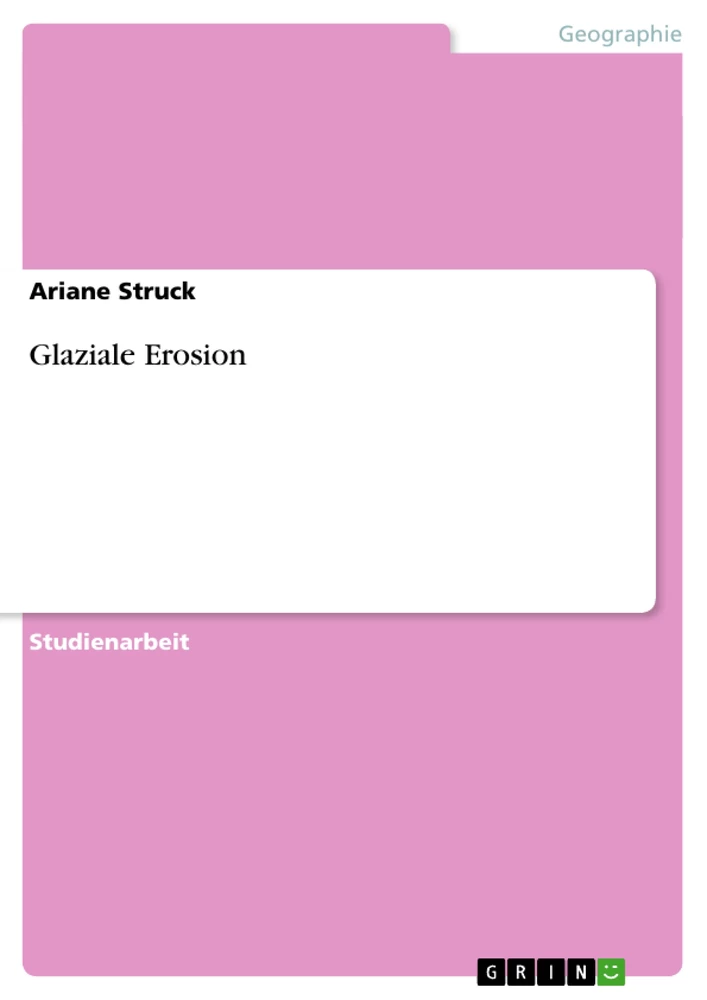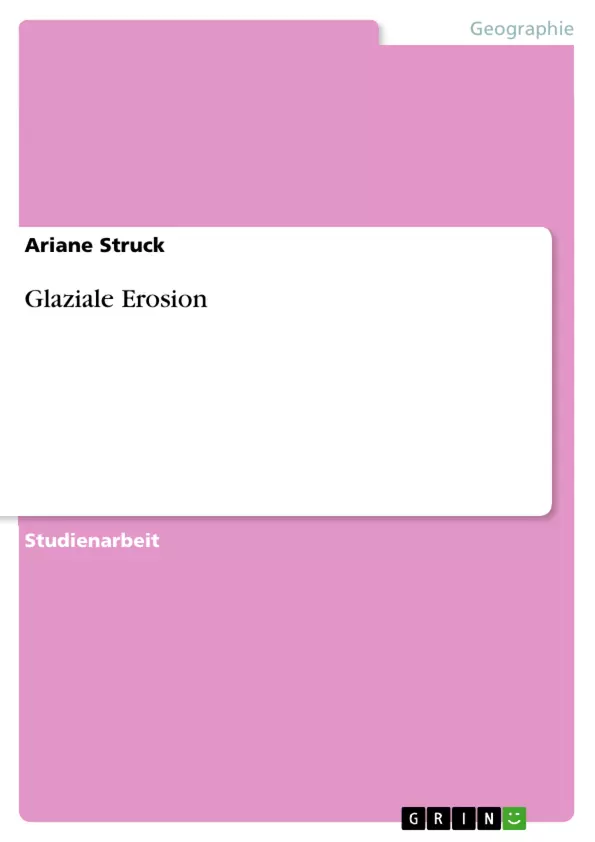1 Einleitung
Gletscher spielten schon immer eine wichtige Rolle bei der Gestaltung der Erdoberfläche.
Somit ist die Glazialerosion als ein Teilgebiet der Geomorphologie anzusehen.
Gletscher prägten eindrücklich die Landschaft die sie früher bedeckten.
Auch heute noch ist das Gletschereis für die Umformung der Landschaft verantwortlich;
denn wie bewegtes Wasser den Untergrund formen kann, formt bewegtes Eis den Untergrund (vgl. Goudie, 1995).
Alle Erscheinungen, die durch einen Gletscher bewirkt werden, bezeichnet man als glazial.
Das Wort "glazial" hat zwei Bedeutungen:
- eine zeitliche
- eine klimatische
Glazialzeiten sind Kaltzeiten des Pleistozän.
Sie haben bestimmte Formbildungen zur Folge und lassen sich unterscheiden:
· Formbildung im Eisland ê werden als periglazial oder glaziäre bezeichnet
· Unmittelbar durchs Eis entstande Formen ê werden als Glazigene Formen bezeichnet
· Die vom Schmelzwasser geschaffenen Formen ê werden als fluvioglazial bezeichnet ( vgl. Schumann, 1989)
Zur Zeit bedecken etwa 15 Millionen Quadratkilometer Eis unser Festland.
Das entspricht etwa 10% der gesamten festen Landfläche.
In Pleistozän bedeckte das Eis 55 Millionen Quadratkilometer, was einer Festlandfläche von 30% entspricht ( vgl. Schulz, 1994).
[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Gletschertypen
- 2.1 Die Kontinentalgletscher
- 2.2 Die Gebirgsgletscher
- 3 Gletscherentstehung
- 3.1 Die Bedeutung von Nähr- und Zehrgebiet
- 3.2 Diagenese von Schnee zu Gletschereis
- 4 Gletscherbewegung
- 4.1 Das Fließen der Gletscherzunge
- 4.2 Gleiten auf der Gesteinsoberfläche
- 4.3 Plastische Deformation
- 4.4 Die Geschwindigkeit
- 5 Inlandeis
- 5.1 Charakteristik und Anordnung von Inlandeis
- 5.2 Die Erosionsarbeit der Inlandeismasse
- 6 Gletschererosion
- 6.1 Die Wirkung auf das Gestein und den Untergrund
- 6.2 Detersion
- 6.3 Detraktion
- 7 Schmelzwasser
- 8 Glazigene Formen
- 8.1 Kare
- 8.3 Hängetäler
- 8.4 Fjorde
- 8.5 Rundhöcker
- 8.6 Zungenbecken
- 8.7 Nunatakker
- 8.8 Limestone Pavements
- 9 Selektive Erosion
- 9.1 Crag-and-Tail-Strukturen
- 9.2 Streckungs- und Stauchungszonen
- 9.3 Konfluenzstufen
- 9.4 Diffluenzstufen
- 9.5 Felsriegel
- 9.6 Transfluenz
- 10 Schlußworte
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit zielt darauf ab, die Glazialerosion als geomorphologischen Prozess zu beschreiben und zu erklären. Sie beleuchtet die verschiedenen Gletschertypen, ihre Entstehung und Bewegung, sowie deren erosive Wirkung auf die Landschaft. Die Arbeit fokussiert auf die verschiedenen Formen der glazialen Abtragung und die daraus resultierenden landschaftlichen Merkmale.
- Gletschertypen und ihre Klassifizierung
- Prozesse der Gletscherentstehung und -bewegung
- Mechanismen der Glazialerosion
- Glazigene Formen und ihre Entstehung
- Selektive Erosion und ihre Auswirkungen
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Glazialerosion ein und betont die Bedeutung von Gletschern für die Gestaltung der Erdoberfläche. Sie definiert den Begriff „glazial“ in seinen zeitlichen und klimatischen Bedeutungen und unterscheidet zwischen periglazialen, glazigenen und fluvioglazialen Formen. Die Einleitung stellt die große Ausdehnung der Gletscher in der Vergangenheit gegenüber der heutigen Situation und leitet zu den folgenden Kapiteln über, die Gletschertypen, ihre Entstehung, Bewegung und ihre erosive Wirkung detailliert beschreiben.
2 Gletschertypen: Dieses Kapitel klassifiziert Gletscher in Kontinental- und Gebirgsgletscher. Es beschreibt detailliert verschiedene Arten von Kontinentalgletschern, darunter Inlandeis, Eiskappen, Eisdome, Auslassgletscher, Eisschelfe und Plateaugletscher. Für jeden Typ werden die charakteristischen Merkmale und Ausmaße erläutert, wobei der Plateaugletscher mit einer Abbildung veranschaulicht wird. Das Kapitel legt somit die Grundlage für das Verständnis der unterschiedlichen Erosionswirkungen verschiedener Gletschertypen.
3 Gletscherentstehung: Dieses Kapitel konzentriert sich auf den Prozess der Gletscherbildung. Es beschreibt die Bedeutung des Nähr- und Zehrgebietes für die Massenbilanz eines Gletschers und erläutert detailliert die Diagenese von Schnee zu Gletschereis, also die Transformation von Schnee in kompaktes Eis unter dem Einfluss von Druck und Temperatur. Diese Prozesse sind essentiell, um das Verständnis der Gletscherdynamik und ihrer Erosionskraft zu gewährleisten.
4 Gletscherbewegung: Dieses Kapitel befasst sich mit den Mechanismen der Gletscherbewegung. Es beschreibt das Fließen der Gletscherzunge, das Gleiten auf der Gesteinsoberfläche, die plastische Deformation des Eises und die Faktoren, welche die Geschwindigkeit der Gletscherbewegung beeinflussen. Diese dynamischen Prozesse sind grundlegend für die Verständnis der Erosionsleistung der Gletscher.
5 Inlandeis: Das Kapitel widmet sich dem Inlandeis, charakterisiert dessen Anordnung und beschreibt dessen spezifische Erosionsarbeit. Es wird deutlich gemacht, wie die massive Eisdecke das darunterliegende Gestein beeinflusst und umformt. Dies ist ein wichtiger Aspekt, da Inlandeis eine besonders starke erosive Kraft besitzt.
6 Gletschererosion: Dieses Kapitel analysiert die Erosionswirkung von Gletschern, insbesondere deren Einfluss auf das Gestein und den Untergrund. Es unterscheidet verschiedene Prozesse wie Detersion und Detraktion und erklärt deren Bedeutung für die Formenbildung in glazial geprägten Landschaften. Das Kapitel bildet den Kern der Arbeit, da es die verschiedenen Mechanismen der Abtragung detailliert beschreibt.
7 Schmelzwasser: Dieses Kapitel befasst sich mit der Rolle des Schmelzwassers in der Gestaltung der Landschaft. Es beschreibt die Prozesse und die geomorphologischen Auswirkungen des Schmelzwassers auf die durch Gletscher geformte Landschaft. Diese Prozesse sind oft untrennbar mit der eigentlichen Gletschererosion verbunden.
8 Glazigene Formen: Dieses Kapitel behandelt die verschiedenen glazigenen Formen, die durch die Gletschererosion entstehen, wie z.B. Kare, Hängetäler, Fjorde, Rundhöcker, Zungenbecken, Nunatakker und Limestone Pavements. Für jede Form wird die Entstehungsweise und die charakteristischen Merkmale beschrieben, und der Zusammenhang zur Gletscherdynamik wird erläutert.
9 Selektive Erosion: Dieses Kapitel erklärt den Prozess der selektiven Erosion durch Gletscher, unter Berücksichtigung von Beispielen wie Crag-and-Tail-Strukturen, Streckungs- und Stauchungszonen, Konfluenz- und Diffluenzstufen, Felsriegeln und Transfluenz. Die selektive Erosion unterstreicht die Komplexität der glazialen Abtragungsprozesse.
Schlüsselwörter
Glazialerosion, Gletschertypen, Gletscherentstehung, Gletscherbewegung, Inlandeis, Glazigene Formen, Selektive Erosion, Detersion, Detraktion, Geomorphologie.
Häufig gestellte Fragen: Glazialerosion
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über das Thema Glazialerosion. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel sowie ein Glossar mit Schlüsselbegriffen. Der Fokus liegt auf der Beschreibung und Erklärung der Glazialerosion als geomorphologischen Prozess, einschließlich der verschiedenen Gletschertypen, ihrer Entstehung und Bewegung sowie ihrer erosiven Wirkung auf die Landschaft.
Welche Gletschertypen werden behandelt?
Das Dokument klassifiziert Gletscher in Kontinental- und Gebirgsgletscher und beschreibt detailliert verschiedene Arten von Kontinentalgletschern, darunter Inlandeis, Eiskappen, Eisdome, Auslassgletscher, Eisschelfe und Plateaugletscher. Die charakteristischen Merkmale und Ausmaße jedes Typs werden erläutert.
Wie entsteht ein Gletscher?
Die Gletscherentstehung wird durch die Bedeutung von Nähr- und Zehrgebiet für die Massenbilanz eines Gletschers erklärt. Der Prozess der Diagenese von Schnee zu Gletschereis, also die Transformation von Schnee in kompaktes Eis unter Druck und Temperatur, wird detailliert beschrieben.
Wie bewegen sich Gletscher?
Die Mechanismen der Gletscherbewegung werden im Detail erläutert, einschließlich des Fließens der Gletscherzunge, des Gleitens auf der Gesteinsoberfläche, der plastischen Deformation des Eises und der Faktoren, die die Geschwindigkeit der Gletscherbewegung beeinflussen.
Welche Rolle spielt Inlandeis bei der Erosion?
Das Dokument widmet sich der spezifischen Erosionsarbeit von Inlandeis, charakterisiert dessen Anordnung und beschreibt, wie die massive Eisdecke das darunterliegende Gestein beeinflusst und umformt. Die besonders starke erosive Kraft des Inlandeises wird hervorgehoben.
Wie wirkt sich Glazialerosion auf das Gestein aus?
Die Erosionswirkung von Gletschern auf Gestein und Untergrund wird analysiert. Verschiedene Prozesse wie Detersion und Detraktion werden unterschieden und ihre Bedeutung für die Formenbildung in glazial geprägten Landschaften erklärt. Dies bildet den Kern des Dokuments, da die verschiedenen Mechanismen der Abtragung detailliert beschrieben werden.
Welche Rolle spielt Schmelzwasser?
Die Rolle des Schmelzwassers in der Gestaltung der Landschaft wird beschrieben, einschließlich der Prozesse und der geomorphologischen Auswirkungen auf die durch Gletscher geformte Landschaft. Der untrennbare Zusammenhang mit der Gletschererosion wird betont.
Welche glazigenen Formen werden beschrieben?
Das Dokument beschreibt verschiedene glazigene Formen, die durch Gletschererosion entstehen, wie Kare, Hängetäler, Fjorde, Rundhöcker, Zungenbecken, Nunatakker und Limestone Pavements. Für jede Form wird die Entstehungsweise und die charakteristischen Merkmale beschrieben, und der Zusammenhang zur Gletscherdynamik wird erläutert.
Was ist selektive Erosion?
Selektive Erosion durch Gletscher wird erklärt, einschließlich von Beispielen wie Crag-and-Tail-Strukturen, Streckungs- und Stauchungszonen, Konfluenz- und Diffluenzstufen, Felsriegeln und Transfluenz. Die Komplexität der glazialen Abtragungsprozesse wird hervorgehoben.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die Schlüsselwörter umfassen Glazialerosion, Gletschertypen, Gletscherentstehung, Gletscherbewegung, Inlandeis, Glazigene Formen, Selektive Erosion, Detersion, Detraktion und Geomorphologie.
- Quote paper
- Ariane Struck (Author), 1998, Glaziale Erosion, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/5086