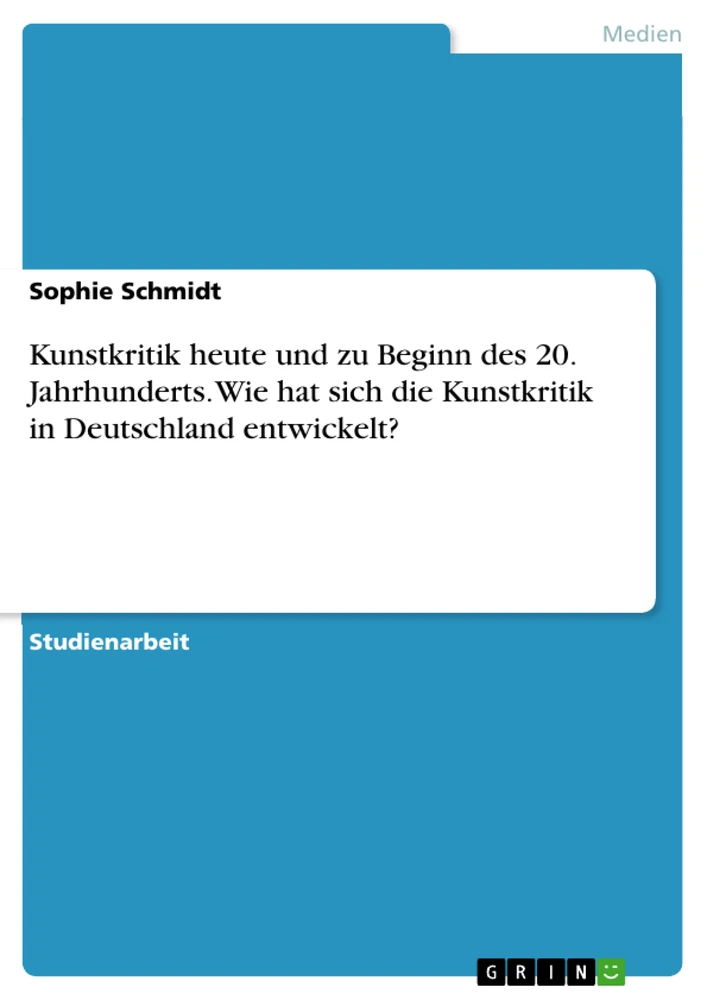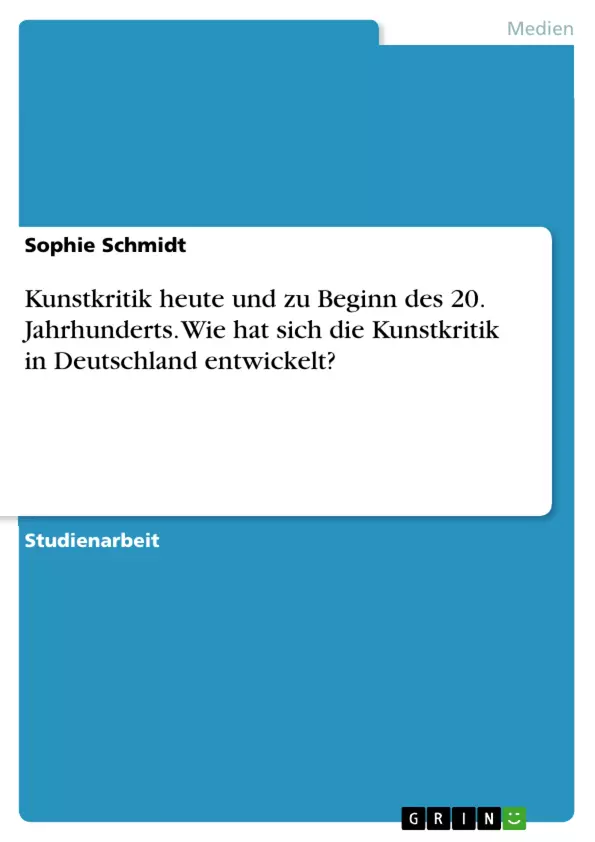Die Arbeit untersucht, inwieweit Kunstkritik auch heute noch als Untersuchung, Wertung und Beeinflussung der zeitgenössischen Kunst verstanden wird. Wann wurde diesem Grundsatz gefolgt, wann nicht und aus welchem Grund jeweils?
Sie beschränkt sich in dieser Betrachtung auf die Kunstkritik zu Beginn des zwanzigsten und des einundzwanzigsten Jahrhunderts in Deutschland. Ein kurzer Vergleich mit vorangegangenen Epochen findet ebenfalls statt.
Um sich der Kunstkritik des 20. Jahrhunderts zu nähern, beschäftigt sich die Autorin hauptsächlich mit Karl Scheffler– einem der einflussreichsten und fortschrittlichsten Kritiker seiner Zeit, der sich nicht nur mehrfach über das Wesen der Kunst sondern auch über das der Kunstkritik geäußert hat und daher eine gute Grundlage für die Beschäftigung mit diesem Thema darstellt.
Die eingangs genannte Definition stellt allerdings nicht nur eine Konkretisierung der Dresdners dar, sondern bringt auch einen anderen wichtigen Begriff zur Sprache: den des Missverständnisses. Wie Fehlurteile zu den jeweiligen Zeiten bewertet werden und wie mit ihnen umgegangen wurde bzw. wird, ist ebenfalls ein Teil dieser Arbeit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kunstkritiker als „Weggefährten der Künstler“
- Der Umbruch in der Kunstkritik um 1900
- Das Verhältnis von Künstler, Kunstkritiker und Publikum
- Karl Schefflers Anforderungen an die Kunstkritik
- Zeitgenössische Kunst und ihre Kritiker
- Kunst ohne Kriterien
- Der Markt ersetzt den Kunstkritiker
- Der Beruf des Kunstkritikers heute
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung der Kunstkritik zu Beginn des 20. und des 21. Jahrhunderts in Deutschland, indem sie die Unterschiede zwischen den Ansätzen und den Methoden der Kunstkritik dieser beiden Epochen analysiert. Sie konzentriert sich dabei auf die Rolle des Kunstkritikers als Vermittler zwischen Künstler und Publikum, als Wegbereiter der Moderne und als kritischen Beobachter der künstlerischen Entwicklung.
- Der Wandel der Kunstkritik um 1900
- Das Verhältnis zwischen Künstler, Kunstkritiker und Publikum
- Die Rolle der Kunstkritik in der Entwicklung der Moderne
- Die Bedeutung der Kunstkritik für die öffentliche Wahrnehmung der Kunst
- Die Herausforderungen der Kunstkritik im 21. Jahrhundert
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Kunstkritik ein und definiert die Aufgabe des Kunstkritikers. Sie beleuchtet die Definition von Albert Dresdner und betont die Relevanz des Themas „Missverständnis“ in der Kunstkritik.
Kapitel 2.1 analysiert den Umbruch in der Kunstkritik um 1900. Der Fokus liegt auf dem Konflikt zwischen den traditionellen Kunstkritikern und den neuen, progressiven Künstlern, die sich in der Sezession zusammenschlossen. Es werden die Methoden und die Sprache der Kunstkritik dieser Zeit beleuchtet.
Kapitel 2.2 betrachtet das Verhältnis von Künstler, Kunstkritiker und Publikum. Die Rolle des Kunstkritikers als Vermittler und Wegbereiter der Moderne wird beleuchtet. Es werden die Herausforderungen und die Möglichkeiten der Kunstkritik als Instanz zwischen Künstler und Publikum diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beleuchtet die Entwicklung der Kunstkritik in Deutschland, insbesondere den Wandel von der traditionellen Kunstkritik des 19. Jahrhunderts zur modernen Kunstkritik des 20. und 21. Jahrhunderts. Dabei stehen die Themen des Kunstbegriffs, der Künstlerrolle, die Beziehung zwischen Kunst und Publikum sowie die Funktion der Kunstkritik im Zentrum.
Häufig gestellte Fragen
Wie hat sich die Kunstkritik in Deutschland entwickelt?
Die Arbeit untersucht den Wandel von der traditionellen Kritik des 19. Jahrhunderts zur modernen Kunstkritik, die als Wegbereiter der Moderne fungierte.
Wer war Karl Scheffler?
Karl Scheffler war einer der einflussreichsten Kunstkritiker des frühen 20. Jahrhunderts in Deutschland, der das Wesen der Kunst und der Kritik maßgeblich definierte.
Was änderte sich in der Kunstkritik um 1900?
Es kam zu einem Umbruch, bei dem progressive Kritiker zu "Weggefährten der Künstler" wurden und neue ästhetische Maßstäbe gegen traditionelle Institutionen verteidigten.
Welche Rolle spielt der Markt für die heutige Kunstkritik?
Es wird diskutiert, inwieweit der Kunstmarkt heute die wertende Funktion des Kritikers ersetzt hat und welche Herausforderungen dies für den Beruf mit sich bringt.
Was versteht man unter dem Begriff des "Missverständnisses"?
Die Arbeit analysiert, wie Fehlurteile in der Kunstkritik zu verschiedenen Zeiten bewertet wurden und welchen Einfluss sie auf die Kunstgeschichte hatten.
- Quote paper
- Sophie Schmidt (Author), 2016, Kunstkritik heute und zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Wie hat sich die Kunstkritik in Deutschland entwickelt?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/508709