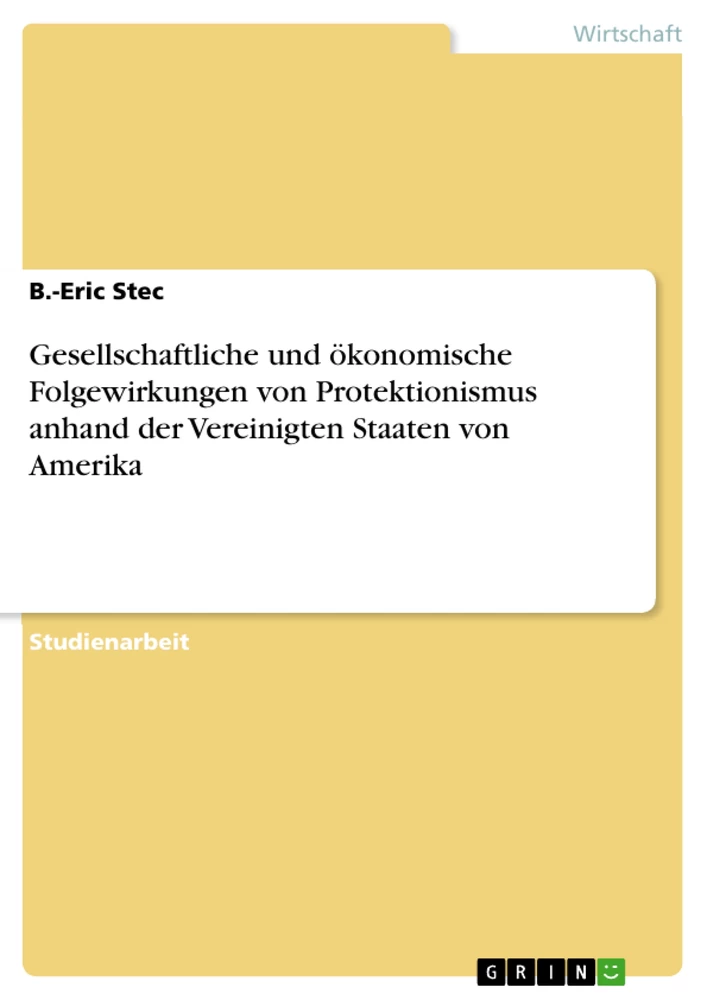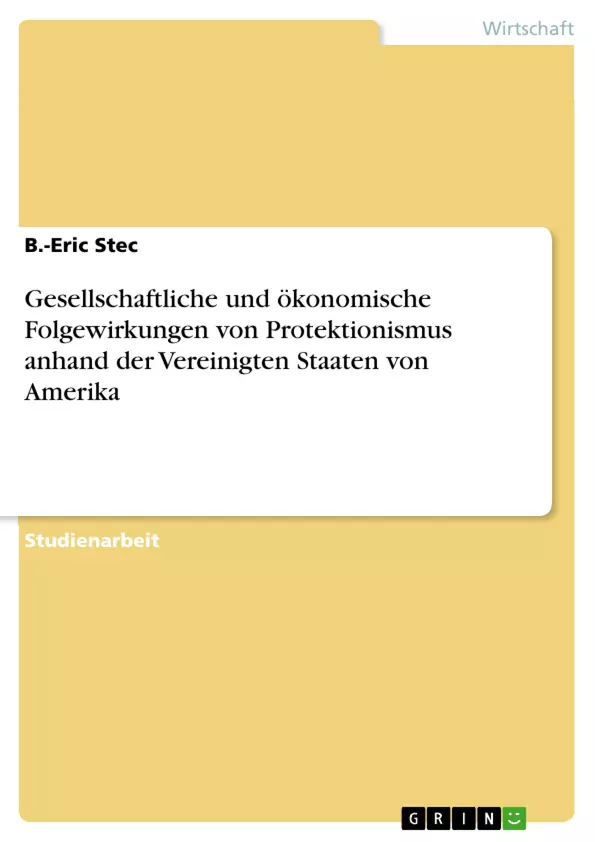Die Auswirkungen von protektionistischer Wirtschaftspolitik werden nicht erst seit der Wahl von Donald J. Trump zum 44. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika im aktuellen volkswirtschaftlichem, gesellschaftlichen, politischen und auch wirtschaftshistorischen Kontext diskutiert. Gleichwohl hat sich die Dynamik der handelspolitischen Auseinandersetzungen spätestens seit der Inauguration des Republikaners im Januar 2017 erheblich gesteigert. Mit Vorschlägen wie Strafzöllen auf deutsche Auto-Importe in die USA und der gezielten Förderung der heimischen Wirtschaft gewann die öffentliche Meinungsbildung zur Thematik Protektionismus erheblich an Bedeutung. Dass es protektionistische Tendenzen in der Wirtschaftshistorie der US-Wirtschaft nicht erst seit letztem Jahr gibt, verdeutlicht sich an den Reaganomics während der 1980er Jahre oder auch am McKinley Tariff gegen Ende des 20. Jahrhunderts. Die vorliegende Seminararbeit soll einen Überblick über die handelspolitischen Entwicklungen und ökonomischen Implikationen im Zeitverlauf geben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Protektionistische Instrumente
- Tarifäre Handelshemmnisse
- Importzoll
- Exportzoll
- Nichttarifäre Handelshemmnisse
- Import- und Exportquote
- Fakultative Exportquote
- Local-Content Klausel
- Technische Normen und Standards
- Zollstandards
- Tarifäre Handelshemmnisse
- Protektionismus unter Benjamin Harrison
- Protektionismus unter Ronald Reagan
- Protektionismus unter Donald Trump
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit analysiert die Auswirkungen protektionistischer Wirtschaftspolitik, insbesondere auf die Binnenwirtschaft und die öffentliche Wahrnehmung dieser ökonomischen Effekte. Die Arbeit beleuchtet die Wirkkraft diverser protektionistischer Maßnahmen im globalhistorischen Kontext und vergleicht diese anhand konkreter Beispiele.
- Auswirkungen von Protektionismus auf die Binnenwirtschaft
- Öffentliche Wahrnehmung von protektionistischen Maßnahmen
- Vergleichende Analyse von protektionistischen Instrumenten
- Globalhistorische Einordnung von Protektionismus in den USA
- Die Rolle des Freihandels und die ökonomischen Argumente für und gegen Protektionismus
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der protektionistischen Wirtschaftspolitik ein und beleuchtet die aktuellen Diskussionen im Kontext der US-amerikanischen Außenpolitik. Die zweite Sektion bietet einen Überblick über die wichtigsten Instrumente des Protektionismus, sowohl tarifäre als auch nichttarifäre Handelshemmnisse. Die folgenden Kapitel analysieren die protektionistische Wirtschaftspolitik in den USA unter den Präsidenten Benjamin Harrison, Ronald Reagan und Donald Trump.
Schlüsselwörter
Protektionismus, Globalisierung, Freihandel, Handelshemmnisse, tarifäre und nichttarifäre Maßnahmen, Binnenwirtschaft, öffentliche Wahrnehmung, USA, Wirtschaftshistorie, Reaganomics, McKinley Tariff, Terms of Trade, Ricardo, komparative Kostenvorteile.
Häufig gestellte Fragen
Was sind tarifäre Handelshemmnisse?
Dazu gehören direkte Abgaben auf den Warenverkehr, wie Import- und Exportzölle.
Was ist der Unterschied zu nichttarifären Handelshemmnissen?
Nichttarifäre Hemmnisse sind indirekte Maßnahmen wie Importquoten, technische Normen, Standards oder Local-Content-Klauseln.
Wie prägte Donald Trump den modernen Protektionismus?
Durch die Einführung von Strafzöllen und die gezielte Förderung der heimischen Wirtschaft ("America First") steigerte er die Dynamik handelspolitischer Auseinandersetzungen erheblich.
Gab es Protektionismus in den USA schon vor Trump?
Ja, historische Beispiele sind der McKinley Tariff Ende des 19. Jahrhunderts und die "Reaganomics" in den 1980er Jahren.
Welche Auswirkungen hat Protektionismus auf die Binnenwirtschaft?
Er kann kurzfristig heimische Industrien schützen, führt aber oft zu höheren Preisen für Konsumenten und kann Gegenmaßnahmen anderer Staaten auslösen.
- Quote paper
- B.-Eric Stec (Author), 2018, Gesellschaftliche und ökonomische Folgewirkungen von Protektionismus anhand der Vereinigten Staaten von Amerika, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/508760