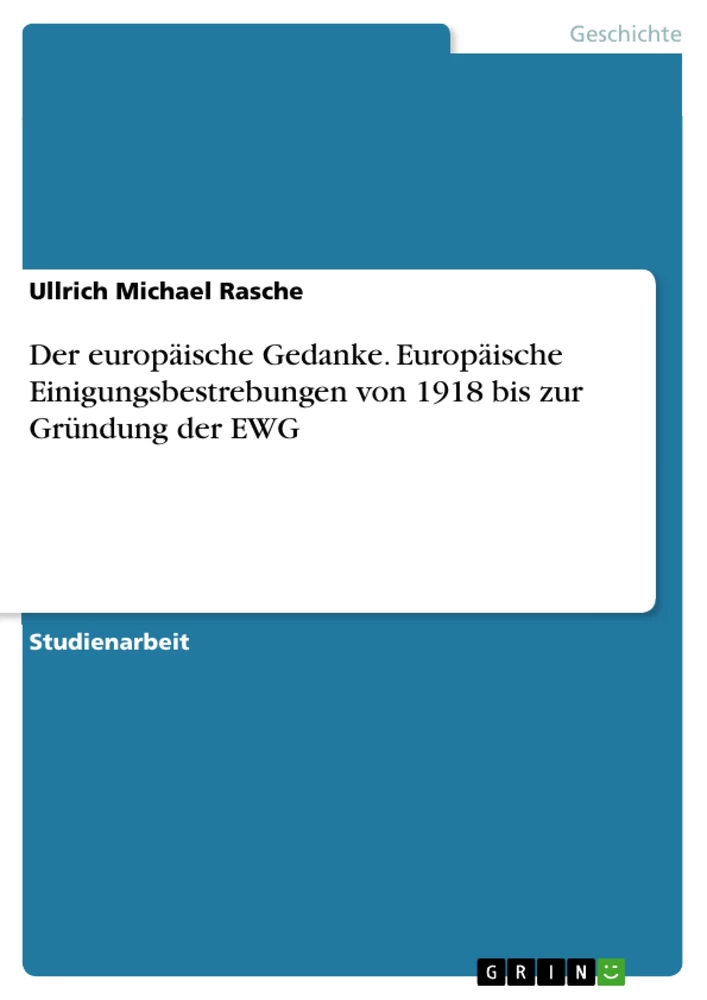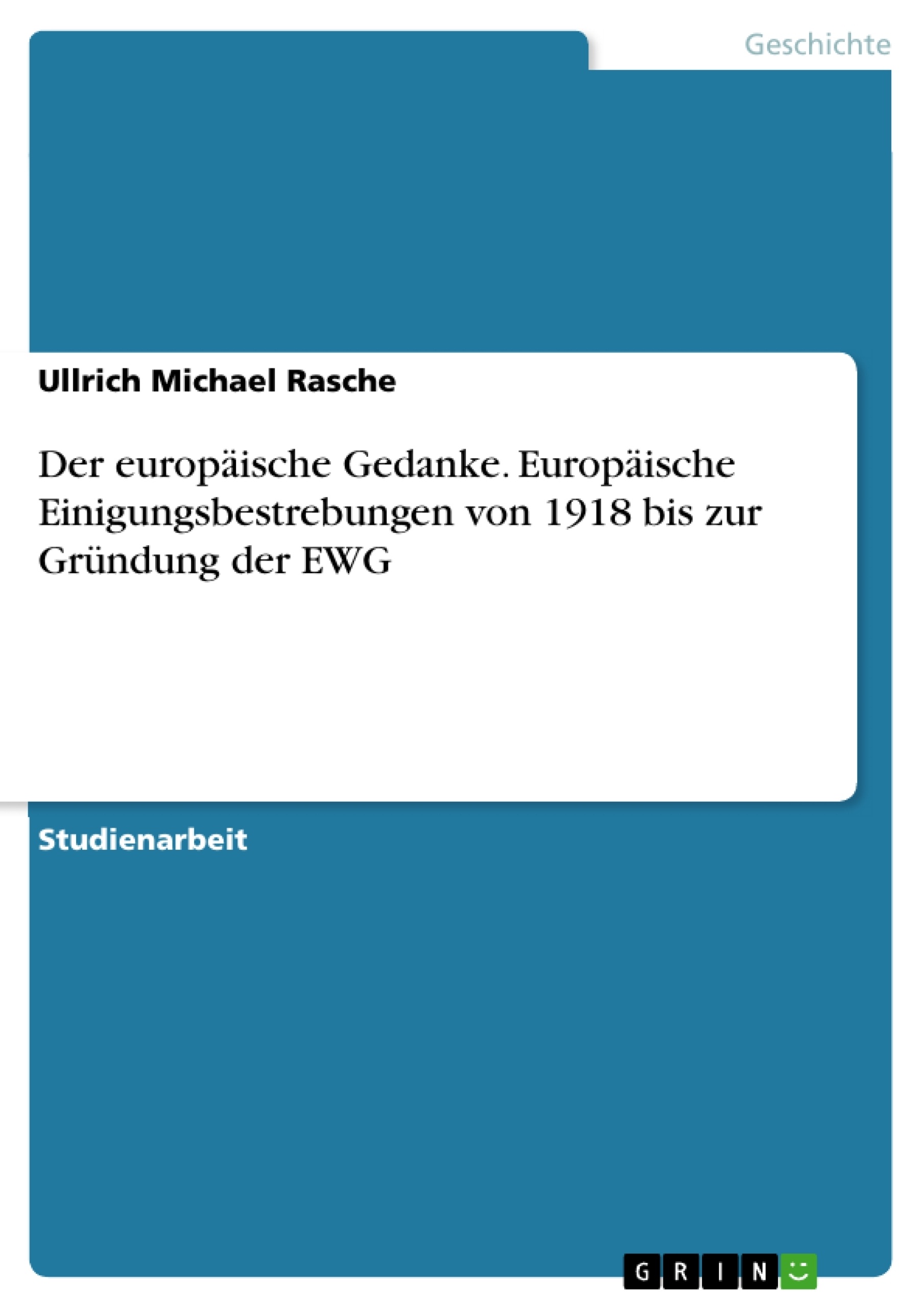Diese Arbeit gibt einen Überblick über die Entwicklung eines europäischen Gedankens beginnend mit Einigungsbestrebungen von 1918 bis zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) im Jahr 1957. Dabei analysiert sie, was in unterschiedlichen Phasen "Europa" bedeutet hat. Die Schwierigkeiten einer Begriffsbestimmung beginnen bei dem Versuch der ethnischen und geographischen Umschreibung von "Europa". Die meisten Europäer stammen ihrer Herkunft nach aus dem Bereich der germanisch-romanischen und slawischen Völker, die alle der indo-europäischen Völkerfamilie angehören.
Inhaltsverzeichnis
- Die Vorgeschichte
- Die Zäsur des 1. Weltkrieges—Rahmenbedingungen für Transfer und Umsetzung des Europa-Gedankens
- Das besondere Beispiel der „Paneuropa-Union“
- Niedergang der „Europa-Netzwerke“ mit der Wirtschaftskrise und dem Erstarken des europäischen Faschismus
- Stillstand: Die,,dunklen Jahre\" 1933-45
- Neubeginn auf den Trümmern Europas
- Der Weg bis zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit „Der europäische Gedanke“ befasst sich mit der Entwicklung europäischer Einigungsbestrebungen von 1918 bis zur Gründung der EWG. Dabei werden die verschiedenen Strömungen und Akteure dieser Zeit analysiert, insbesondere die Paneuropa-Bewegung. Die Arbeit beleuchtet die historische und politische Entwicklung des Europa-Gedankens, die Bedeutung des 1. Weltkriegs als Zäsur und den Einfluss des Nationalismus und des europäischen Faschismus auf die europäische Integration.
- Die Entstehung des Europa-Gedankens und seine historischen Wurzeln
- Die Rolle des 1. Weltkriegs als Katalysator für die europäischen Einigungsbestrebungen
- Die Paneuropa-Bewegung als bedeutende Kraft im Kampf für ein vereintes Europa
- Der Einfluss von Nationalismus und Faschismus auf die europäische Integration
- Die Bedeutung der europäischen Wirtschaft und die Herausforderungen der Nachkriegszeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Vorgeschichte
Dieses Kapitel behandelt die historische Entwicklung des Europa-Gedankens und beleuchtet die Bedeutung von Kultur, Religion und Politik für die Entstehung einer europäischen Identität. Es werden verschiedene Definitionen von „Europa“ erörtert und die Bedeutung der geistigen und politischen Strömungen im Mittelalter und der frühen Neuzeit hervorgehoben. Das Kapitel beleuchtet die Herausforderungen, die mit der Definition und Gestaltung eines vereinten Europas einhergehen, sowie die frühen Versuche, europäische Gemeinsamkeit zu erreichen.
Die Zäsur des 1. Weltkrieges-Rahmenbedingungen für Transfer und Umsetzung des Europa-Gedankens
Dieses Kapitel analysiert die Folgen des 1. Weltkriegs für die europäische Integration und beleuchtet die neuen Rahmenbedingungen, die sich durch den Krieg ergeben. Es werden die Entstehung und Entwicklung verschiedener Initiativen für ein vereintes Europa dargestellt, einschließlich der Paneuropa-Union von Richard Coudenhove-Kalergi, sowie anderer Komitees und Netzwerke. Das Kapitel diskutiert die unterschiedlichen Perspektiven und Ziele der Protagonisten des Europa-Gedankens sowie die Rolle der internationalen Wirtschaft und Politik in dieser Zeit.
Das besondere Beispiel der „Paneuropa-Union“
Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Paneuropa-Bewegung als eine der wichtigsten und einflussreichsten Strömungen der europäischen Einigungsbestrebungen. Es erläutert die Ziele und Prinzipien der Bewegung, die Rolle von Richard Coudenhove-Kalergi als ihrem prominentesten Vertreter und die Schwierigkeiten und Herausforderungen, mit denen die Bewegung im Laufe der Zeit konfrontiert war. Das Kapitel beleuchtet die Ideen und Konzepte der Paneuropa-Bewegung im Kontext der politischen und wirtschaftlichen Entwicklung Europas und die Bedeutung der Bewegung für die spätere europäische Integration.
Niedergang der „Europa-Netzwerke“ mit der Wirtschaftskrise und dem Erstarken des europäischen Faschismus
Dieses Kapitel beschreibt den Niedergang der europäischen Einigungsbestrebungen im Zuge der Wirtschaftskrise und dem Erstarken des europäischen Faschismus in den 1930er Jahren. Es beleuchtet die Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise auf die europäischen Gesellschaften und die politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen, die sich daraus ergaben. Das Kapitel zeigt die Bedeutung von Nationalismus und Ideologien wie dem Faschismus für die Zerstörung der europäischen Einigungsbestrebungen und den Aufstieg der Diktatur in Europa.
Neubeginn auf den Trümmern Europas
Dieses Kapitel behandelt die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg und den Beginn eines neuen Zeitabschnitts für die europäischen Einigungsbestrebungen. Es erläutert die Herausforderungen und die Chancen, die sich aus den Ruinen Europas ergeben. Die Diskussion konzentriert sich auf die politischen, wirtschaftlichen und sozialen Aspekte des Wiederaufbaus Europas und die Bedeutung der europäischen Integration als Mittel zur Verhinderung weiterer Konflikte.
Der Weg bis zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG)
Dieses Kapitel beleuchtet die verschiedenen Schritte, die zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) geführt haben. Es analysiert die politischen und wirtschaftlichen Faktoren, die die Integration Europas in den 1950er Jahren vorangetrieben haben, sowie die Rolle der verschiedenen Akteure und die Herausforderungen, die in diesem Prozess bestanden. Das Kapitel beschreibt die Entstehung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) und die weitere Entwicklung der europäischen Integration bis zur Gründung der EWG.
Schlüsselwörter
Die Arbeit verwendet Schlüsselbegriffe wie Europa-Gedanke, Europäische Einigungsbestrebungen, Paneuropa-Bewegung, Nationalismus, Faschismus, Wirtschaft, Politik, Geschichte und Integration. Weitere wichtige Begriffe sind: Versailles, Völkerbund, Weimarer Republik, Wirtschaftskrise, Zweiter Weltkrieg und die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG).
- Quote paper
- Ullrich Michael Rasche (Author), 2016, Der europäische Gedanke. Europäische Einigungsbestrebungen von 1918 bis zur Gründung der EWG, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/508858