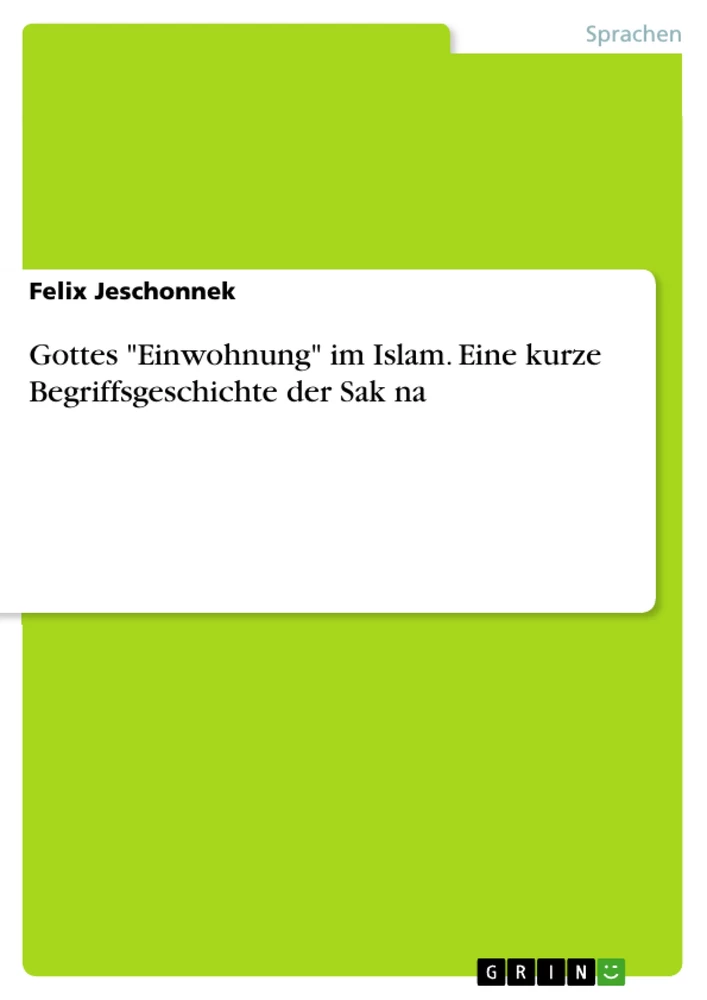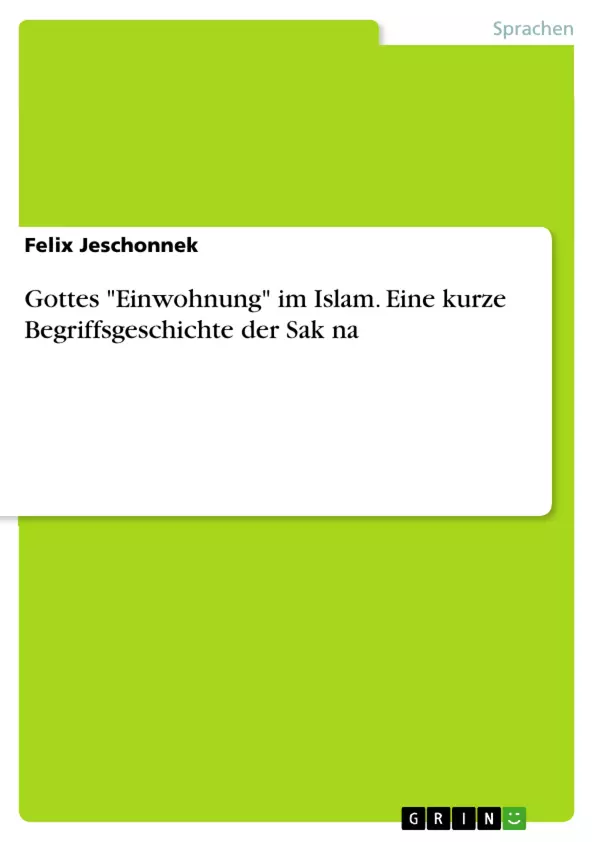In unterschiedlichen Kontexten, kann Sakîna unterschiedliche Bedeutungen annehmen, bedeutet aber unter anderem Seelenruhe, Heiligkeit, Anwesenheit Gottes oder göttliche Kraft. Welche Bedeutung Sakîna inne liegt und wie sich ihre Bedeutung wandelt wird hier kurz dargestellt werden. Der Begriff macht einen Transferprozess deutlich, welcher die Geschichte und die Kultur des Judentums und des Islams in ein enges Verhältnis zueinander bringt. An der Entwicklung des Wortes Sakîna wird eine Befruchtung der Religionen untereinander deutlich und ihre kulturelle Nähe tritt stärker zu Tage. Die Vieldeutigkeit des Wortes bietet aber womöglich, durch die Art wie es mit Bedeutung angereichert wird, einen neuen Blick auf den Islam. Edas Wort wird eine Projektionsfläche und von Gläubigen und Würdenträgern gleichermaßen mit Bedeutung angereichert. Diese Arbeit wird Ignaz Goldzihers Ausführungen über den Begriff Sakîna im ersten Teil seiner Abhandlungen zur arabischen Philologie folgen. Darüber hinaus, wird anhand von Clemens Thomas Arbeit am Begriff Schekhina versucht die Bedeutung des ersteren Wortes genauer einzugrenzen. Die Eingrenzung wird erschwert durch die nicht klar definierte Natur des Begriffs, welche die Beschäftigung mit ihm aber umso reizvoller macht.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Sakina im Koran
- 1.2 Schekhina - Die Braut Gottes
- 2. Sakina als subjektiver Gemütszustand
- 2.1 Sakîna in den Hadithen
- 3. Abschließende Betrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Begriff Sakîna im Islam, seine Entwicklung und seine vielschichtigen Bedeutungen. Sie verfolgt das Ziel, die semantische Entwicklung des Begriffs nachzuvollziehen und seine Verbindungen zum jüdischen Begriff Schekhina aufzuzeigen. Die Arbeit beleuchtet den Transferprozess zwischen jüdischer und islamischer Kultur und Religion, der durch den Begriff Sakîna verdeutlicht wird.
- Die verschiedenen Bedeutungen von Sakîna im Koran und in der islamischen Tradition
- Der Vergleich von Sakîna mit dem jüdischen Begriff Schekhina
- Die Rolle von Sakîna als Ausdruck göttlicher Gegenwart und Macht
- Die kulturelle und religiöse Nähe zwischen Judentum und Islam
- Die Verwendung von Sakîna als Projektionsfläche für religiöse und kulturelle Vorstellungen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt den Begriff Sakîna als vielschichtig und kontextabhängig. Sie kündigt den Vergleich mit dem jüdischen Begriff Schekhina an und benennt Ignaz Goldziher und Clemens Thoma als wichtige Referenzautoren. Die Arbeit betont die Bedeutung von Sakîna als Brücke zwischen jüdischer und islamischer Kultur und die Vieldeutigkeit des Wortes als Chance für neue Perspektiven auf den Islam.
1.1 Sakina im Koran: Dieses Kapitel analysiert die Verwendung von Sakîna im Koran. Es hebt die Schwierigkeiten hervor, eine einheitliche Definition zu finden, da der Begriff je nach Kontext unterschiedliche Bedeutungen annimmt, von Seelenruhe bis hin zur göttlichen Präsenz. Ein Schlüsselvers (2:248) wird detailliert untersucht, der Sakîna mit der Bundeslade und der Anwesenheit Gottes verbindet. Goldzihers Argumentation, dass Mohammed den Begriff "flüchtig aufgerafft" habe und dessen Verwendung im Koran größtenteils von der jüdischen Schekhina abweiche, wird präsentiert. Ein weiterer Vers (9:25f) wird beleuchtet, in dem Sakîna als ein Aspekt göttlicher Macht beschrieben wird, der die Gläubigen stärkt und die Feinde besiegt.
1.2 Schekhina - Die Braut Gottes: Dieses Kapitel widmet sich dem jüdischen Begriff Schekhina und dessen Verbindung zu Sakîna. Es wird die Bedeutung von Schekhina als "Einwohnung" oder "Gegenwärtigkeit Gottes" erläutert. Der Vergleich mit Sakîna in Sure 2:248 verdeutlicht die Ähnlichkeit in der Bedeutung göttlicher Präsenz. Die Darstellung der Schekhina als weibliche Gottheit ("Braut Gottes") und ihre Rolle als Vermittlerin zwischen Gott und seinem Volk Israel wird diskutiert, wobei die Verbindung zu Exodus 3:16 hervorgehoben wird, der die von Gott beobachteten Ereignisse in femininer Form ausdrückt.
Schlüsselwörter
Sakîna, Schekhina, Koran, Hadithe, Ignaz Goldziher, Clemens Thoma, göttliche Gegenwart, Seelenruhe, Judentum, Islam, interreligiöser Vergleich, kultureller Austausch, religiöse Symbolik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Sakîna und Schekhina: Ein interreligiöser Vergleich
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Begriff Sakîna im Islam, seine Entwicklung und seine vielschichtigen Bedeutungen. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Vergleich mit dem jüdischen Begriff Schekhina und der Analyse des kulturellen und religiösen Austauschs zwischen Judentum und Islam, der durch diesen Begriff verdeutlicht wird.
Welche Aspekte von Sakîna werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die verschiedenen Bedeutungen von Sakîna im Koran und in den Hadithen, von Seelenruhe bis hin zur göttlichen Präsenz und Macht. Sie analysiert die Verwendung des Begriffs in verschiedenen Kontexten und untersucht dessen semantische Entwicklung.
Wie wird Sakîna mit Schekhina verglichen?
Ein wichtiger Aspekt der Arbeit ist der Vergleich von Sakîna mit dem jüdischen Begriff Schekhina, insbesondere im Hinblick auf die Bedeutung der göttlichen Gegenwart und Macht. Die Parallelen und Unterschiede in der Verwendung und Interpretation beider Begriffe werden diskutiert.
Welche Rolle spielen Ignaz Goldziher und Clemens Thoma?
Ignaz Goldziher und Clemens Thoma werden als wichtige Referenzautoren genannt, deren Argumentationen und Interpretationen zum Begriff Sakîna in die Analyse einbezogen werden. Insbesondere Goldzihers These, dass Mohammed den Begriff "flüchtig aufgerafft" habe, wird diskutiert.
Welche Schlüsselverse des Korans werden analysiert?
Die Arbeit analysiert unter anderem Koranvers 2:248, der Sakîna mit der Bundeslade und der Anwesenheit Gottes verbindet, sowie Vers 9:25f, der Sakîna als Aspekt göttlicher Macht beschreibt.
Wie wird die Schekhina dargestellt?
Die Schekhina wird als "Einwohnung" oder "Gegenwärtigkeit Gottes" erläutert und ihre Darstellung als weibliche Gottheit ("Braut Gottes") und ihre Rolle als Vermittlerin zwischen Gott und seinem Volk Israel wird diskutiert, mit Bezug auf Exodus 3:16.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit zeigt die Vielschichtigkeit des Begriffs Sakîna auf und verdeutlicht den kulturellen und religiösen Austausch zwischen Judentum und Islam. Sie betont die Bedeutung von Sakîna als Brücke zwischen beiden Religionen und als Projektionsfläche für religiöse und kulturelle Vorstellungen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die relevanten Schlüsselwörter sind: Sakîna, Schekhina, Koran, Hadithe, Ignaz Goldziher, Clemens Thoma, göttliche Gegenwart, Seelenruhe, Judentum, Islam, interreligiöser Vergleich, kultureller Austausch, religiöse Symbolik.
Welche Kapitel beinhaltet die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu Sakina im Koran, ein Kapitel zur Schekhina und eine abschließende Betrachtung. Innerhalb der Kapitel werden spezifische Aspekte der Begriffe detailliert untersucht.
- Quote paper
- Felix Jeschonnek (Author), 2018, Gottes "Einwohnung" im Islam. Eine kurze Begriffsgeschichte der Sakȋna, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/509010