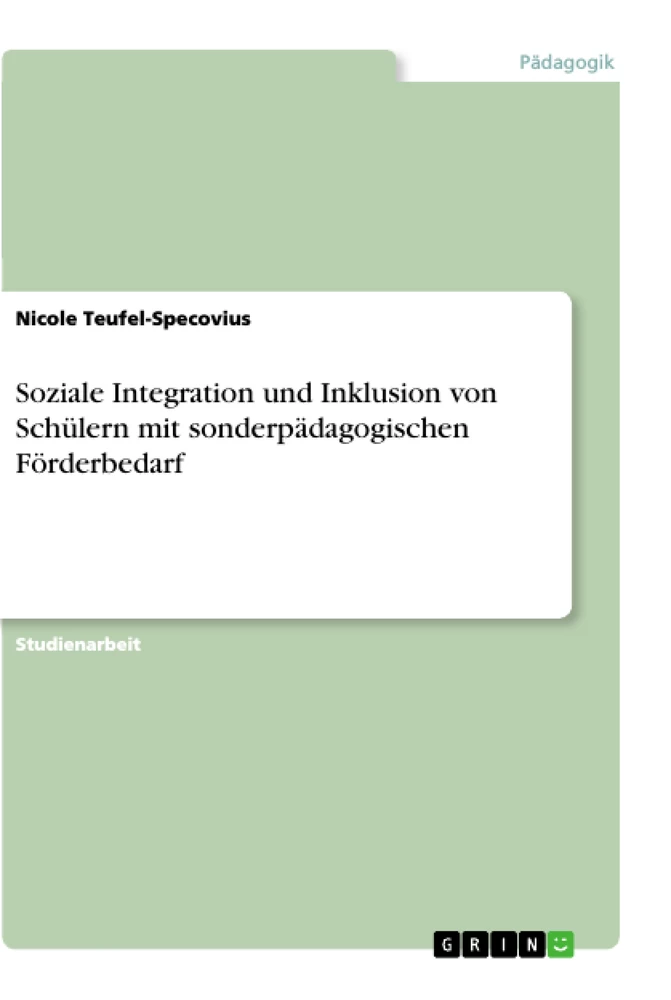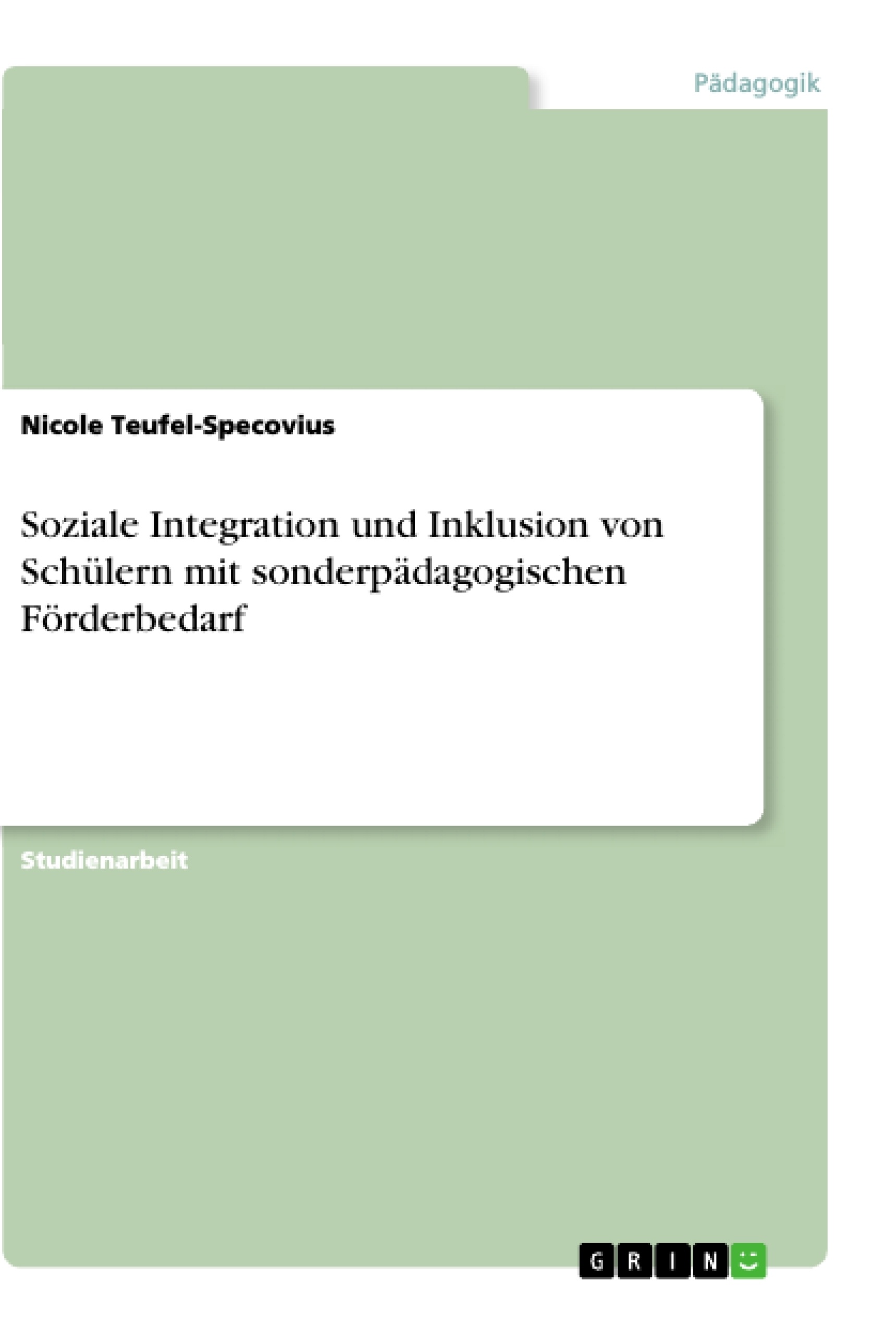Die Arbeit beschäftigt sich mit der sozialen Integration von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf (SFB) an einer Gemeinschaftsschule. Ziel der Arbeit ist es, anhand unterschiedlicher Forschungsmethoden eine Standortbestimmung der sozialen Integration von Schülern mit SFB im gemeinsamen Unterricht der Gemeinschaftsschule zu erforschen, die Ergebnisse auszuwerten und gegebenenfalls neue Wege und Anregungen für eine gelungene soziale Integration zu finden.
Die Arbeit wird in einen Theorie- und Untersuchungsteil gegliedert. Der Theorieteil umfasst die Hinführung zum Thema, Aufbau und Ziele der Arbeit sowie eine Begriffserklärung. Des Weiteren wird die Entwicklung von der "Hilfsschule" zum Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum im historischen Kontext beschrieben. Außerdem werden die Theorien sozialer Vergleichsprozesse, nationale und internationale Studien und Forschungen zum Thema Soziale Integration vorgestellt und deren Aussagen zum Thema schulische Integration dargestellt.
Aus den dargestellten Forschungsergebnissen wird eine Hypothese gestellt und folgende Fragestellung zu den Inhalten der Untersuchung an der Gemeinschaftsschule abgeleitet: "Beeinflusst die heterogene Schülerschaft der Gemeinschaftsschule die soziale Integration von Schüler mit SFB?" Vor Beginn des Untersuchungsteils wird die Gemeinschaftsschule vorgestellt. Im ersten Teil der Untersuchungen wird die Fragestellung kurz erläutert und die Forschungsinstrumente werden vorgestellt. Dem folgt die Darstellung der Umsetzung und Durchführung der Forschung. Im weiteren Verlauf werden die Ergebnisse der Untersuchung aufgezeigt und analysiert.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- 1.1 Ziele der Wissenschaftlichen Hausarbeit
- 1.2 Aufbau der Wissenschaftlichen Hausarbeit
- 1.3 Hypothesenbildung und Fragestellung der Untersuchung
- II. Theoretische Grundlagen
- 2. Begriffsbestimmung
- 3. Aufbau des Sonderschulwesens von der Hilfsschule zum SBBZ
- 3.1 Anfänge des Sonderschulwesens im 19. Jahrhundert, Gründung von Hilfsschulen
- 3.2 Die Rolle der Hilfsschulen zur Zeit des Nationalsozialismus
- 3.3 Die Bildungspolitische Wende
- 3.4 Die Inklusionsdebatte
- 3.5 Gründungen von Gemeinschaftsschulen
- 4. Soziale Integration in der Schule
- 4.1 Theorien sozialer Vergleichsprozesse
- 4.2 Soziale Integration im Kontext Schulforschung
- 4.3 Integrationsrelevante Persönlichkeitsmerkmale
- 4.4 Einfluss von Klassengröße, Heterogenität, unterrichtbezogene Faktoren und Lehrerpersönlichkeit
- 4.5 Anspruch auf inklusives Bildungsangebot
- 4.5.1 Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit
- III. Empirischer Teil
- 5. Vorstellung der Gemeinschaftsschule
- 6. Darstellung der Methode
- 6.1 Klassen-Kompass
- 6.2 Das problemzentrierte Interview nach Witzel
- 6.3 Transkription nach Dresing und Pehl
- 6.4 Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring
- 7. Ablauf der Untersuchung
- 7.1 Vorstellung der Stichproben
- 7.2 Klassen-Kompass Vorbereitung
- 7.3 Klassen-Kompass Durchführung
- 7.4 Interviewvorbereitungen
- 7.4.1 Darstellung der Leitfragen Schüler
- 7.4.2 Darstellung der Leitfragen Regelschulkraft
- 7.4.3 Darstellung der Leitfragen Fachlehrerin G
- 7.5 Interviewdurchführung
- 8. Ergebnisdarstellung
- 8.1 Ergebnisse des Klassen-Kompass
- 8.1.1 Ergebnisdarstellung Klasse 8b
- 8.1.2 Ergebnisdarstellung Klasse 7c
- 8.1.3 Ergebnisdarstellung Klasse 7a
- 8.1.4 Ergebnisdarstellung Klasse 5a
- 8.2 Zusammenfassungen der Interviews
- 8.2.1 Interview Schülerin Klasse 8
- 8.2.2 Interview Schüler Klasse 7
- 8.2.3 Interview Regelschulkraft
- 8.2.4 Interview Sonderpädagogin
- 8.3 Vorstellung des Kategoriensystems
- 8.4 Kategorienbasierte Darstellung der Ergebnisse
- 8.4.1 Kategorie 1. Personenkreis Interviewpartner
- 8.4.2 Kategorie 2. Fragestellung 1. soziale Integration
- 8.4.3 Kategorie 3. Heterogenität
- 8.4.4 Kategorie 4. Möglichkeiten Lehrkräfte oder weitere Aussagen aus dem Interviewmaterial zur Förderung der sozialen Integration
- 9. Interpretation der Ergebnisse
- 9.1 Interpretation des Klassen-Kompass
- 9.2 Interpretation der Interviews
- IV. Reflexion des methodischen Vorgehens
- V. Schlussfolgerungen
- Soziale Integration von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf Lernen
- Der Einfluss der Schulform (Gemeinschaftsschule) auf die soziale Integration
- Die Rolle von Lehrkräften und unterstützenden Maßnahmen bei der sozialen Integration
- Analyse sozialer Vergleichsprozesse in inklusiven Klassen
- Entwicklung des Sonderschulwesens und der Inklusionsdebatte
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese wissenschaftliche Hausarbeit untersucht die soziale Integration von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf Lernen in der Sekundarstufe einer Gemeinschaftsschule. Das Hauptziel besteht darin, mittels verschiedener Forschungsmethoden (Klassen-Kompass und problemzentrierte Interviews) den Stand der sozialen Integration zu ermitteln und gegebenenfalls Verbesserungsvorschläge zu formulieren.
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Arbeit untersucht die soziale Integration von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf Lernen in einer Gemeinschaftsschule, wobei der Fokus auf die soziale Integration im Kontext der Inklusionsdebatte liegt. Die Einleitung verdeutlicht die Bedeutung sozialer Zugehörigkeit und führt in die Forschungsfrage und die Hypothesen ein.
II. Theoretische Grundlagen: Dieser Teil definiert zentrale Begriffe wie Integration und Inklusion und differenziert sie voneinander. Es wird ein historischer Überblick über die Entwicklung des Sonderschulwesens gegeben, von den Hilfsschulen bis zu den heutigen SBBZ. Die Theorie sozialer Vergleichsprozesse wird vorgestellt und verschiedene Studien zur sozialen Integration im Kontext der Schulforschung werden analysiert, um die Grundlage für die Fragestellungen zu schaffen.
III. Empirischer Teil: Dieser Teil beschreibt die Methodik der Untersuchung, die an der M. Gemeinschaftsschule durchgeführt wurde. Es wird der Klassen-Kompass als soziometrisches Instrument vorgestellt, sowie problemzentrierte Interviews mit Schülern, einer Regelschullehrerin und der Sonderpädagogin. Die Stichproben und der Ablauf der Untersuchung werden detailliert beschrieben.
IV. Reflexion des methodischen Vorgehens: Dieser Abschnitt reflektiert die Stärken und Schwächen der gewählten Methoden und deren Anwendbarkeit im Kontext der Fragestellung. Die Grenzen der Stichprobengröße werden angesprochen.
Schlüsselwörter
Soziale Integration, Inklusion, Gemeinschaftsschule, sonderpädagogischer Förderbedarf Lernen, soziale Vergleichsprozesse, Klassen-Kompass, problemzentriertes Interview, qualitative Inhaltsanalyse, Heterogenität, Inklusionsdebatte, Hilfsschule, SBBZ.
Häufig gestellte Fragen zur wissenschaftlichen Hausarbeit: Soziale Integration von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf Lernen in einer Gemeinschaftsschule
Was ist das Thema der wissenschaftlichen Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die soziale Integration von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf Lernen in der Sekundarstufe einer Gemeinschaftsschule. Im Mittelpunkt steht die Ermittlung des Integrationsstands und die Formulierung möglicher Verbesserungsvorschläge.
Welche Methoden wurden verwendet?
Die Studie verwendet den Klassen-Kompass als soziometrisches Instrument und problemzentrierte Interviews mit Schülern, einer Regelschullehrerin und der Sonderpädagogin. Die Ergebnisse werden mittels qualitativer Inhaltsanalyse nach Mayring ausgewertet.
Welche Forschungsfragen werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit der sozialen Integration von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf, dem Einfluss der Schulform (Gemeinschaftsschule) darauf, der Rolle von Lehrkräften und unterstützenden Maßnahmen, der Analyse sozialer Vergleichsprozesse in inklusiven Klassen und der Entwicklung des Sonderschulwesens und der Inklusionsdebatte.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen theoretischen Teil, einen empirischen Teil, eine Reflexion des methodischen Vorgehens und einen Schlussfolgerungsteil. Der theoretische Teil umfasst die Begriffsbestimmung, die historische Entwicklung des Sonderschulwesens und Theorien sozialer Vergleichsprozesse. Der empirische Teil beschreibt die Methodik, den Ablauf der Untersuchung, die Ergebnisse und deren Interpretation.
Welche Stichproben wurden untersucht?
Die Untersuchung wurde an einer Gemeinschaftsschule durchgeführt. Die Stichprobe umfasst Schüler verschiedener Klassenstufen (5a, 7a, 7c, 8b), eine Regelschullehrerin, die Fachlehrerin G und die Sonderpädagogin. Die genauen Stichprobengrößen werden im Detail im empirischen Teil erläutert.
Welche Ergebnisse wurden erzielt?
Die Ergebnisse werden im empirischen Teil detailliert dargestellt und umfassen sowohl die Auswertung des Klassen-Kompass (für verschiedene Klassen) als auch die Auswertung der problemzentrierten Interviews. Die Ergebnisse werden kategorisiert und interpretiert, um Schlussfolgerungen hinsichtlich der sozialen Integration zu ziehen.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Schlussfolgerungen basieren auf der Interpretation der Ergebnisse des Klassen-Kompass und der Interviews. Die Arbeit diskutiert Stärken und Schwächen der verwendeten Methoden und liefert gegebenenfalls Verbesserungsvorschläge zur Förderung der sozialen Integration von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf Lernen in Gemeinschaftsschulen.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Soziale Integration, Inklusion, Gemeinschaftsschule, sonderpädagogischer Förderbedarf Lernen, soziale Vergleichsprozesse, Klassen-Kompass, problemzentriertes Interview, qualitative Inhaltsanalyse, Heterogenität, Inklusionsdebatte, Hilfsschule, SBBZ.
Welche historischen Aspekte werden beleuchtet?
Die Arbeit beleuchtet die historische Entwicklung des Sonderschulwesens vom 19. Jahrhundert bis zur heutigen Inklusionsdebatte, beginnend mit den Hilfsschulen über die Zeit des Nationalsozialismus bis hin zur Gründung von Gemeinschaftsschulen und SBBZ (Schulen mit dem Förderschwerpunkt).
- Quote paper
- Nicole Teufel-Specovius (Author), 2018, Soziale Integration und Inklusion von Schülern mit sonderpädagogischen Förderbedarf, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/509346