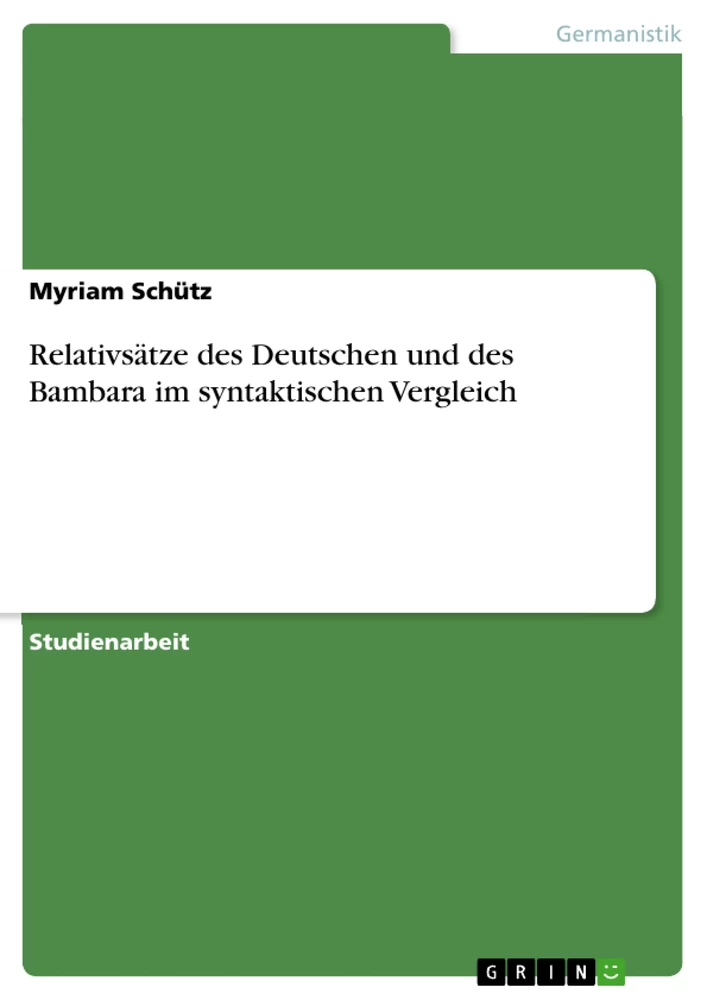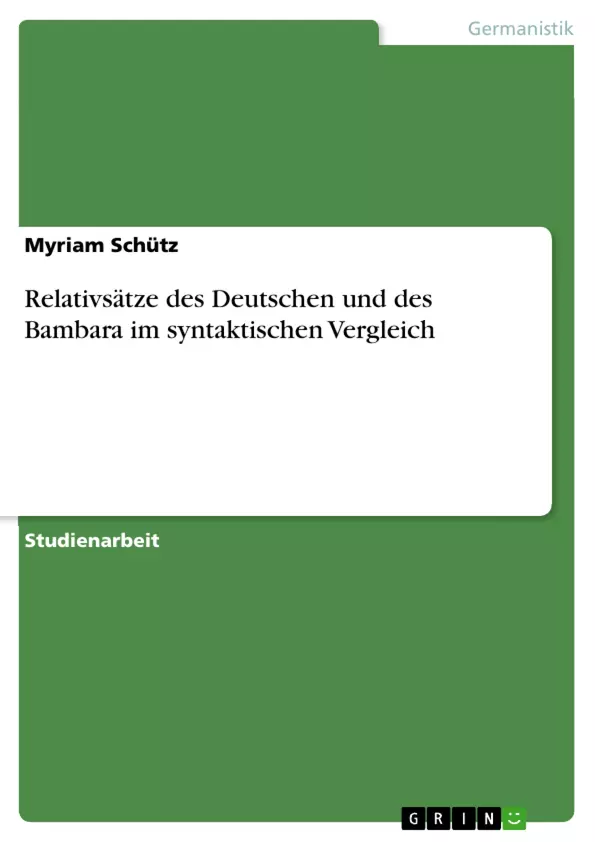In dieser Arbeit werden zwei grundsätzlich verschiedene Sprachen mit komplett unterschiedlichen Bildungsweisen von Relativsätzen gegenübergestellt und miteinander verglichen. Auf der einen Seite wird das Deutsche genauer betrachtet, welches mit rund 76 Millionen Muttersprachlern und zusätzlich circa 132 Millionen Zweit- und Fremdsprachlern weltweit zu den am weitesten verbreiteten Sprachen der Welt gehört. Dem gegenüber wird das Bambara gestellt, das zusammen mit Dioula und Manlinke das Dialektkontinuum des Manding bildet und als Mande-Sprache von nur rund 4 Millionen Muttersprachlern und circa 10 Millionen Zweitsprachlern gesprochen wird.
Nach Lindsay Whaley und Thomas Payne können Relativsätze verschiedenster Sprachen anhand von drei Parametern typologischer Variation miteinander verglichen werden: Ihrer Position zum Kopfnomen; der Art, wie das R-Element im Relativsatz repräsentiert wird und anhand der syntaktischen Funktionen, die durch einen Relativsatz modifiziert werden können. Im Folgenden wird zunächst geklärt, was Relativsätze genau sind und auf welche Besonderheiten die Relativsätze im Deutschen und im Bambara in dieser Arbeit untersucht werden. Danach werden die Relativsätze der beiden Sprachen auf die drei genannten Parameter hin analysiert und schließlich gegenübergestellt. Abschließend werden die Ergebnisse der Betrachtung vergleichend dargestellt.
Nach Anke Holler ist der Relativsatz ein Kernphänomen der Grammatik und somit auch ein fester Bestandteil linguistischer Forschung. Seine Grammatik gehört zu den am besten erforschten Gebieten der Syntax. Gerade deshalb ist es überraschend, dass es laut Holler keine einheitliche, übergreifende, allgemein akzeptierte Definition für dieses linguistische Phänomen gibt. Die Gründe hierfür sieht Holler in den vielen verschiedenen Eigenschaften und Bildungsweisen der Relativsätze und den damit verbundenen Abgrenzungsproblemen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Relativsätze im Deutschen und im Bambara
- 2.1 Restriktive Relativsätze
- 2.2 Appositive Relativsätze
- 3. Position zum Kopfnomen
- 3.1 Deutsch
- 3.2 Bambara
- 4. Art der Repräsentation des R-Elements
- 4.1 Deutsch
- 4.2 Bambara
- 5. Syntaktische Funktionen, die modifiziert werden können
- 5.1 Deutsch:
- 5.2 Bambara:
- 6. Schlusswort.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Bildungsweisen von Relativsätzen im Deutschen und im Bambara, zwei Sprachen mit grundlegend verschiedenen grammatikalischen Strukturen. Das Ziel ist es, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Bildung und Funktion von Relativsätzen in beiden Sprachen herauszuarbeiten und zu analysieren.
- Die Position des Relativsatzes zum Kopfnomen
- Die Art der Repräsentation des R-Elements im Relativsatz
- Die syntaktischen Funktionen, die durch einen Relativsatz modifiziert werden können
- Die Unterscheidung zwischen restriktiven und appositiven Relativsätzen
- Die typologischen Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den beiden Sprachen hinsichtlich der Relativsatzbildung
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Einleitung Diese Einleitung stellt die Bedeutung von Relativsätzen in der Linguistik dar und führt die beiden untersuchten Sprachen, Deutsch und Bambara, vor. Sie erläutert die typologischen Parameter, die zur Analyse der Relativsätze in beiden Sprachen verwendet werden.
Kapitel 2: Relativsätze im Deutschen und im Bambara Dieses Kapitel definiert den Begriff "Relativsatz" und erläutert die Unterschiede zwischen angeschlossenen und eingebetteten Relativsätzen. Es führt die Besonderheiten der Relativsatzbildung im Deutschen und im Bambara ein.
Kapitel 3: Position zum Kopfnomen Dieses Kapitel untersucht die Position des Relativsatzes im Verhältnis zum Kopfnomen im Deutschen und im Bambara, um die Unterschiede in der Satzstruktur und Wortreihenfolge aufzuzeigen.
Kapitel 4: Art der Repräsentation des R-Elements Dieses Kapitel analysiert, wie das R-Element im Relativsatz in beiden Sprachen repräsentiert wird, einschließlich der Verwendung von Lücken und der direkten Einbeziehung des Kopfnomens im Relativsatz.
Kapitel 5: Syntaktische Funktionen, die modifiziert werden können Dieses Kapitel untersucht die unterschiedlichen syntaktischen Funktionen, die durch Relativsätze in den beiden Sprachen modifiziert werden können, um die verschiedenen Möglichkeiten der Satzbildung zu beleuchten.
Schlüsselwörter
Relativsatz, Deutsch, Bambara, Typologie, Position, R-Element, Repräsentation, syntaktische Funktion, Restriktivität, Apposition, Vergleich, Grammatik, Linguistik, Sprachvergleich.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Hauptunterschied zwischen Deutsch und Bambara bei Relativsätzen?
Deutsch und Bambara nutzen grundlegend verschiedene Bildungsweisen, die sich in der Position zum Kopfnomen und der Repräsentation des R-Elements unterscheiden.
Was ist Bambara für eine Sprache?
Bambara ist eine Mande-Sprache, die in Westafrika von ca. 14 Millionen Menschen (Muttersprachler und Zweitsprachler) gesprochen wird.
Nach welchen Parametern werden die Sprachen verglichen?
Der Vergleich erfolgt anhand der Position zum Kopfnomen, der Art der Repräsentation des R-Elements und der modifizierbaren syntaktischen Funktionen.
Was ist der Unterschied zwischen restriktiven und appositiven Relativsätzen?
Restriktive Relativsätze grenzen die Menge der Bezugsobjekte ein, während appositive Sätze zusätzliche, nicht-identifizierende Informationen liefern.
Gibt es eine einheitliche Definition für Relativsätze?
Nein, in der Linguistik gibt es aufgrund der Vielfalt an Eigenschaften und Bildungsweisen weltweit keine allgemein akzeptierte Definition.
- Quote paper
- Myriam Schütz (Author), 2018, Relativsätze des Deutschen und des Bambara im syntaktischen Vergleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/509464