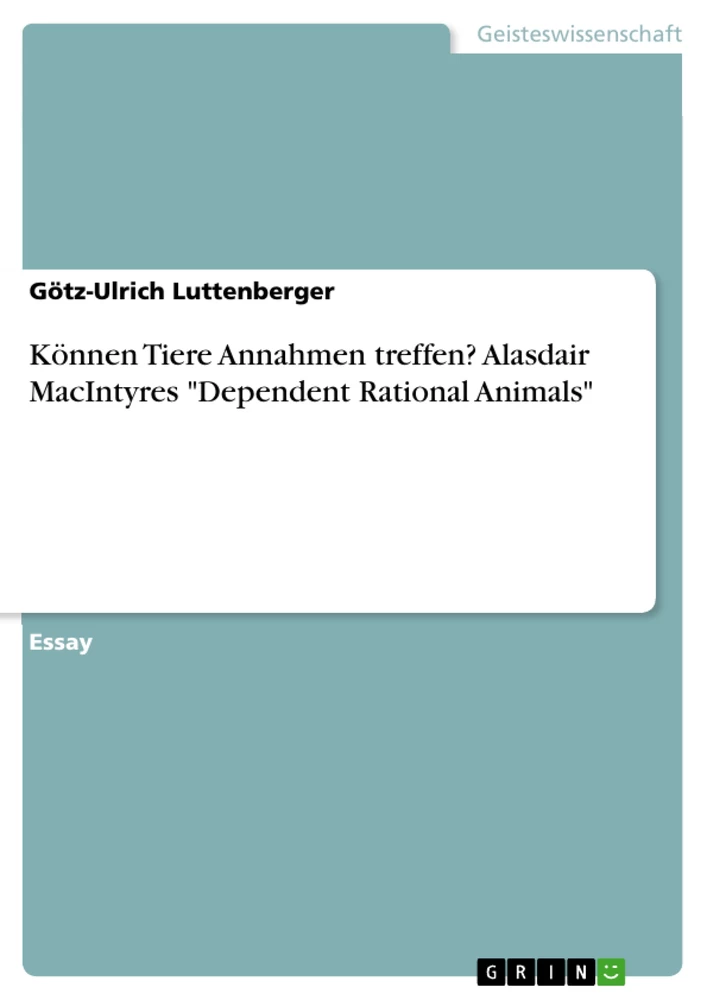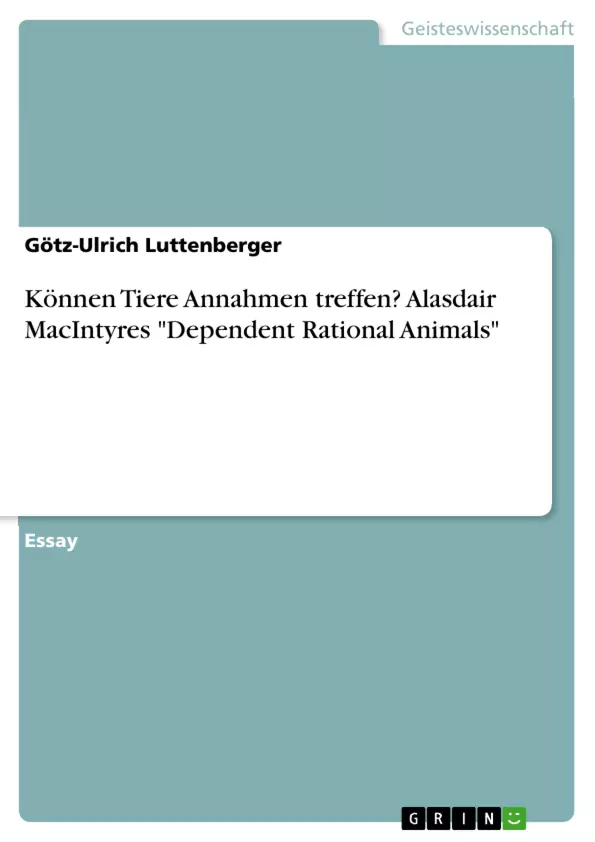Die Arbeit setzt sich aus philosophischer Sicht mit der Frage auseinander, ob Tiere Annahmen treffen können. Das wird im Rahmen von Alasdair MacIntyres Dependent Rational Animals diskutiert. MacIntyre distanziert sich in dieser Schrift bewusst von seinem früheren Werk After Virtue. MacIntyre verwirft in Dependent Rational Animals daher seine frühere aristotelische Vorstellung, wonach es ein typisch menschliches telos gibt, das der Mensch erkennen und das er anstreben soll. Stattdessen sieht MacIntyre den Menschen nun als ein komplexes Wesen, dessen Vorstellungen vom Guten, von Normen oder von den Tugenden wir niemals richtig erklären können, ohne unsere biologische Konstitution mit in Erwägung zu ziehen.
Vor diesem Hintergrund fragt der Autor, ob Tiere Annahmen treffen können. Nur wenn das der Fall ist, kann man in den biologischen Wurzeln des Menschen - so wie MacIntyre meint - eine Rechtfertigung für ethisches, menschliches Handeln finden. Ausgehend von neueren naturwissenschaftlichen Experimenten erläutert Luttenberger ausführlich, in wie weit die Fähigkeit Annahmen treffen zu können die Fähigkeit zu sprechen, Vorstellungen von wahr und falsch und eine Theory of Mind voraussetzt.
Im Ergebnis verteidigt der Autor die These MacIntyres, wonach Tiere tatsächlich Annahmen treffen können. Allerdings sieht Luttenberger im Gegensatz zu MacIntyre die Relevanz für die Ethik nicht in der gegenseitigen Abhängigkeit und Verletzlichkeit menschlicher Wesen. Vielmehr ist für ihn die Fähigkeit Annahmen treffen zu können Voraussetzung für empathisches Verhalten. Erst das ererbte Sich-in-einen-anderen-hineinversetzen-können, wie es bei manchen unserer biologischen Vorfahren in Theory of Mind Experimenten nachgewiesen wurde, befähigt uns zu ethischem Verhalten.
Inhaltsverzeichnis
- Können Tiere Annahmen treffen? – Entwicklung der Diskussion
- Dependent Rational Animals im Kontext.
- Dependent Rational Animals – die Korrektur von After Virtue?
- Die Argumentationskette in Dependent Rational Animals .
- Das Problem des Anthropomorphismus
- Was sind Annahmen?
- Kann Annahmen nur treffen, wer Sprache hat?
- Können Tiere zwischen wahr und falsch unterscheiden?
- Haben Tiere eine Theory of Mind (ToM)?
- Ist die Fähigkeit, Annahmen treffen zu können, für die Ethik relevant?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Frage, ob Tiere Annahmen treffen können. Der Fokus liegt dabei auf dem Werk „Dependent Rational Animals“ von Alasdair MacIntyre, das die traditionelle Trennung zwischen Mensch und Tier in Frage stellt. Im Kontext der modernen Debatte über Tierkognition und Ethik werden die Argumente MacIntyres analysiert und in Bezug zu den Ansichten prominenter Philosophen gesetzt. Der Text beleuchtet die Entwicklung des Denkens über Tierkognition und hinterfragt die Rolle von Sprache, Vernunft und einer „Theory of Mind“ in der Fähigkeit, Annahmen zu treffen.
- Die Entwicklung des Denkens über Tierkognition in der Philosophie
- Die Kritik an der anthropozentrischen Perspektive auf Moral und Vernunft
- Die Rolle von Sprache und Vernunft in der Fähigkeit, Annahmen zu treffen
- Die Bedeutung der „Theory of Mind“ für die Tierkognition
- Die ethische Relevanz der Fähigkeit, Annahmen zu treffen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung der Diskussion um die Frage, ob Tiere Annahmen treffen können. Von der antiken Philosophie bis zur Neuzeit werden unterschiedliche Standpunkte und Argumente präsentiert, die die Komplexität des Themas verdeutlichen.
Im zweiten Kapitel wird der Kontext von MacIntyres Werk „Dependent Rational Animals“ beleuchtet. Der Autor kritisiert die anthropozentrische Perspektive auf Moral und Vernunft, die in seiner vorherigen Arbeit „After Virtue“ noch vertreten wurde. Im Kontext von Dependent Rational Animals wird die Frage der Tierkognition neu gestellt, indem er den Menschen als ein „abhängiges rationales Tier“ sieht, das in komplexen sozialen und biologischen Zusammenhängen eingebettet ist.
Das dritte Kapitel befasst sich mit dem Problem des Anthropomorphismus, also der Zuschreibung menschlicher Eigenschaften an Tiere. Es werden verschiedene Perspektiven auf die Frage diskutiert, ob und inwieweit es gerechtfertigt ist, Tieren menschliche Qualitäten zuzuschreiben.
Das vierte Kapitel analysiert den Begriff der „Annahme“ selbst. Es werden Fragen nach der Rolle von Sprache, der Fähigkeit, zwischen wahr und falsch zu unterscheiden, und der „Theory of Mind“ in der Fähigkeit, Annahmen zu treffen, diskutiert. Das Kapitel stellt heraus, dass die Fähigkeit, Annahmen zu treffen, nicht nur auf Sprache oder Vernunft, sondern auch auf komplexere kognitive Prozesse basiert.
Das fünfte Kapitel untersucht die ethische Relevanz der Fähigkeit, Annahmen zu treffen. Die Frage, ob Tiere Annahmen treffen können, hat weitreichende Konsequenzen für die Art und Weise, wie wir Tiere behandeln und wie wir ethische Entscheidungen treffen.
Schlüsselwörter
Tierkognition, Annahmen, Dependent Rational Animals, Alasdair MacIntyre, Anthropomorphismus, Sprache, Vernunft, Theory of Mind, Ethik, Tierwohl.
Häufig gestellte Fragen
Können Tiere Annahmen treffen?
Die Arbeit verteidigt die These von Alasdair MacIntyre, dass Tiere tatsächlich die Fähigkeit besitzen, Annahmen über ihre Umwelt zu treffen.
Was ist das Hauptargument in MacIntyres "Dependent Rational Animals"?
MacIntyre sieht den Menschen als "abhängiges rationales Tier" und betont, dass unsere Ethik ohne Berücksichtigung unserer biologischen Wurzeln nicht erklärbar ist.
Setzt das Treffen von Annahmen Sprache voraus?
Der Autor diskutiert, ob kognitive Prozesse wie eine "Theory of Mind" auch ohne menschliche Sprache existieren können.
Was bedeutet "Theory of Mind" (ToM) bei Tieren?
Die Fähigkeit, sich in die mentalen Zustände (Absichten, Wissen) eines anderen Lebeswesens hineinzuversetzen.
Welche Relevanz hat die Tierkognition für die Ethik?
Wenn Tiere Annahmen treffen können, ist dies eine Voraussetzung für empathisches Verhalten, was wiederum die Grundlage für ethisches Handeln bildet.
- Quote paper
- Götz-Ulrich Luttenberger (Author), 2019, Können Tiere Annahmen treffen? Alasdair MacIntyres "Dependent Rational Animals", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/509868