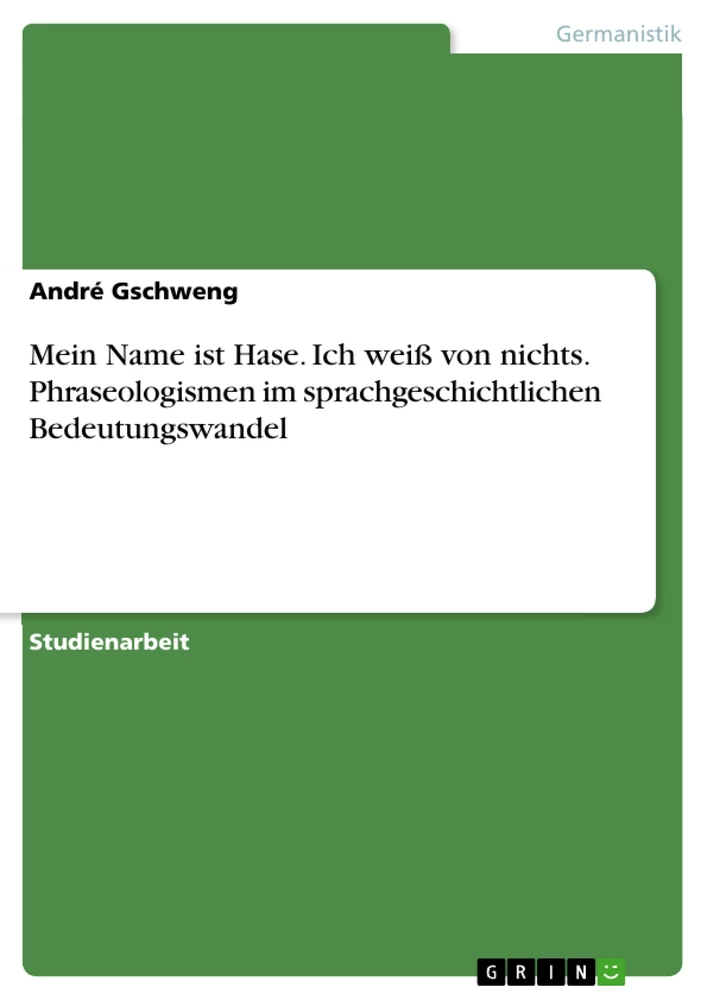Die vorliegende Hausarbeit soll einen kurzen historischen Einblick in die Entstehung und Bildung von Phrasemen bieten und dabei an verschiedenen Beispielen zeigen, welche Veränderungen im Laufe der Zeit geschehen sind und warum wir den Ursprung von bestimmten Redewendungen schlicht vergessen haben. Grundlage zur Erarbeitung der vorliegenden Ausführungen ist die Einführung in die Phraseologie von Harald Burger, 2015. Der Sprachwissenschaftler beschäftigt sich mit der Thematik bereits seit einem halben Jahrhundert und hat seine Erkenntnisse in mehreren Werken publiziert.
Diese Arbeit soll im ersten Teil die theoretischen Grundlagen liefern, die zum besseren Verständnis der verwendeten Begrifflichkeiten beitragen soll. Dabei werden zunächst die Eigenschaften von phraseologischen Wortverbindungen genauer untersucht und mit Beispielen belegt. Das darauffolgende Kapitel soll zeigen, welche Faktoren notwendig sein müssen, damit ein Phrasem zu einem solchen wird. Anschließend werden die theoretischen Grundlagen zusammengefasst und die Entstehung von Phrasemen an den beiden Beispielen Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts und der rote Faden näher erläutert.
Der zweite Teil der Hausarbeit beschäftigt sich mit dem Bedeutungswandel von Phraseologismen und wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass ein semantischer Wandel stattgefunden hat. Dabei soll vor allem Bezug genommen werden auf die verschiedenen Möglichkeiten, wie sich Phraseme verändert haben, ob sie an Bedeutung verloren oder gewonnen haben und was sich syntaktisch im Laufe der Jahrhunderte getan hat. An dieser Stelle sei jedoch schon die These erwähnt, die Burger bereits seit Beginn seiner Untersuchungen begleitet: Die Fixierung phraseologischer Wortverbindungen ist in hohem Maß der schriftsprachlichen Kodifizierung zu verdanken. Er hat diese Behauptung bereits 1986 aufgestellt, doch ist sie bis heute nicht bewiesen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Eigenschaften von phraseologischen Wortverbindungen
- Was macht ein Phrasem zu einem Phrasem?
- Bedeutungswandel von Phraseologismen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Entstehung und den Bedeutungswandel von Phraseologismen. Sie beleuchtet die linguistischen Merkmale von Phrasemen und analysiert Faktoren, die zu ihrer Bildung beitragen. Ein Schwerpunkt liegt auf der Erforschung des semantischen Wandels von Phraseologismen im Laufe der Zeit.
- Linguistische Eigenschaften von Phraseologismen
- Entstehungsprozesse von Phrasemen
- Faktoren des Bedeutungswandels bei Phraseologismen
- Der Einfluss schriftlicher Kodifizierung auf die Fixierung von Phrasemen
- Beispiele für Bedeutungswandel an ausgewählten Phrasemen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Hausarbeit ein und beschreibt die Zielsetzung, die auf einem kurzen historischen Einblick in die Entstehung und Bildung von Phrasemen basiert. Sie benennt Harald Burgers Einführung in die Phraseologie als Grundlage der Arbeit und skizziert den Aufbau der Arbeit in einen theoretischen und einen empirischen Teil, der sich mit dem Bedeutungswandel von Phraseologismen auseinandersetzt. Die These Burgers, dass die Fixierung phraseologischer Wortverbindungen stark von der schriftlichen Kodifizierung abhängt, wird als Leitfaden für die weitere Analyse genannt.
Eigenschaften von phraseologischen Wortverbindungen: Dieses Kapitel behandelt die linguistischen Merkmale von Phrasemen. Es werden Basisklassifikationen wie Polylexikalität und verschiedene Festigkeitsgrade (psycholinguistische, strukturelle, relative und pragmatische Festigkeit) erläutert. Ein zentraler Aspekt ist die Idiomatizität, die die Diskrepanz zwischen wörtlicher und phraseologischer Bedeutung beschreibt und als graduelles, diachrones Phänomen dargestellt wird. Zusätzliche Merkmale wie Bildlichkeit, Bildhaftigkeit, Lexikalität, Expressivität und Unschärfe werden erwähnt, jedoch nicht detailliert untersucht.
Was macht ein Phrasem zu einem Phrasem?: Dieses Kapitel befasst sich mit der Entstehung von Phrasemen. Harald Burger wird zitiert, der Phraseme als universal-sprachliche Phänomene beschreibt, die auf Lexik und Syntax basieren und ständig neu gebildet werden können. Der Unterschied zwischen neu geschaffenen und älteren Phrasemen mit belegbarem Ursprung wird herausgestellt. Es werden zwei Entstehungsprozesse beschrieben: Zum einen empirisch universale kognitive Bedingungen, die zur Bildung von Somatismen führen, zum anderen die Übertragbarkeit und Verschiebung durch Metaphorisierung und Metonymisierung, die konkreten historischen und kulturellen Bedingungen unterliegen. Das Beispiel des „Schilds“ wird als Illustration für die Entwicklung metonymischer Phraseme genannt.
Schlüsselwörter
Phraseologismen, Phraseme, Redewendungen, Idiome, Bedeutungswandel, Semantik, Linguistik, Phraseologie, Polylexikalität, Idiomatizität, Festigkeit, Schriftliche Kodifizierung, Entstehung, Somatismen, Metapher, Metonym, Historischer Ursprung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Bedeutungswandel von Phraseologismen
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Entstehung und den Bedeutungswandel von Phraseologismen. Sie beleuchtet die linguistischen Merkmale von Phrasemen und analysiert Faktoren, die zu ihrer Bildung beitragen. Ein Schwerpunkt liegt auf der Erforschung des semantischen Wandels von Phraseologismen im Laufe der Zeit.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt linguistische Eigenschaften von Phraseologismen, Entstehungsprozesse von Phrasemen, Faktoren des Bedeutungswandels, den Einfluss schriftlicher Kodifizierung auf die Fixierung von Phrasemen und Beispiele für Bedeutungswandel an ausgewählten Phrasemen. Sie basiert auf Harald Burgers Einführung in die Phraseologie.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit?
Die Hausarbeit besteht aus einer Einleitung, einem Kapitel über die Eigenschaften phraseologischer Wortverbindungen (inkl. einem Unterkapitel „Was macht ein Phrasem zu einem Phrasem?“), einem Kapitel über den Bedeutungswandel von Phraseologismen und einem Fazit.
Wie wird der Bedeutungswandel von Phraseologismen untersucht?
Die Hausarbeit untersucht den Bedeutungswandel anhand von Beispielen und analysiert die Faktoren, die diesen Wandel beeinflussen. Die These Burgers, dass die schriftliche Kodifizierung die Fixierung von Phrasemen stark beeinflusst, dient als Leitfaden.
Welche linguistischen Merkmale von Phrasemen werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet Merkmale wie Polylexikalität, verschiedene Festigkeitsgrade (psycholinguistische, strukturelle, relative und pragmatische Festigkeit), Idiomatizität, Bildlichkeit, Bildhaftigkeit, Lexikalität, Expressivität und Unschärfe. Die Idiomatizität wird als graduelles, diachrones Phänomen dargestellt.
Wie werden die Entstehungsprozesse von Phrasemen erklärt?
Es werden zwei Entstehungsprozesse beschrieben: empirisch universale kognitive Bedingungen, die zur Bildung von Somatismen führen, und die Übertragbarkeit und Verschiebung durch Metaphorisierung und Metonymisierung, die konkreten historischen und kulturellen Bedingungen unterliegen.
Welche Schlüsselwörter sind für die Hausarbeit relevant?
Relevante Schlüsselwörter sind: Phraseologismen, Phraseme, Redewendungen, Idiome, Bedeutungswandel, Semantik, Linguistik, Phraseologie, Polylexikalität, Idiomatizität, Festigkeit, Schriftliche Kodifizierung, Entstehung, Somatismen, Metapher, Metonym, Historischer Ursprung.
Welche Rolle spielt die schriftliche Kodifizierung?
Die schriftliche Kodifizierung wird als wichtiger Faktor für die Fixierung von Phrasemen betrachtet und hat einen Einfluss auf deren Bedeutungswandel.
Gibt es Beispiele für die Entstehung von Phrasemen?
Die Arbeit nennt das Beispiel des „Schilds“ zur Illustration der Entwicklung metonymischer Phraseme.
Was ist die zentrale These der Arbeit?
Die Arbeit untersucht, wie sich Phraseologismen entwickeln und wie ihr Bedeutungswandel durch verschiedene Faktoren, insbesondere die schriftliche Kodifizierung, beeinflusst wird.
- Citar trabajo
- André Gschweng (Autor), 2019, Mein Name ist Hase. Ich weiß von nichts. Phraseologismen im sprachgeschichtlichen Bedeutungswandel, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/510248