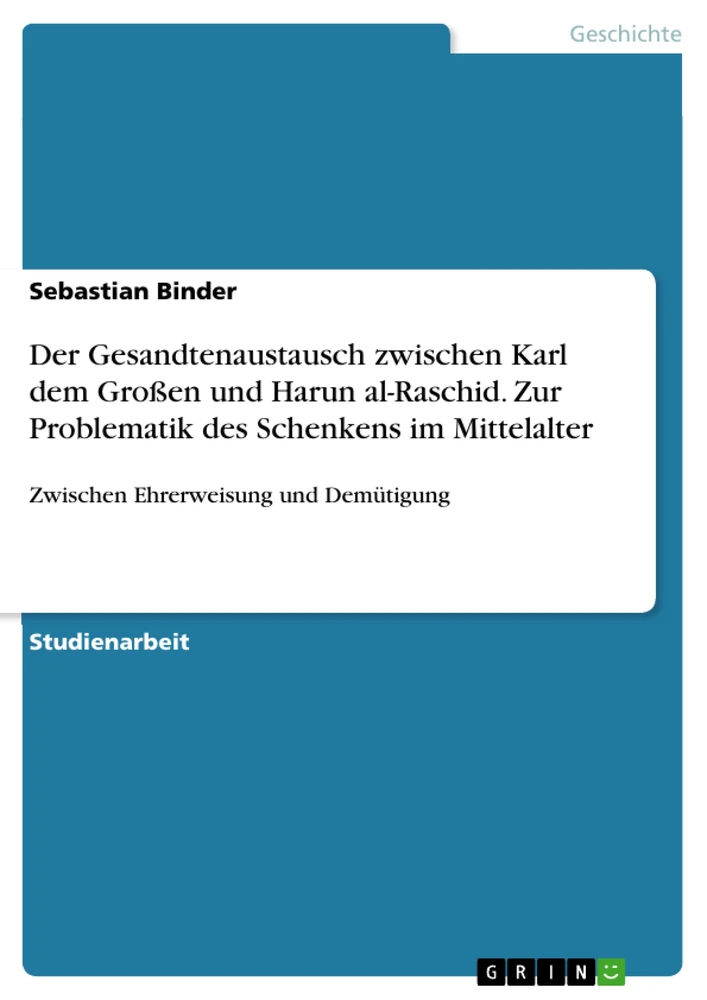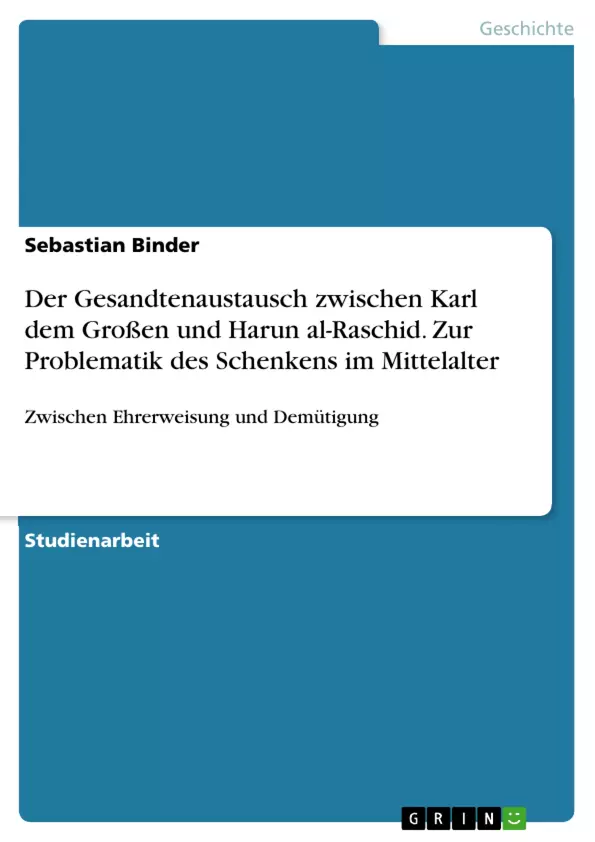Wohl kaum eine Herrscherfigur prägt unsere Vorstellung vom Mittelalter so stark wie Karl der Große. In seiner über 40 Jahre andauernden Herrschaft reformierte der Karolinger das fränkische Bildungswesen, festigte die Bedeutung seines Reiches als Schutzmacht des Papstes und verbreitete den christlichen Glauben in ganz Mitteleuropa. Seinen größten Erfolgen ist aber auch die massive Ausdehnung des fränkischen Herrschaftsgebiets zuzurechnen. Fast jedes Jahr führte Karl der Große Krieg gegen seine Feinde, so etwa gegen die Sachsen im Norden, die Awaren im Osten oder die Langobarden im Süden. Wie viel Anstrengung und Aufopferung diese Unternehmungen Karl und seine Gefolgschaft gekostet haben mussten, zeigt etwa die Eroberung und Christianisierung der Sachsen, die sich dem fränkischen Einfluss partout nicht beugen wollten und immer wieder ins karolingische Reichsgebiet einfielen. Ihre Unterwerfung beschäftigte Karl letzten Endes 32 Jahre.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Zum Gesandten- und Geschenkaustausch zwischen Karl dem Großen und Harun al-Raschid
- 3. Funktion und Problematik der abbasidischen Geschenkgaben
- 4. Zum Umgang mit der Schenkproblematik in den fränkischen Quellen
- 4.1. Darstellung in den Reichsannalen
- 4.2. Darstellung in Einhards vita Karoli
- 4.3. Darstellung in Notkers gesta Karoli
- 5. Abschließendes Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht den Gesandten- und Geschenkaustausch zwischen Karl dem Großen und Harun al-Raschid zwischen 797 und 806. Die Arbeit analysiert die Funktion der abbasidischen Geschenke im Kontext mittelalterlicher Diplomatie und geht der Frage nach, inwiefern diese Geschenke für die karolingische Seite als Demütigung interpretiert werden konnten. Die Analyse fokussiert auf den Umgang mit dieser Problematik in drei wichtigen karolingischen Quellen.
- Der Gesandtenaustausch zwischen Karl dem Großen und Harun al-Raschid als Beispiel interkultureller Beziehungen im frühen Mittelalter.
- Die Funktion und Symbolik von Geschenken in der mittelalterlichen Diplomatie.
- Die Darstellung und Interpretation der abbasidischen Geschenke in den fränkischen Quellen.
- Die rhetorischen Strategien der karolingischen Geschichtsschreibung zur Bewältigung potenzieller Konflikte.
- Die Darstellung der Machtverhältnisse zwischen Frankenreich und Abbasidenkalifat.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein, indem sie die herausragende Bedeutung Karls des Großen im Mittelalter sowie die Ausdehnung seines Reiches und seine Kontakte zu anderen Großmächten wie dem Abbasidenreich hervorhebt. Sie beschreibt den Fokus der Arbeit: die Untersuchung des Gesandten- und Geschenkaustausches zwischen Karl und Harun al-Raschid, die Problematik der abbasidischen Geschenke und den Umgang damit in karolingischen Quellen. Die Einleitung betont die Forschungslücke bezüglich der systematischen Analyse des Umgangs mit den abbasidischen Gaben in den fränkischen Quellen und kündigt die Methode und den Aufbau der Arbeit an. Die bisherigen Forschungsansätze zu Karl und Harun und zum Thema Schenken im Mittelalter werden kurz skizziert.
2. Zum Gesandten- und Geschenkaustausch zwischen Karl dem Großen und Harun al-Raschid: Dieses Kapitel beschreibt detailliert den Verlauf des Gesandtenaustausches und die dabei überbrachten Geschenke beider Seiten. Es analysiert die Gründe Karls für die diplomatischen Beziehungen mit dem Abbasidenreich und legt den Grundstein für die spätere Analyse der abbasidischen Geschenke.
3. Funktion und Problematik der abbasidischen Geschenkgaben: Dieses Kapitel analysiert die Funktion von Geschenken im mittelalterlichen Kontext und untersucht, welche der Geschenke Haruns al-Raschids für die karolingische Seite potentiell problematisch waren und warum. Es wird auf die unterschiedlichen Interpretationen von Geschenken als Zeichen von Ehre oder Demütigung eingegangen. Die Bedeutung der Geschenke im Kontext der Machtverhältnisse zwischen den beiden Reichen wird beleuchtet.
4. Zum Umgang mit der Schenkproblematik in den fränkischen Quellen: Dieses Kapitel analysiert den Umgang der drei wichtigsten karolingischen Quellen (Reichsannalen, Einhards Vita Karoli und Notkers Gesta Karoli) mit der potentiellen Demütigung durch die abbasidischen Geschenke. Es untersucht, welche rhetorischen Mittel und stilistischen Kniffe verwendet wurden, um die Problematik zu entschärfen und die Geschenke als Erfolg für Karl darzustellen. Die unterschiedlichen Perspektiven und Darstellungsweisen in den Quellen werden verglichen und analysiert. Der Fokus liegt auf der Frage, wie die Autoren die Bedeutung der Geschenke im Kontext der Machtverhältnisse darstellen.
Schlüsselwörter
Karl der Große, Harun al-Raschid, Gesandtenaustausch, Geschenkgaben, Abbasidenreich, Frankenreich, Mittelalter, Diplomatie, interkulturelle Beziehungen, karolingische Quellen, Reichsannalen, Vita Karoli, Gesta Karoli, rhetorische Strategien, Machtverhältnisse, Demütigung, Ehrerweisung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Gesandten- und Geschenkaustausch zwischen Karl dem Großen und Harun al-Raschid
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht den Gesandten- und Geschenkaustausch zwischen Karl dem Großen und Harun al-Raschid zwischen 797 und 806. Im Mittelpunkt steht die Analyse der Funktion der abbasidischen Geschenke im Kontext mittelalterlicher Diplomatie und die Frage, inwiefern diese Geschenke für die karolingische Seite als Demütigung interpretiert werden konnten. Die Analyse konzentriert sich auf den Umgang mit dieser Problematik in drei wichtigen karolingischen Quellen: den Reichsannalen, Einhards Vita Karoli und Notkers Gesta Karoli.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet den Gesandtenaustausch als Beispiel interkultureller Beziehungen im frühen Mittelalter, die Funktion und Symbolik von Geschenken in der mittelalterlichen Diplomatie, die Darstellung und Interpretation der abbasidischen Geschenke in den fränkischen Quellen, die rhetorischen Strategien der karolingischen Geschichtsschreibung zur Bewältigung potenzieller Konflikte und die Darstellung der Machtverhältnisse zwischen Frankenreich und Abbasidenkalifat.
Welche Quellen werden analysiert?
Die Hausarbeit analysiert drei wichtige karolingische Quellen: die Reichsannalen, Einhards Vita Karoli und Notkers Gesta Karoli. Der Fokus liegt auf dem Vergleich der unterschiedlichen Perspektiven und Darstellungsweisen dieser Quellen im Umgang mit den abbasidischen Geschenken und der Frage, wie die Autoren die Bedeutung der Geschenke im Kontext der Machtverhältnisse darstellen.
Wie ist die Hausarbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Eine Einleitung, ein Kapitel zum Gesandten- und Geschenkaustausch, ein Kapitel zur Funktion und Problematik der abbasidischen Geschenke, ein Kapitel zum Umgang mit der Schenkproblematik in den fränkischen Quellen und ein abschließendes Fazit. Jedes Kapitel fasst seine Ergebnisse zusammen und baut auf den vorhergehenden Kapiteln auf.
Welche Forschungslücke schließt die Arbeit?
Die Arbeit schließt die Forschungslücke bezüglich der systematischen Analyse des Umgangs mit den abbasidischen Gaben in den fränkischen Quellen. Bisherige Forschungsansätze zu Karl und Harun und zum Thema Schenken im Mittelalter werden kurz skizziert, aber eine umfassende Analyse des Umgangs mit der potenziellen Demütigung durch die abbasidischen Geschenke in den genannten Quellen fehlte.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Karl der Große, Harun al-Raschid, Gesandtenaustausch, Geschenkgaben, Abbasidenreich, Frankenreich, Mittelalter, Diplomatie, interkulturelle Beziehungen, karolingische Quellen, Reichsannalen, Vita Karoli, Gesta Karoli, rhetorische Strategien, Machtverhältnisse, Demütigung, Ehrerweisung.
Welche Ergebnisse liefert die Arbeit?
Die Arbeit liefert eine detaillierte Analyse des Gesandten- und Geschenkaustausches zwischen Karl dem Großen und Harun al-Raschid, untersucht die Funktion und die potenzielle Problematik der abbasidischen Geschenke und analysiert, wie diese Problematik in drei wichtigen karolingischen Quellen rhetorisch bewältigt wird. Die Ergebnisse tragen zum Verständnis der interkulturellen Beziehungen im frühen Mittelalter und der Funktion von Geschenken in der mittelalterlichen Diplomatie bei.
- Citation du texte
- Sebastian Binder (Auteur), 2018, Der Gesandtenaustausch zwischen Karl dem Großen und Harun al-Raschid. Zur Problematik des Schenkens im Mittelalter, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/510417