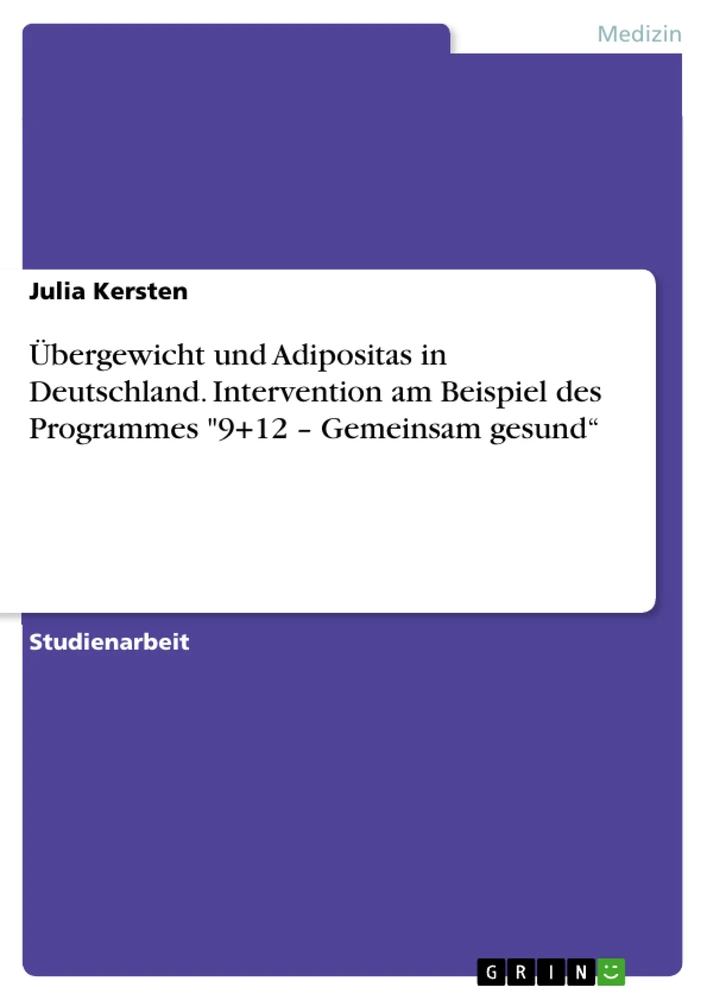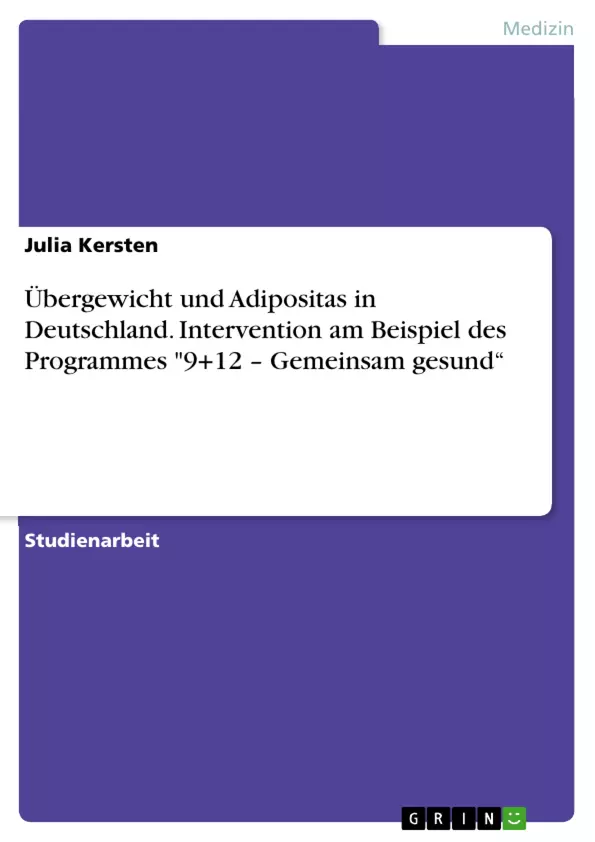Die stetige Zunahme von Übergewicht, insbesondere Adipositas sowie der demographische Wandel stellen das Gesundheitswesen vor immer größer werdenden finanziellen und versorgungstechnischen Herausforderungen. Das Projekt "9+12 – Gemeinsam gesund" der Initiative "pep – plattform ernährung und bewegung e.V." hat das Ziel eine gesunde Ernährung und Lebensweise von der Empfängnis an zu fördern und dadurch das Übergewichtsrisiko von Beginn an zu senken. Die Projektevaluation sowie die gesundheitswissenschaftliche Relevanz sind aus der vorliegenden Arbeit zu entnehmen.
Im ersten Teil der Hausarbeit erhält der Leser einen Überblick über diverse Daten und Fakten der Ernährungssituation in Deutschland sowie über die erhobenen Nahrungsmittelvorlieben und Ernährungsgewohnheiten in Deutschland. Ebenso werden auslösende Faktoren, soziale Hintergründe und Auswirkungen von Übergewicht und Adipositas beschrieben. Abschließend wird ein kurzer Einblick über einige Institutionen der Gesundheitspolitik gegeben. Der zweite Teil dieser Arbeit beschreibt das Projekt "9+12 – Gemeinsam gesund" und geht dabei auf Inhalt, Umsetzung, Evaluation sowie deren gesundheitswissenschaftliche Bedeutung ein. Eine abschließende Beurteilung der Rechercheergebnisse und Ausblick über themennahe Module im weiteren Studienverlauf sind dem dritten Teil der Arbeit zu entnehmen.
Inhaltsverzeichnis
- KURZZUSAMMENFASSUNG
- 1. EINLEITUNG
- 1.1 ERNÄHRUNGSSITUATION IN DEUTSCHLAND
- 1.2 URSACHEN, RISIKOFAKTOREN UND FOLGEN
- 1.3 MABNAHMEN DER GESUNDHEITSPOLITIK
- 2. DAS PROJEKT "9+12 - GEMEINSAM GESUND"
- 2.1 KONZEPT UND UMSETZUNG
- 2.2 EVALUATION
- 2.3 "9+12" EIN GESUNDHEITSWISSENSCHAFTLICHES PROJEKT
- 3. FAZIT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Projektarbeit analysiert das Problem von Übergewicht und Adipositas in Deutschland, insbesondere unter dem Fokus der Initiative „pep - plattform ernährung und bewegung e.V.“ und deren Projekt „9+12 - Gemeinsam gesund“. Die Arbeit beleuchtet die Ernährungsituation in Deutschland, untersucht die Ursachen, Risikofaktoren und Folgen von Übergewicht und Adipositas, sowie die Maßnahmen der Gesundheitspolitik. Im Zentrum steht die Präsentation des Projekts „9+12 - Gemeinsam gesund“, einschließlich seines Konzepts, der Umsetzung, Evaluation und seiner gesundheitswissenschaftlichen Relevanz.
- Ernährungssituation in Deutschland
- Ursachen und Folgen von Übergewicht und Adipositas
- Gesundheitspolitische Maßnahmen zur Förderung gesunder Ernährung
- Das Projekt „9+12 - Gemeinsam gesund“
- Gesundheitswissenschaftliche Relevanz des Projekts
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Ernährungslage in Deutschland und analysiert den Trend zu Übergewicht und Adipositas. Es wird auf die wichtigsten Nahrungsmittelvorlieben und Ernährungsgewohnheiten der Bevölkerung eingegangen, sowie auf die Ursachen und Folgen des Problems. Das Kapitel liefert einen Überblick über die aktuellen gesundheitspolitischen Maßnahmen zur Bekämpfung der Übergewichtsepidemie.
Im zweiten Kapitel wird das Projekt „9+12 - Gemeinsam gesund“ vorgestellt. Es wird das Konzept des Projekts, die Umsetzung und die Evaluation des Programms erläutert. Der Fokus liegt auf der gesundheitswissenschaftlichen Bedeutung des Projekts und seiner Beiträge zur Gesundheitsförderung.
Schlüsselwörter
Übergewicht, Adipositas, Ernährungssituation, Deutschland, Gesundheitspolitik, Prävention, „9+12 - Gemeinsam gesund“, Projekt, Initiative, pep - plattform ernährung und bewegung e.V., Evaluation, gesundheitswissenschaftliche Relevanz, Nahrungsmittelvorlieben, Ernährungsgewohnheiten, Risikofaktoren, Folgen, Intervention, Lebensweise, Kinder, Jugendliche, Familien.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel des Programms „9+12 – Gemeinsam gesund“?
Das Programm zielt darauf ab, gesundes Essverhalten und Bewegung bereits ab der Empfängnis (9 Monate Schwangerschaft + 12 Monate nach der Geburt) zu fördern, um Übergewicht frühzeitig vorzubeugen.
Warum ist Adipositas in Deutschland ein wachsendes Problem?
Ursachen sind veränderte Ernährungsgewohnheiten, Bewegungsmangel sowie soziale Hintergründe, die das Gesundheitssystem vor große finanzielle Herausforderungen stellen.
Welche Rolle spielt die Initiative „pep“?
Die „plattform ernährung und bewegung e.V.“ (pep) vernetzt Akteure aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, um Projekte zur Prävention von Übergewicht bei Kindern umzusetzen.
Wie wird das Projekt „9+12“ evaluiert?
Die Arbeit beschreibt die Evaluation hinsichtlich der Umsetzung und der gesundheitswissenschaftlichen Bedeutung für die Zielgruppen (Schwangere und junge Familien).
Was sind die Folgen von frühkindlichem Übergewicht?
Neben körperlichen Langzeitfolgen wie Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen können auch psychosoziale Probleme und eine geringere Lebensqualität resultieren.
- Quote paper
- Julia Kersten (Author), 2018, Übergewicht und Adipositas in Deutschland. Intervention am Beispiel des Programmes "9+12 – Gemeinsam gesund“, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/510777