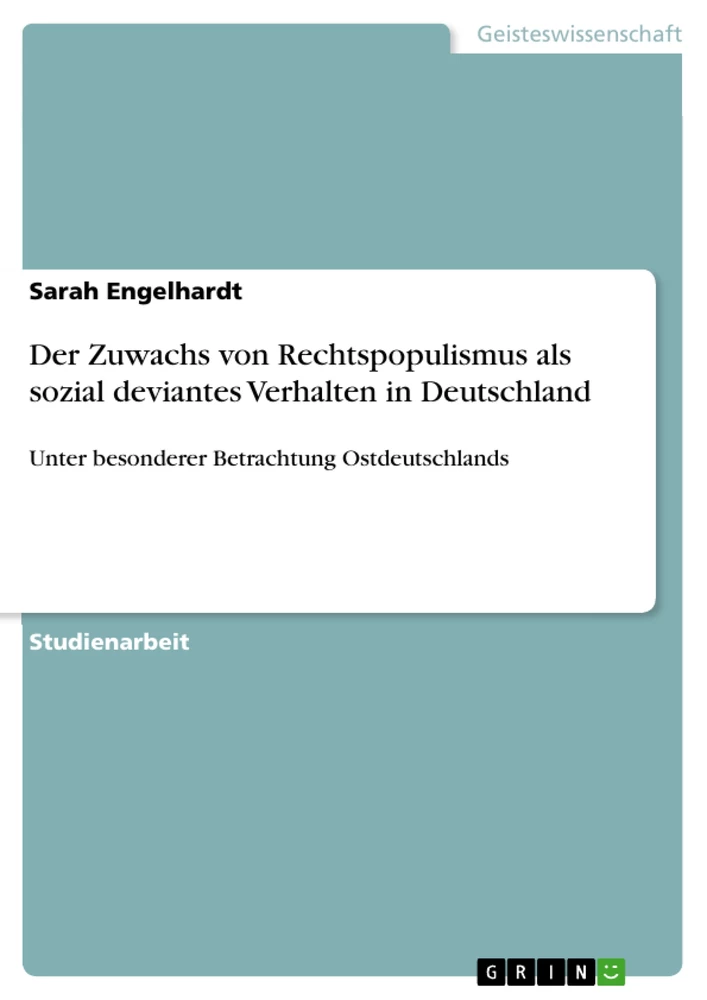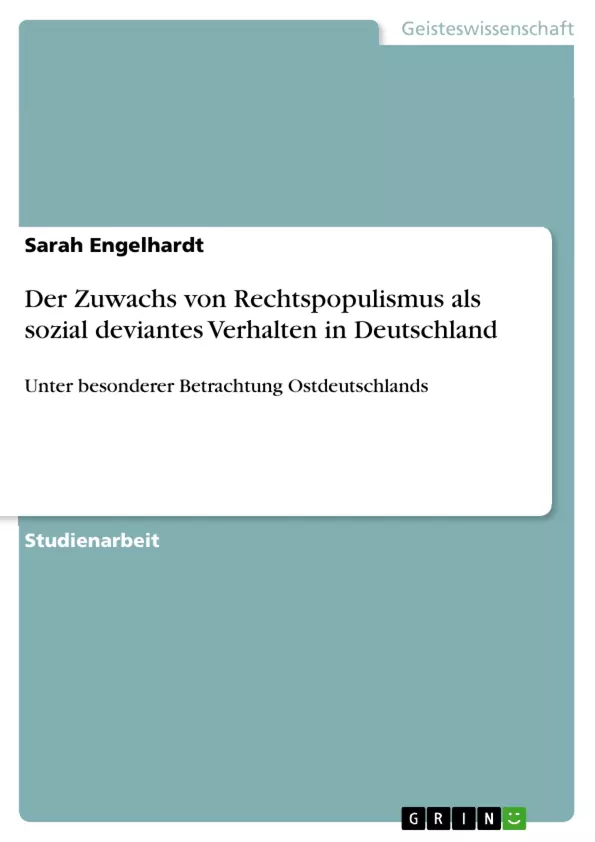Rechtspopulismus in Deutschland kann nicht nur auf die Geschichte zu Zeiten des Nationalsozialismus bezogen werden, sondern ist heutzutage aktueller denn je. In Zeiten der Globalisierung und regelrechter Flüchtlingsströme fällt es den politischen Eliten in ganz Europa schwer, den Rechtspopulismus einzudämmen. Anhand dieser Arbeit sollen mögliche Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge geklärt werden, um Anhaltspunkte dafür zu geben, welche gesellschaftlichen Bedingungen verändert werden sollten, um den Rechtspopulismus unter Kontrolle zu bekommen. Dabei soll ein zusätzliches Augenmerk auf Ostdeutschland fallen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsdefinition
- Rechtspopulismus
- Pegida als Organisation
- Rechtspopulismus als sozial deviantes Verhalten
- Außenseiter
- Labelling-Ansatz
- Legitimation
- Zusammenhänge sozioökonomischer und kultureller Verhältnisse mit Rechtspopulismus
- sozioökonomische Verhältnisse
- Wertewandel
- Sozioökonomische, demografische und kulturelle Gegebenheiten
- Allgemein
- Ostdeutschland
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den Ursachen des zunehmenden Rechtspopulismus in der Bundesrepublik Deutschland, wobei ein besonderer Fokus auf Ostdeutschland gelegt wird. Ziel ist es, die Zusammenhänge zwischen sozioökonomischen, demografischen und kulturellen Faktoren und dem Rechtspopulismus aufzuzeigen. Die Arbeit analysiert zudem, inwiefern Rechtspopulismus als sozial deviantes Verhalten betrachtet werden kann.
- Definition und Einordnung des Rechtspopulismus
- Analyse des Rechtspopulismus als sozial deviantes Verhalten
- Sozioökonomische und kulturelle Ursachen für den Rechtspopulismus
- Besondere Betrachtung der Situation in Ostdeutschland
- Bedeutung von Organisationsformen wie PEGIDA
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2: Begriffsdefinition
Dieses Kapitel definiert den Begriff "Rechtspopulismus" und beleuchtet dessen wesentliche Merkmale. Es wird außerdem die Organisation PEGIDA als Beispiel für die Ausdrucksformen des Rechtspopulismus in der Öffentlichkeit herangezogen.
Kapitel 3: Rechtspopulismus als sozial deviantes Verhalten
Dieses Kapitel diskutiert die Frage, inwiefern Rechtspopulismus als sozial deviantes Verhalten betrachtet werden kann. Dazu werden theoretische Konzeptionen abweichenden Verhaltens, wie der Außenseiter-Ansatz, vorgestellt und auf den Rechtspopulismus angewendet. Die pro und contra-Argumente für und gegen die Einstufung des Rechtspopulismus als sozial deviantes Verhalten werden dargelegt.
Kapitel 4: Zusammenhänge sozioökonomischer und kultureller Verhältnisse mit Rechtspopulismus
Dieses Kapitel beschreibt die Zusammenhänge zwischen sozioökonomischen und kulturellen Faktoren und dem Rechtspopulismus. Dabei werden sowohl sozioökonomische Verhältnisse als auch der Wertewandel als mögliche Ursachen des Rechtspopulismus betrachtet.
Kapitel 5: Sozioökonomische, demografische und kulturelle Gegebenheiten
Dieses Kapitel analysiert die sozioökonomischen, demografischen und kulturellen Gegebenheiten in der Bundesrepublik Deutschland im Allgemeinen und in Ostdeutschland im Speziellen. Es wird gezeigt, wie sich die im vorherigen Kapitel beschriebenen Zusammenhänge in der Realität manifestieren.
Schlüsselwörter
Rechtspopulismus, sozial deviantes Verhalten, Außenseiter, Labelling-Ansatz, Legitimation, sozioökonomische Verhältnisse, Wertewandel, Ostdeutschland, PEGIDA, AfD, Flüchtlingskrise.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Ursachen für den Zuwachs von Rechtspopulismus in Deutschland?
Wesentliche Ursachen sind sozioökonomische Ängste durch Globalisierung, kulturelle Verunsicherung durch den Wertewandel sowie die Reaktionen auf die Flüchtlingskrise.
Warum wird Rechtspopulismus als „sozial deviantes Verhalten“ analysiert?
Aus soziologischer Sicht wird untersucht, ob rechtspopulistische Einstellungen eine Abweichung von gesellschaftlichen Normen darstellen und wie der „Labelling-Ansatz“ (Etikettierung als Außenseiter) die Radikalisierung beeinflusst.
Welche Rolle spielt die Situation in Ostdeutschland beim Rechtspopulismus?
In Ostdeutschland verstärken spezifische demografische Faktoren (Abwanderung), wirtschaftliche Transformationserfahrungen und eine andere politische Sozialisation die Anfälligkeit für rechtspopulistische Bewegungen wie PEGIDA.
Was besagt der Labelling-Ansatz im Kontext politischer Einstellungen?
Der Labelling-Ansatz legt nahe, dass die öffentliche Brandmarkung von Gruppen als „deviant“ oder „Außenseiter“ dazu führen kann, dass sich diese Gruppen erst recht mit dieser Rolle identifizieren und sich weiter solidarisieren.
Wie hängen sozioökonomische Verhältnisse und Rechtspopulismus zusammen?
Menschen, die sich als „Modernisierungsverlierer“ fühlen oder Angst vor sozialem Abstieg haben, neigen eher dazu, einfache Antworten und Sündenbock-Rhetorik rechtspopulistischer Akteure zu akzeptieren.
Welche Bedeutung hat PEGIDA für diese Untersuchung?
PEGIDA wird als Beispiel für eine außerparlamentarische Organisation herangezogen, die rechtspopulistische Ressentiments auf die Straße getragen und zur Legitimation dieser Positionen beigetragen hat.
- Quote paper
- Sarah Engelhardt (Author), 2018, Der Zuwachs von Rechtspopulismus als sozial deviantes Verhalten in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/510780