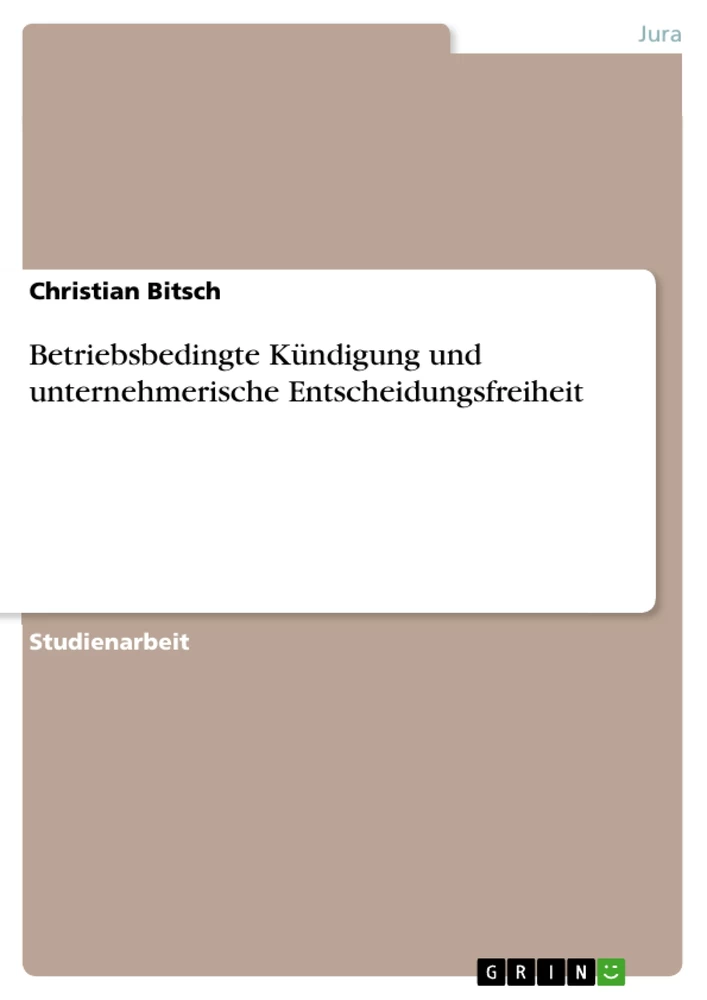Einst forderte Otto v.Gierke, ein Tropfen sozialistischen Öls müsse in das deutsche Privatrecht einsickern. In der Zeit des beginnenden 21. Jahrhunderts, in der den Deutschen allmählich zwar nicht die Arbeit, wohl aber die Arbeitsplätze ausgehen, werden in der öffentlichen Diskussion immer häufiger gegenteilige Äußerungen laut. So spricht der Volkswirt Meinhard Miegel von einer Arbeitnehmergesellschaft, die sich in Deutschland „breit gemacht“ habe.
Im Kern der Diskussion steht dabei das deutsche Kündigungsschutzrecht. Während es manche für einen „Arbeitsplatzkiller“ halten, sehen andere keinen nachweisbaren Zusammenhang zwischen Massenarbeitslosigkeit und Kündigungsschutz.
Für die von Entlassungen und Arbeitslosigkeit bedrohten Menschen steht bei alledem mehr als nur der Verlust der eigenen wirtschaftlichen Existenz auf dem Spiel. Der Arbeitsplatz bedeutet heute – so scheint es – weit mehr als bloßen Broterwerb. Vielmehr finden „Freiheit und Würde darin ihren deutlichsten Ausdruck“.
Der Kündigungsschutz hat sich nicht zuletzt deshalb zu einem festen Bestandteil im deutschen Arbeitsrecht entwickelt. Dennoch werden nach Schätzungen des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der Hans-Böckler-Stiftung jährlich etwa 7 Mio. Arbeitsverhältnisse beendet, davon rund 2 Mio. durch Arbeitgeberkündigungen.
Den größten Teil hiervon machen die sogenannten betriebsbedingten Kündigungen aus. Nicht selten kommt es im Anschluss an eine Kündigung zu Auseinandersetzungen vor den Arbeitsgerichten, in deren Verlauf die arbeitgeberseitige Kündigungsentscheidung einer richterlichen Kontrolle unterzogen wird.
Die Unternehmer sehen hierin freilich eine empfindliche Einschränkung ihrer Gestaltungs- und Bewegungsfreiheit und fordern alsbaldige Reformen auf diesem Gebiet oder plädieren zumindest für eine stärkere „Zurückhaltung des Arbeitsrechts“. Solche Aussagen sind auch in der rechtswissenschaftlichen Diskussion zu hören9, insbesondere nachdem die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts (BAG) in aktuellen kündigungsschutzrechtlichen Entscheidungen für Aufsehen sorgte.
Im Mittelpunkt des Streits steht dabei der Konflikt zwischen dem Schutz vor ungerechtfertigten Kündigungen aus betrieblichen Gründen einerseits und dem Schutz hinreichender Bewegungsfreiheit der Unternehmen im Zeitalter des globalisierten Wettbewerbs andererseits.
Inhaltsverzeichnis
- A. EINLEITUNG UND AUFGABENSTELLUNG
- B. DOGMATIK DER UNTERNEHMERISCHEN ENTSCHEIDUNGSFREIHEIT
- I. HISTORISCHE ENTWICKLUNG UNTERNEHMERISCHER FREIHEIT
- 1. Von der Aufklärung bis zum Kaiserreich.
- 2. Weimarer Reichsverfassung und Nationalsozialismus
- 3. Die Entwicklung zum Grundgesetz
- II. GRUNDLAGEN DER UNTERNEHMERFREIHEIT NACH HEUTIGEM VERSTÄNDNIS.
- 1. Unternehmerfreiheit als Berufs- und Eigentumsfreiheit des Arbeitgebers.
- 2. Schutzbereich
- a. Persönlicher Schutzbereich
- aa. Schutz juristischer Personen.
- bb. Ergebnis
- b. Sachlicher Schutzbereich
- aa. Unternehmerische Dispositionsfreiheit
- bb. Investitionsfreiheit und Freiheit der marktmäßigen Betätigung
- cc. Organisationsfreiheit.………………………………….
- dd. Vertragsfreiheit..
- 3. Schranken der Unternehmerfreiheit.….........
- 4. Rechtfertigung von Eingriffen ...
- 5. Zusammenfassung
- C. DAS SYSTEM BETRIEBSBEDINGTER KÜNDIGUNGEN.
- I. HISTORISCHE ENTWICKLUNG DES KÜNDIGUNGSRECHTS
- 1. Die Entwicklung bis zum Ersten Weltkrieg.
- 2. Weimarer Republik und Nationalsozialismus.
- 3. Die Entwicklung nach 1945 ..
- II. BEGRÜNDUNG DES KÜNDIGUNGSSCHUTZES
- III. KÜNDIGUNGSSCHUTZ NACH DEM KSCHG
- 1. Anwendungsbereich
- a. Sachlicher Anwendungsbereich
- b. Betrieblicher Anwendungsbereich ..
- c. Persönlicher Anwendungsbereich
- 2. Die einzelnen Kündigungstatbestände
- a. Personenbedingte Kündigung.……...
- b. Verhaltensbedingte Kündigung..
- c. Betriebsbedingte Kündigung.
- aa. Die Unternehmerentscheidung als Ausgangspunkt.
- a. Innerbetriebliche Ursachen
- ẞ. Außerbetriebliche Ursachen …......
- bb. Kündigung als ultima ratio..
- cc. Sozialauswahl
- dd. Abfindungsanspruch....
- 3. Schutzinstrument: Kündigungsschutzklage .....
- IV. KÜNDIGUNGSSCHUTZ AUBERHALB DES KSCHG.
- V. BETRIEBSBEDINGTE ÄNDERUNGSKÜNDIGUNG
- VI. ZUSAMMENFASSUNG...
- D. UNTERNEHMERISCHE ENTSCHEIDUNGSFREIHEIT BEI DER BETRIEBSBEDINGTEN KÜNDIGUNG………………………………...
- I. KÜNDIGUNGSSCHUTZ ALS EINGRIFF IN DIE BERUFSFREIHEIT DES ARBEITGEBERS.
- 1. Rechtfertigung.
- 2. Grenzen der Rechtfertigungsmöglichkeit...
- II. GERICHTLICHE KONTROLLE DER ARBEITGEBERENTSCHEIDUNG
- 1. Grundsatz: Keine Kontrolle der unternehmerischen Entscheidung
- a. Begriff der Unternehmerentscheidung.
- b. Begründung in Rechtsprechung und Schrifttum.
- c. Eigener Standpunkt
- 2. Aber: Willkürverbot....
- a. willkürliche Entscheidung.
- b. unvernünftige Entscheidung.
- c. unsachliche Entscheidung
- 3. Erforderlichkeit einer unternehmerischen Entscheidung
- a. Kündigungsentschluss als freie Unternehmerentscheidung?.
- b. Die Entscheidung zur Personalreduzierung
- c. Aber: Keine Austauschkündigung.......
- d. Kritik an der eingeschränkten Kontrolle.
- e. Zusammenfassung.
- 4. Willkürverbot bei der Umsetzung der Unternehmerentscheidung.
- a. Ultima ratio und Entscheidungsfreiheit........
- aa. Weiterbeschäftigung..
- bb. Änderung der Arbeitsbedingungen
- cc. Kurzarbeit..
- a. Rechtsprechung ..
- ẞ. Teilweise: Keine Verpflichtung zur Kurzarbeit ..
- y. Richtigerweise: Verpflichtung zur möglichen Kurzarbeit
- dd. Produktion auf Halde
- ee. Gewinnverzicht als milderes Mittel?.
- b. Sozialauswahl als Eingriff in die Unternehmerfreiheit
- c. Anhörung des Betriebsrates.
- III. BETRIEBSBEDINGTE ÄNDERUNGSKÜNDIGUNG UND UNTERNEHMERFREIHEIT
- 1. Missbrauchsfreie Unternehmerentscheidung.....
- 2. Änderungskündigung als ultima ratio.
- 3. Sozialauswahl.....
- 4. Positive Interessenabwägung...\n
- a. Begründung und Ausgestaltung
- b. Richtigerweise: Keine besondere Interessenabwägung
- IV. NEUERLICH: ORGANISATIONSFREIHEIT ALS RECHTSMISSBRAUCH?.
- 1. Die Kaufhof-Entscheidung.
- a. Kritik an der Entscheidung.
- 2. Die Weight-Watchers-Entscheidung.
- a. Ablehnende Stimmen im Schrifttum
- b. Aber: Hierarchieabbau als Unternehmerentscheidung.......
- b. Überwiegend: Zustimmung...\n
- c. Eigener Standpunkt
- aa. Franchising als freie Unternehmerentscheidung
- bb. Soziale Rechtfertigung.
- cc. Tatsächlich: Betriebsübergang?.
- 3. Die,, Crewing\"-Entscheidung..
- 4. Die Rheumaklinik-Entscheidung.
- a. Zustimmung im Schrifttum
- b. Kritik an der Entscheidung.
- c. Eigener Standpunkt
- aa. Outsourcing als freie Unternehmerentscheidung..
- bb. Wegfall der Beschäftigungsmöglichkeit..
- cc. Richtigerweise: Betriebsübergang..
- a. Übergang
- B. Wahrung der Identität..\n
- Y. Ergebnis.......
- 5. Seither ergangene Judikatur.
- a. LAG Düsseldorf vom 10.Februar 2004.
- b. LAG Niedersachsen vom 13. Juni 2003..
- c. Sächsisches LAG vom 7.Mai 2004 ........
- d. LAG Mecklenburg-Vorpommern vom 11.Januar 2005.
- e. Stellungnahme zur jüngeren Rechtsprechung..
- V. DAS PROBLEM DER DARLEGUNGS- UND BEWEISLAST.
- E. FAZIT
- Die historische Entwicklung der unternehmerischen Freiheit
- Die rechtlichen Grundlagen der Unternehmerfreiheit im heutigen Verständnis
- Das System der betriebsbedingten Kündigungen im deutschen Recht
- Die Einschränkung der Unternehmerischen Entscheidungsfreiheit durch den Kündigungsschutz
- Die rechtliche Kontrolle der Arbeitgeberentscheidung durch die Gerichte
- A. Einleitung und Aufgabenstellung: Diese Einleitung präsentiert die kontroverse Debatte um das deutsche Kündigungsschutzrecht und stellt die Bedeutung des Kündigungsschutzes im Kontext der wirtschaftlichen Existenz und der "Freiheit und Würde" der Arbeitnehmer heraus.
- B. Dogmatik der Unternehmerischen Entscheidungsfreiheit: Dieses Kapitel behandelt die historische Entwicklung der unternehmerischen Freiheit, untersucht die rechtlichen Grundlagen der Unternehmerfreiheit im heutigen Verständnis und geht auf die Schranken und Rechtfertigungen von Eingriffen in die Unternehmerfreiheit ein.
- C. Das System betriebsbedingter Kündigungen: Dieses Kapitel erläutert die historische Entwicklung des Kündigungsrechts, die Begründung des Kündigungsschutzes und die Einzelheiten des Kündigungsschutzes nach dem Kündigungsschutzgesetz (KSchG). Es behandelt die verschiedenen Kündigungstatbestände, die Anforderungen an die betriebsbedingte Kündigung und die rechtlichen Schutzinstrumente für Arbeitnehmer.
- D. Unternehmerische Entscheidungsfreiheit bei der betriebsbedingten Kündigung: Dieses Kapitel fokussiert auf die Frage, wie der Kündigungsschutz die berufliche Freiheit des Arbeitgebers einschränkt und in welcher Form die Gerichte die Arbeitgeberentscheidung kontrollieren. Die Diskussion umfasst die Begriffe der Unternehmerentscheidung, Willkürverbot und Erforderlichkeit, sowie die Umsetzung der Unternehmerentscheidung durch Ultima-Ratio-Prinzip, Sozialauswahl und Anhörung des Betriebsrats.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Unternehmerischen Entscheidungsfreiheit im Kontext des deutschen Kündigungsschutzes. Sie analysiert, wie sich die historische Entwicklung der unternehmerischen Freiheit auf das heutige Verständnis des Kündigungsschutzes auswirkt.
Zusammenfassung der Kapitel
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen der Unternehmerischen Entscheidungsfreiheit, des Kündigungsschutzes, der betriebsbedingten Kündigung, des Willkürverbots, der Sozialauswahl und der rechtlichen Kontrolle der Arbeitgeberentscheidung im deutschen Recht.
- Citation du texte
- Christian Bitsch (Auteur), 2005, Betriebsbedingte Kündigung und unternehmerische Entscheidungsfreiheit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/51079