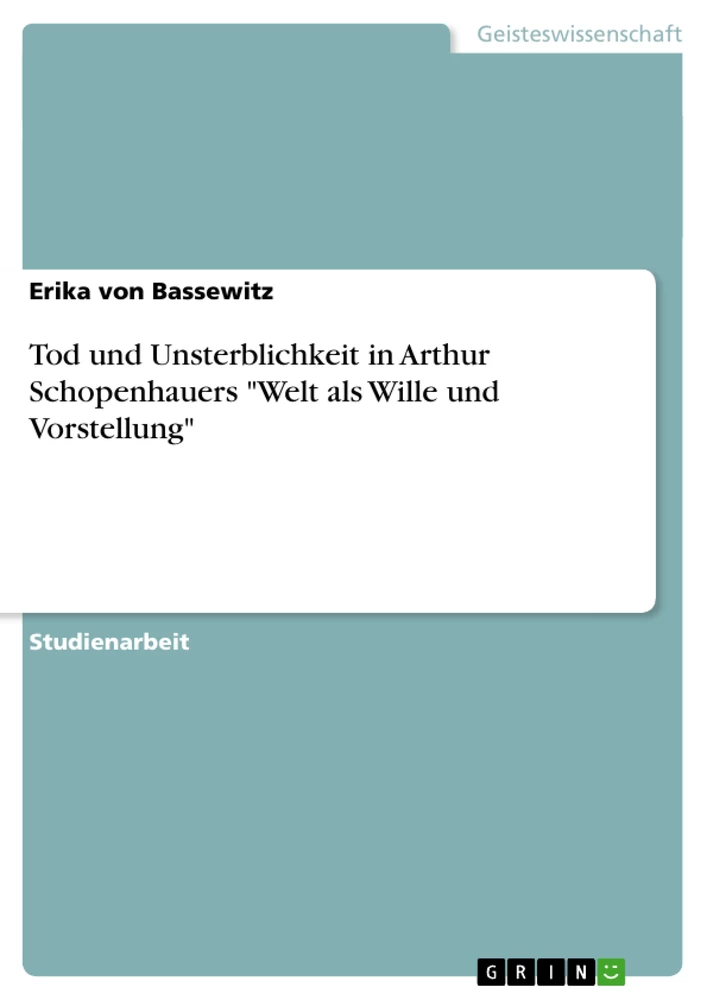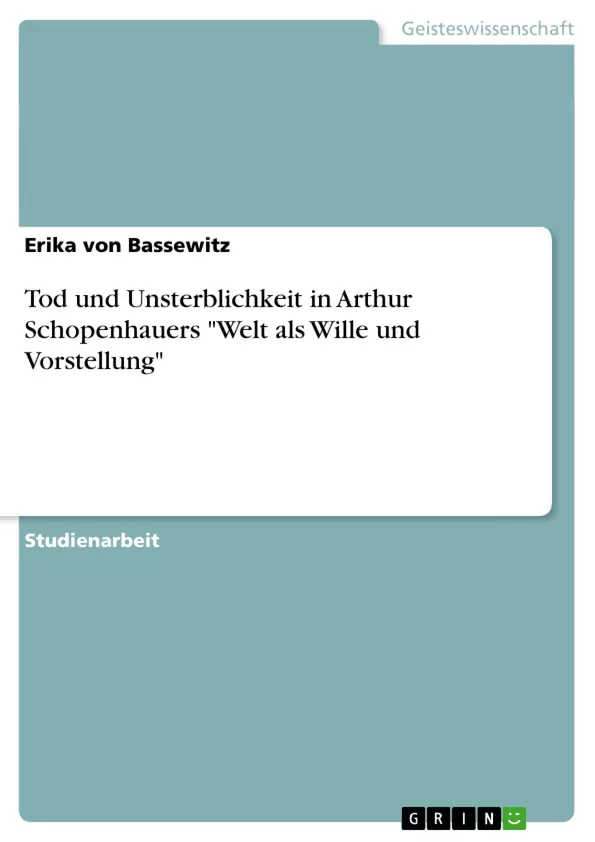Einleitung
Diese Hausarbeit soll einen Versuch darstellen, die Bedeutung des Todes für das Individuum in der Philosophie Arthur Schopenhauers zu erklären. Die Grundfrage der vorliegenden Arbeit lautet dementsprechend:
Was ist der Tod? Nach einer einführenden Erläuterung der von Schopenhauer mehr oder weniger stark abgelehnten religiösen Konzepte soll diskutiert werden, ob und wie der Mensch in der Welt als
Wille und Vorstellung unsterblich sein kann. Dabei soll nicht eine bestimmte Textstelle, sondern sein Gesamtwerk betrachtet werden. Das Hauptaugenmerk soll allerdings seinem Hauptwerk Die Welt als Wille und Vorstellung gelten, während seine Parerga und Paralipomena lediglich zu ergänzenden Anmerkungen hinzugezogen werden.
Da Schopenhauer selbst sein Werk als organische Einheit, d.h. als nicht-lineare Argumentation bezeichnete, werden in dieser Arbeit verschiedene Stellen seines Hauptwerkes in ebenso nicht-linearer Reihenfolge diskutiert werden.
Desweiteren soll Schopenhauers Klage über die von ihm sog. Hegelei nicht übergangen werden, weshalb lediglich gegen Ende der Arbeit auf Kritik in der Sekundärliteratur eingegangen werden wird.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Tod und Unsterblichkeit bei Schopenhauer
- 1. Das metaphysische Bedürfnis des Menschen
- 1.1 Der Mensch als metaphysisches Tier
- 1.2. Was kommt nach dem Tod?
- 1.3. Zur Todesangst
- 1.4. Zeit und Identität
- 2. Über das Nichts
- 3. Unsterblichkeit der Gattung
- 3.1. Selbstmord
- 3.2. Verneinung des Willens
- 3.2.1. Zuflucht im Nichts
- 3.2.2. Der Asketismus
- 3.2.2.1. Kritik des Asketismus- Konzepts
- III. Fazit
- IV. Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit zielt darauf ab, die Bedeutung des Todes für das Individuum in der Philosophie Arthur Schopenhauers zu beleuchten. Die zentrale Fragestellung lautet: Was ist der Tod? Die Arbeit analysiert Schopenhauers Kritik an religiösen Konzepten und untersucht die Möglichkeit und Art der Unsterblichkeit des Menschen in der Welt als Wille und Vorstellung. Dabei wird nicht nur eine bestimmte Textstelle betrachtet, sondern das gesamte Werk Schopenhauers. Der Fokus liegt auf "Die Welt als Wille und Vorstellung", während "Parerga und Paralipomena" ergänzende Anmerkungen liefern.
- Der Mensch als "animal metaphysicum" und sein metaphysisches Bedürfnis
- Schopenhauers Kritik an traditionellen religiösen Vorstellungen vom Tod und der Unsterblichkeit
- Die Rolle der Todesangst in der menschlichen Existenz
- Die Bedeutung der Verneinung des Willens und des Asketismus für die Überwindung des Todes
- Die Unsterblichkeit der Gattung als alternative Perspektive
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die zentrale Fragestellung der Arbeit vor. Anschließend werden die religiösen Konzepte vom Tod und der Unsterblichkeit beleuchtet und von Schopenhauer kritisiert. In Kapitel II wird das metaphysische Bedürfnis des Menschen als Grundlage für die Todesangst und die Suche nach einer Erklärung für die Existenz erörtert. Schopenhauer argumentiert, dass der Mensch aufgrund seiner Fähigkeit zum Selbstbewusstsein und seiner Erkenntnis der eigenen Sterblichkeit nach Trost jenseits des Todes sucht. Das Kapitel analysiert auch die Kritik Schopenhauers an der Vorstellung einer unsterblichen Seele und befasst sich mit der Todesangst als Reaktion auf die Vergänglichkeit des individuellen Lebens. Im letzten Kapitel, "Über das Nichts", präsentiert Schopenhauer die Idee des ewigen Nichtseins als eine Alternative zur Vorstellung einer unsterblichen Seele und betont die Unvermeidlichkeit des Todes für das Individuum.
Schlüsselwörter
Schopenhauer, Tod, Unsterblichkeit, metaphysisches Bedürfnis, Todesangst, Verneinung des Willens, Asketismus, Unsterblichkeit der Gattung, Welt als Wille und Vorstellung, animal metaphysicum, Religion, Philosophie.
- 1. Das metaphysische Bedürfnis des Menschen
- Citar trabajo
- Erika von Bassewitz (Autor), 2005, Tod und Unsterblichkeit in Arthur Schopenhauers "Welt als Wille und Vorstellung", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/51109