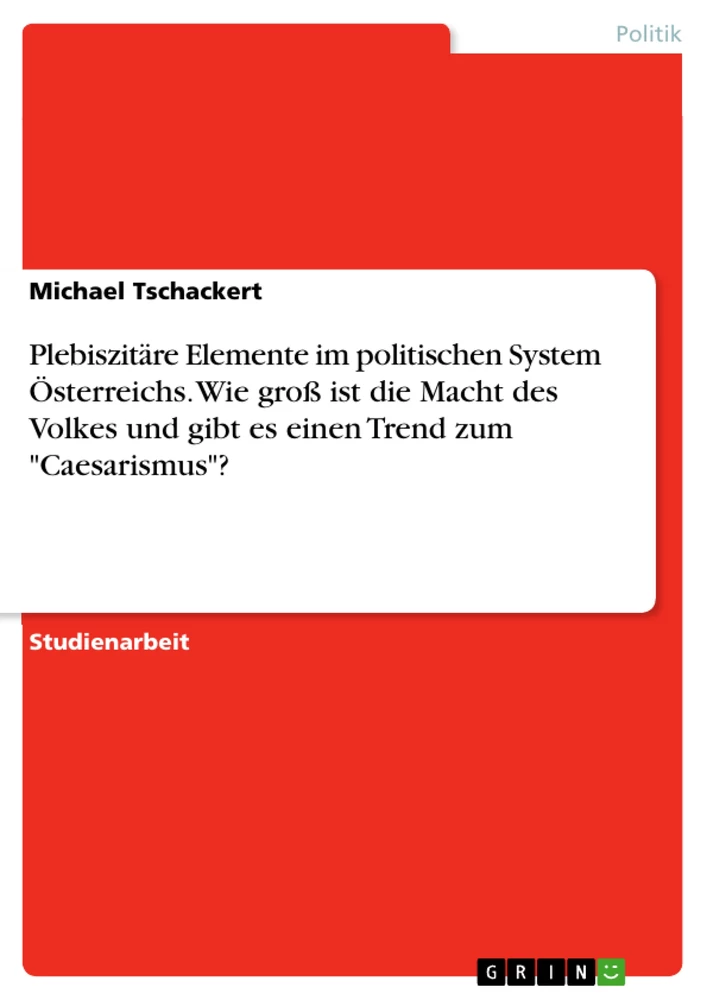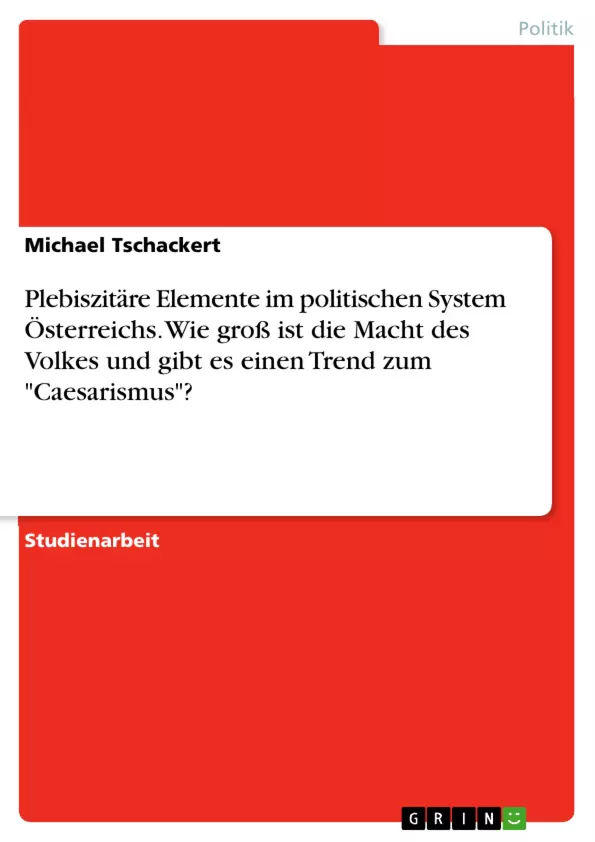Das österreichische Volk hat laut der Bundes-Verfassung vom 19. Dezember 1945 die Macht, die Rechte der Republik zu definieren. Doch wer ist dieses Volk überhaupt und wie groß ist seine Macht? Wie gestaltet sich deren Ausübung und lässt sich ein Trend in Richtung "Caesarismus" oder Oligarchie feststellen?
Parlamentarismus, Parteien, Verbände und der Neokorporatismus stellen in Österreich die wichtigsten repräsentativen Elemente dar. Es ist zwar nicht von der Hand zu weisen, dass das starke Verbandswesen und der damit einhergehende Neokorporatismus in Österreich kompromissfindend wirken und zwischen den Interessen von Staat, Wirtschaft und Bevölkerung vermittelt. Der wahre Garant der Rechtsstaatlichkeit findet sich allerdings im Parlament mit seinen Regeln des Parlamentarismus und dem Parteiensystem. Politische Parteien sorgen für die Integration von spezifischen Interessen in der politischen Arena, sie rekrutieren das politische Personal, das sich zur Wahl stellen darf und Verantwortung tragen muss. Am wichtigsten aber ist die legitimierende Funktion. Durch den offiziellen Rahmen wird bloße Machtanwendung allgemein akzeptiert und anerkannt.
Doch stehen diesen repräsentativen Elementen ausreichend starke plebiszitäre Elemente gegenüber, um im Falle Österreichs von einer sich im Gleichgewicht befindlichen Demokratie zu sprechen? Plebiszitäre Elemente, die die Verwirklichung von direkter Demokratie in modernen Systemen darstellen, zielen darauf ab, den Willen des Volkes ohne Zwischenschaltung der Volksvertreter umzusetzen. Neben den Wahlen des Nationalrats und der des Bundespräsidenten, gibt es für den Bürger des politischen Systems Österreichs noch andere Wege der Partizipation auf nationaler Ebene. Von gering bis ausschlaggebend, nach der gesetzlich festgelegten Relevanz ihres Resultats für die Politik gestaffelt, sind das die Demoskopie, also das Instrument der Volksbefragung, das Volksbegehren und die Volksabstimmung.
Inhaltsverzeichnis
- Zur Thematik
- Direkte demokratische Elemente in Österreich
- Die Volksbefragung
- Das Volksbegehren
- Die Volksabstimmung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die plebiszitären Elemente im österreichischen politischen System. Ziel ist es, das Ausmaß direkter Demokratie in Österreich zu analysieren und deren Bedeutung im Verhältnis zu repräsentativen Elementen zu bewerten. Die Arbeit hinterfragt, ob ein ausgewogenes Gleichgewicht zwischen beiden besteht und welche Risiken (Caesarismus, Oligarchie) bestehen könnten.
- Plebiszitäre vs. repräsentative Elemente in der österreichischen Demokratie
- Analyse der Volksbefragung, des Volksbegehrens und der Volksabstimmung
- Bewertung der Effektivität direkter demokratischer Instrumente
- Potentielle Risiken eines Übergewichts plebiszitärer Elemente
- Die Rolle von Parteien und Verbänden im österreichischen System
Zusammenfassung der Kapitel
Zur Thematik: Dieses einleitende Kapitel etabliert die zentrale These der Arbeit: Ein gesundes demokratisches System benötigt ein Gleichgewicht zwischen repräsentativen und plebiszitären Elementen. Es werden die Gefahren eines Übergewichts auf beiden Seiten – Caesarismus/Bonapartismus einerseits und Oligarchie andererseits – skizziert. Das Kapitel führt den Leser in die Thematik ein und legt die Grundlage für die nachfolgende detaillierte Analyse der plebiszitären Elemente in Österreich.
Direkte demokratische Elemente in Österreich: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die verschiedenen Formen der direkten Demokratie in Österreich, nämlich Volksbefragung, Volksbegehren und Volksabstimmung. Es betont die Unterschiede in ihrer rechtlichen Verankerung und ihrer Wirkung auf die politische Entscheidungsfindung. Der Fokus liegt auf der Einordnung dieser Elemente im Kontext der österreichischen Bundesverfassung und ihrer Bedeutung für die politische Partizipation der Bürger.
Die Volksbefragung: Dieses Kapitel befasst sich eingehend mit der Volksbefragung als schwächstes plebiszitäres Element. Es erläutert die gesetzlichen Grundlagen, die Initiierungsprozesse, die Wahlberechtigung und die Anforderungen an die Fragestellung. Besonders hervorgehoben wird die nicht-bindende Wirkung des Ergebnisses und die damit verbundene Funktion als Instrument des Meinungsbildes und der politischen Profilierung. Das Beispiel der Volksbefragung zum Bundesheer von 2013 dient zur Illustration.
Das Volksbegehren: Das Kapitel analysiert das Volksbegehren als eine stärkere Form der direkten Demokratie. Es erklärt detailliert die Anforderungen an die Antragstellung, die benötigte Anzahl an Unterschriften und den weiteren Ablauf bis zur Behandlung im Nationalrat. Der Fokus liegt auf der rechtlichen Einordnung, dem Einfluss auf die Gesetzgebung und den Möglichkeiten der politischen Partizipation durch diese Form des direkten Einflusses auf den Gesetzgebungsprozess.
Schlüsselwörter
Plebiszitäre Elemente, repräsentative Elemente, direkte Demokratie, Österreich, Volksbefragung, Volksbegehren, Volksabstimmung, Bundesverfassung, Parlamentarismus, Parteien, Verbände, Caesarismus, Oligarchie, politische Partizipation.
Häufig gestellte Fragen zur Seminararbeit: Plebiszitäre Elemente im österreichischen politischen System
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit analysiert die plebiszitären Elemente (Volksbefragung, Volksbegehren, Volksabstimmung) im österreichischen politischen System. Sie untersucht deren Ausmaß, Bedeutung im Verhältnis zu repräsentativen Elementen und das potenzielle Risiko eines Ungleichgewichts (Caesarismus/Bonapartismus oder Oligarchie).
Welche direkten demokratischen Elemente werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich ausführlich mit den drei Formen der direkten Demokratie in Österreich: der Volksbefragung, dem Volksbegehren und der Volksabstimmung. Dabei werden die rechtlichen Grundlagen, Initiierungsprozesse, Wirkung und Bedeutung für die politische Partizipation der Bürger untersucht.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, das Ausmaß direkter Demokratie in Österreich zu analysieren und deren Bedeutung im Verhältnis zu repräsentativen Elementen zu bewerten. Es wird hinterfragt, ob ein ausgewogenes Gleichgewicht besteht und welche Risiken bestehen könnten.
Wie sind die Kapitel aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu der Thematik (einschließlich der Gefahren von Übergewicht repräsentativer oder plebiszitärer Elemente), den direkten demokratischen Elementen in Österreich, der Volksbefragung (inkl. Beispiel), dem Volksbegehren und einer Zusammenfassung der Kapitel. Ein Inhaltsverzeichnis und Schlüsselwörter erleichtern die Navigation.
Was ist das Ergebnis der Analyse der Volksbefragung?
Die Volksbefragung wird als schwächstes plebiszitäres Element beschrieben, da ihr Ergebnis nicht bindend ist. Sie dient primär als Instrument des Meinungsbildes und der politischen Profilierung. Die Volksbefragung zum Bundesheer von 2013 dient als Beispiel.
Wie wird das Volksbegehren bewertet?
Das Volksbegehren wird als stärkere Form der direkten Demokratie analysiert. Es wird erklärt, wie Anträge gestellt werden, wie viele Unterschriften benötigt werden und wie der weitere Ablauf bis zur Behandlung im Nationalrat aussieht. Der Fokus liegt auf dem Einfluss auf die Gesetzgebung und die Möglichkeiten der politischen Partizipation.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Plebiszitäre Elemente, repräsentative Elemente, direkte Demokratie, Österreich, Volksbefragung, Volksbegehren, Volksabstimmung, Bundesverfassung, Parlamentarismus, Parteien, Verbände, Caesarismus, Oligarchie, politische Partizipation.
Welche Risiken werden in der Arbeit angesprochen?
Die Arbeit thematisiert die potenziellen Risiken eines Übergewichts plebiszitärer Elemente (Caesarismus/Bonapartismus) und eines Übergewichts repräsentativer Elemente (Oligarchie).
Welche Rolle spielen Parteien und Verbände?
Die Rolle von Parteien und Verbänden im österreichischen System wird in der Arbeit ebenfalls betrachtet, wenngleich die Details nicht im FAQ aufgeführt sind. Sie sind ein wichtiger Bestandteil des politischen Systems und beeinflussen die direkte Demokratie.
- Citar trabajo
- Michael Tschackert (Autor), 2019, Plebiszitäre Elemente im politischen System Österreichs. Wie groß ist die Macht des Volkes und gibt es einen Trend zum "Caesarismus"?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/511424