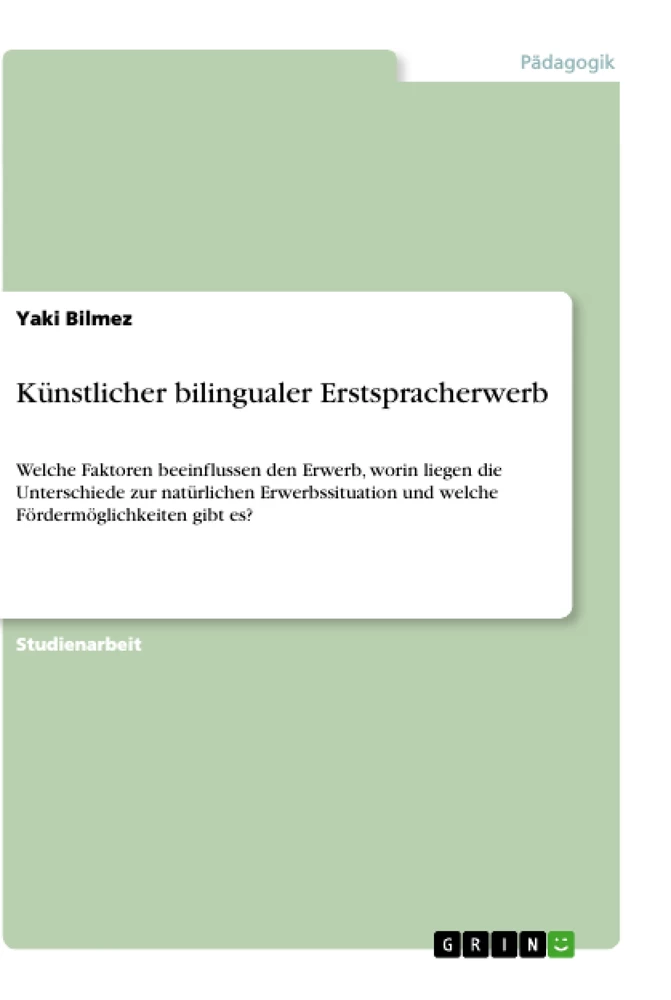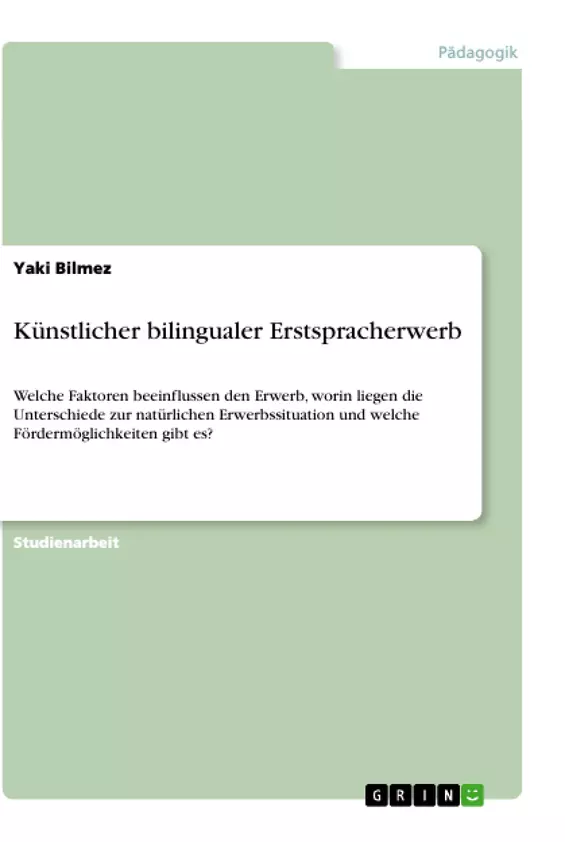In dieser Arbeit soll die Situation des künstlichen bilingualen Erstspracherwerb untersucht werden und welche Fördermöglichkeiten in Frage kommen. Dabei soll zunächst diese Erwerbsituation abgegrenzt und definiert werden. Im weiteren Verlauf werden Faktoren und ein Fall künstlicher bilingualer Zweisprachigkeitserziehung vorgestellt, sowie Unterschiede zur natürlichen Zweisprachigkeitserziehung dargestellt. Abschließend werden mögliche Fördermöglichkeiten genannt, die in Aufrechterhaltung und Verbesserung der sprachlichen Kompetenzen der Heranwachsenden resultieren sollen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Abgrenzung und Definition
- Faktoren des bilingualen Erstspracherwerb
- Spracherziehung und Merkmale der Eltern
- Ethnische Identität und Sprachprestige
- Einstellungen zur kindlichen Zweisprachigkeit
- Künstlicher bilingualer Erstspracherwerb
- Der Fall George Saunders
- Rahmenbedingungen des Falls
- Interpretation und Bewertung des Falls
- Unterschiede zum natürlichen bilingualen Erstspracherwerb
- Förderungsmöglichkeiten der schwachen Sprache
- Außerfamiliäre Bezugspersonen
- Medien
- Reisen
- Zusatzunterricht und ausländische Schulen
- Der Fall George Saunders
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem künstlichen bilingualen Erstspracherwerb. Ziel ist es, die Erwerbsbedingungen dieser spezifischen Situation zu beleuchten, wichtige Faktoren aufzuzeigen und die Unterschiede zum natürlichen bilingualen Erstspracherwerb herauszustellen. Außerdem werden verschiedene Fördermöglichkeiten für die schwache Sprache vorgestellt.
- Abgrenzung und Definition des künstlichen bilingualen Erstspracherwerb
- Einflussfaktoren auf den bilingualen Erstspracherwerb
- Der Fall George Saunders als Beispiel für künstlichen bilingualen Erstspracherwerb
- Unterschiede zwischen natürlichem und künstlichem bilingualen Erstspracherwerb
- Fördermöglichkeiten für die schwache Sprache im künstlichen bilingualen Erstspracherwerb
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die Relevanz sprachlicher Kompetenzen in der globalisierten Arbeitswelt heraus und beleuchtet die zunehmende Tendenz von Eltern, ihre Kinder zweisprachig zu erziehen. Dabei wird der Fokus auf den künstlichen bilingualen Erstspracherwerb gelegt, in dem Eltern, die beide monolingual in derselben Sprache aufgewachsen sind, bewusst ein bilinguales Kind erziehen möchten. Es wird auf die Ergebnisse der internationalen Forschung verwiesen, die zeigen, dass Kinder von einem bilingualen Erstspracherwerb nicht überfordert werden und dass sich ihre Erwerbsverläufe in beiden Sprachen nicht von denen monolingualer Kinder unterscheiden.
Abgrenzung und Definition
Dieses Kapitel grenzt den simultanen bilingualen Spracherwerb vom sukzessiven Erwerb ab und erklärt, dass sich diese Arbeit ausschließlich mit dem simultanen Erwerb beschäftigt. Der Fokus liegt dabei auf der Unterscheidung zwischen natürlichem und künstlichem Zweisprachigkeitserwerb. Kielhöfer und Jonekeit definieren natürlichen Erwerb als den Fall, in dem Kinder beide Sprachen in ihrer natürlichen Umgebung von alleine lernen. Künstliche Zweisprachigkeit hingegen beschreibt die Situation, in der einsprachige Eltern eine zweite Sprache künstlich in die Familiensprache integrieren. Das Kapitel beleuchtet die veränderte Definition von künstlichem bilingualem Erstspracherwerb in der neueren Literatur und betont die Unterscheidung zwischen starker und schwacher Sprache.
Faktoren des bilingualen Erstspracherwerb
Dieses Kapitel stellt verschiedene Faktoren vor, die sowohl den natürlichen als auch den künstlichen bilingualen Erstspracherwerb beeinflussen. Dabei wird insbesondere auf die Rolle der Spracherziehung und die Charakteristika der Eltern eingegangen. Es werden verschiedene Stile der Zweisprachigkeitserziehung klassifiziert, wie z.B. die Verwendung der Familiensprache als Nichtumgebungssprache oder das Prinzip eine Person/eine Sprache. Das Kapitel beleuchtet außerdem die unbewusste Spracherziehung und die Bedeutung einer klaren Funktion für die Nichtumgebungssprache, um eine stabile Kompetenz in dieser Sprache zu erreichen. Abschließend wird betont, dass bewusste Erziehungsmethoden zu erfolgreicher Zweisprachigkeit führen, während unbewusste Zweisprachigkeitserziehung eher scheitern wird.
Künstlicher bilingualer Erstspracherwerb
Dieses Kapitel beleuchtet den Fall George Saunders, der ein Beispiel für künstlichen bilingualen Erstspracherwerb darstellt. Die Rahmenbedingungen des Falls werden dargestellt und es wird auf die Interpretation und Bewertung des Falles eingegangen. Es werden die Unterschiede zum natürlichen bilingualen Erstspracherwerb hervorgehoben und verschiedene Fördermöglichkeiten für die schwache Sprache im künstlichen bilingualen Erstspracherwerb vorgestellt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem künstlichen bilingualen Erstspracherwerb, der durch das bewusste Erlernen einer zusätzlichen Sprache durch Kinder in einsprachigen Familien geprägt ist. Weitere wichtige Themen sind die Faktoren des bilingualen Erstspracherwerb, die Unterschiede zum natürlichen Erwerb, der Fall George Saunders als Beispiel für künstlichen bilingualen Erstspracherwerb und verschiedene Fördermöglichkeiten für die schwache Sprache. Die Arbeit befasst sich mit Themen wie Spracherziehung, Familiensprache, Umgebungssprache, ethnische Identität, Sprachprestige und Einstellungen zur kindlichen Zweisprachigkeit.
Häufig gestellte Fragen
Was ist künstlicher bilingualer Erstspracherwerb?
Dies beschreibt eine Situation, in der monolinguale Eltern (die dieselbe Muttersprache sprechen) ihr Kind bewusst zweisprachig erziehen, indem sie eine zusätzliche Sprache in den Alltag integrieren.
Wer ist George Saunders im Kontext der Zweisprachigkeit?
George Saunders ist ein bekanntes Fallbeispiel für erfolgreiche künstliche Zweisprachigkeitserziehung, dessen Methoden und Ergebnisse in der Forschung oft als Referenz dienen.
Überfordert eine frühe Zweisprachigkeit das Kind?
Nein, internationale Forschungsergebnisse zeigen, dass Kinder durch bilingualen Erstspracherwerb nicht überfordert werden und sich ihre Sprachkompetenzen ähnlich wie bei monolingualen Kindern entwickeln.
Wie kann die "schwache Sprache" gefördert werden?
Möglichkeiten sind außerfamiliäre Bezugspersonen, gezielte Nutzung von Medien, Reisen ins Ausland, Zusatzunterricht oder der Besuch ausländischer Schulen.
Was ist das Prinzip "eine Person / eine Sprache"?
Es ist eine Erziehungsmethode, bei der jeder Elternteil konsequent nur eine bestimmte Sprache mit dem Kind spricht, um eine klare Trennung und Zuordnung der Sprachen zu ermöglichen.
- Citation du texte
- Yaki Bilmez (Auteur), 2018, Künstlicher bilingualer Erstspracherwerb, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/511459