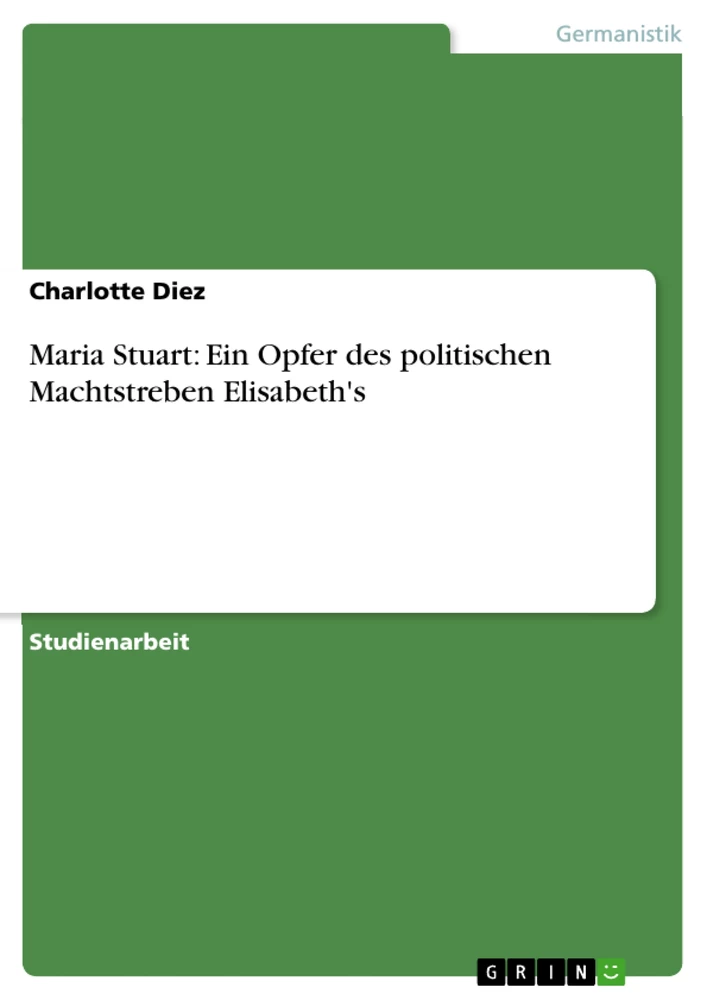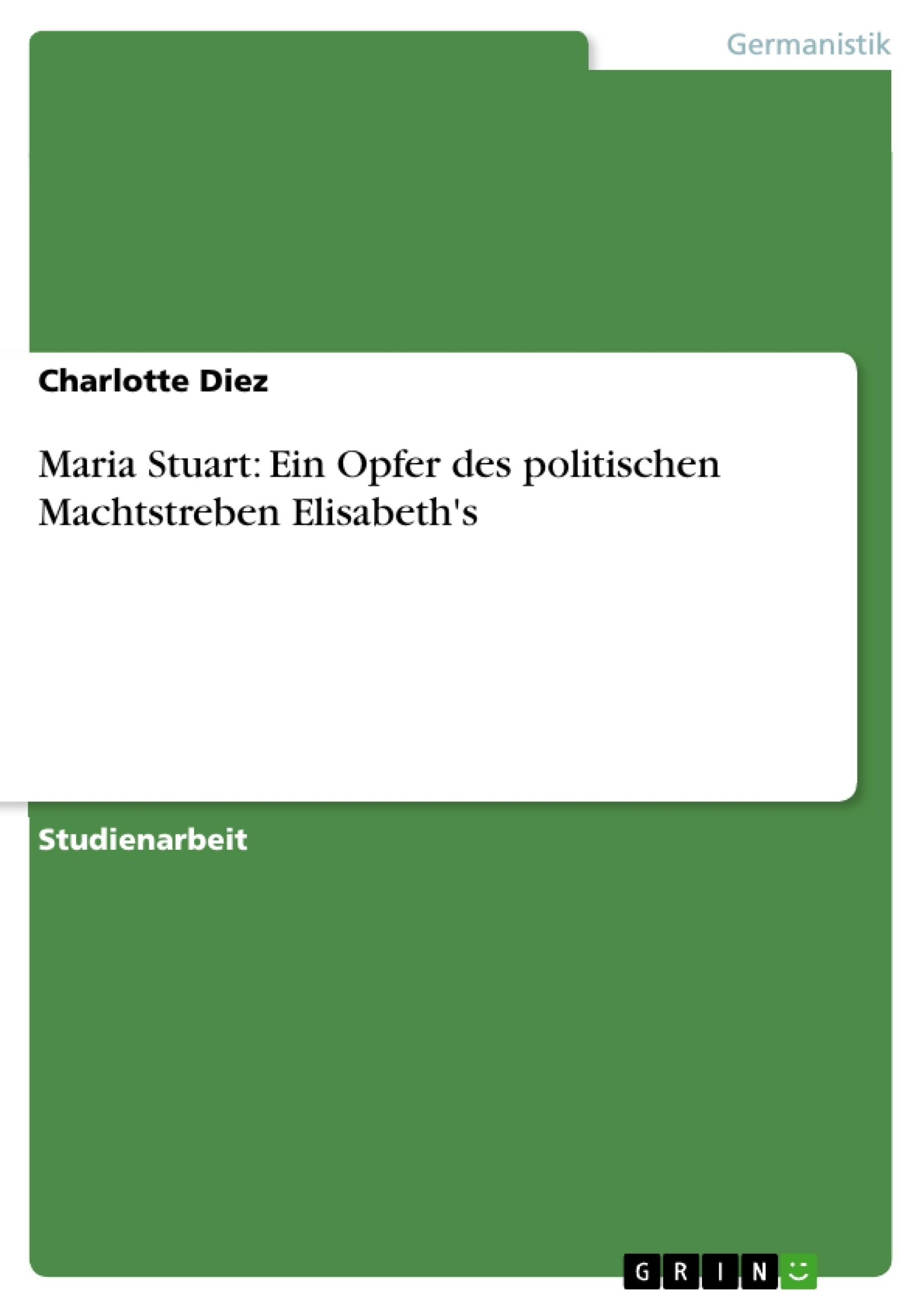Friedrich Schillers poetische und dramatische Begabung wurde durch seine Arbeit als Geschichtsprofessor an der Jenaer Universität, die jetzt seinen Namen trägt, richtungsweisend beeinflußt. Er schuf im Verlaufe seiner Entwicklung das große klassische Geschichtsdrama, womit er die Grundlagen für ein deutsches Nationaltheater setzte, das sich nun von den bis dahin französischen (Molière) und englischen (Shakespeare) Vorbildern befreite. Nach „Don Carlos“ und der gigantischen Dramentriologie „Wallenstein“ entstand im letzten Jahr des 18. Jahrhunderts „Maria Stuart“ und wurde im Juni 1800 in Weimar uraufgeführt. Dieses Trauerspiel stellt erdichtete und tatsächliche historische Vorgänge, private und politische Verwicklungen1an den zwei antipodischen Hauptgestalten Maria und Elisabeth dar. Die Begegnung der beiden Königinnen im dritten Akt ist der Höhepunkt der symmetrischen Antithetik,2zugleich aber auch der psychologischdramatische Schwerpunkt der Tragödie, in welchem das Schicksal Maria Stuarts scheinbar endgültig entschieden wird, worauf wir im Kapitel III.3. näher eingehen. Da, wie bereits erwähnt, historische Tatsachen für Schiller als Grundlage für dieses Drama dienten, ist es wichtig, in die Überlegung, ob Maria Stuart tatsächlich ein Opfer des politischen Machtstreben Elisabeths ist, diese geschichtlichen Hintergründe miteinzubeziehen. In nahezu jeder Sekundärliteratur werden gleich zu Beginn die tatsächlichen historischen Verflechtungen erwähnt, um die konträren Verhaltensweisen der beiden Protagonistinnen zu verdeutlichen. Auch wir versuchen, diese realen Geschehnisse in unsere Argumentation miteinzubeziehen, denen Schillers psychologische Dramaturgie zu Grunde liegen. Natürlich beschreibt die Sekundärliteratur die historischen Vorgänge sehr unterschiedlich. Die Verhaltensweisen von Maria Stuart und Elisabeth werden oft verschieden bewertet, wie auch Marias Schuld am Tode ihres Gatten Darnley. In „Königs Erläuterungen und Materialien“ zu Schillers Maria Stuart wird in keiner Weise erwähnt, daß Maria nie offen auf den englischen Thron verzichtet und dadurch Elisabeth natürlich alarmiert hat. Es wird nur gesagt, daß Elisabeth Marias Bitten um Freundschaft kalt ablehnte, aber nicht, weshalb sie das tat. Wir haben versucht, die Frage, ob Maria Stuart ein Opfer des politischen Machtstreben Elisabeths war, so explizit wie möglich zu klären.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Historischer Verlauf:
- Marias Vorgeschichte - Elisabeths Reaktion
- Entlastungsfaktoren zu Gunsten Marias
- Elisabeth und Maria als Gegenbilder:
- Elisabeths weibliche Eifersucht auf die Schönheit Marias
- Elisabeths politische Machtgelüste
- Begegnung der beiden Königinnen
- Maria als moralische Siegerin:
- Das Todesurteil - Die Unvereinbarkeit von Moral und Politik
- Versuch, die historische Realität zu Schillers „Maria Stuart“ darzustellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Text analysiert Schillers Drama „Maria Stuart“ unter dem Aspekt, ob Maria Stuart tatsächlich ein Opfer von Elisabeths politischem Machtstreben ist. Ziel ist es, anhand historischer Fakten und der Analyse des Dramas, die komplexe Beziehung der beiden Königinnen zu beleuchten und Marias Schicksal in den Kontext der politischen und gesellschaftlichen Realitäten der Zeit zu stellen.
- Das politische Machtspiel zwischen Maria und Elisabeth
- Die Frage nach Marias Schuld und Verantwortlichkeit
- Die Rolle von Geschlecht und Macht im 16. Jahrhundert
- Die Konfrontation zwischen Katholizismus und Protestantismus
- Die Interpretation historischer Ereignisse durch Schiller
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung des Textes stellt den historischen Kontext von Schillers „Maria Stuart“ und dessen Bedeutung für die Entwicklung des deutschen Nationaltheaters dar. Zudem wird die Bedeutung historischer Fakten für die Analyse des Dramas hervorgehoben.
Das Kapitel „Historischer Verlauf“ untersucht die komplizierten dynastischen Ansprüche Marias und Elisabeths auf den englischen Thron. Dabei werden die unterschiedlichen juristischen und historischen Perspektiven auf die Thronfolge und Elisabeths Reaktionen auf Marias Thronanspruch beleuchtet.
Das Kapitel „Entlastungsfaktoren zu Gunsten Marias“ beleuchtet verschiedene Aspekte, die Marias moralische und juristische Position im Drama stärken könnten. So werden Marias Bemühungen, sich mit Elisabeth zu versöhnen, sowie die Aussage der Amme Kennedy im vierten Auftritt des ersten Akts beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter dieses Textes sind: Maria Stuart, Elisabeth I., politisches Machtstreben, Thronanspruch, Katholizismus, Protestantismus, historisches Drama, Schillers „Maria Stuart“, Dynastie, historische Fakten, moralische Schuld, politische Intrigen, Gegenbilder, Geschlechterrollen, Macht und Einfluss.
Häufig gestellte Fragen
Ist Maria Stuart in Schillers Drama ein unschuldiges Opfer?
Die Arbeit untersucht, inwieweit Maria Stuart ein Opfer von Elisabeths politischem Machtstreben ist, beleuchtet aber auch ihre eigene Weigerung, auf den englischen Thron zu verzichten.
Welche Rolle spielt die Eifersucht zwischen den beiden Königinnen?
Neben politischen Motiven thematisiert Schiller die menschlich-weibliche Eifersucht Elisabeths auf Marias Schönheit als psychologischen Antrieb für ihr Handeln.
Gab es die Begegnung zwischen Maria und Elisabeth wirklich?
Nein, die berühmte Begegnung im dritten Akt ist eine Erfindung Schillers, die als psychologisch-dramatischer Höhepunkt der Tragödie dient.
Wie unterscheidet sich die historische Realität von Schillers Drama?
Schiller nutzt historische Fakten als Grundlage, verdichtet und verändert sie jedoch, um die moralischen und politischen Konflikte dramatisch zuzuspitzen.
Warum wird Maria Stuart oft als "moralische Siegerin" bezeichnet?
Trotz ihres Todesurteils gewinnt Maria im Drama an moralischer Größe, während Elisabeth durch ihre politischen Intrigen und ihre Unentschlossenheit an Integrität verliert.
- Citation du texte
- Charlotte Diez (Auteur), 2000, Maria Stuart: Ein Opfer des politischen Machtstreben Elisabeth's, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/51145