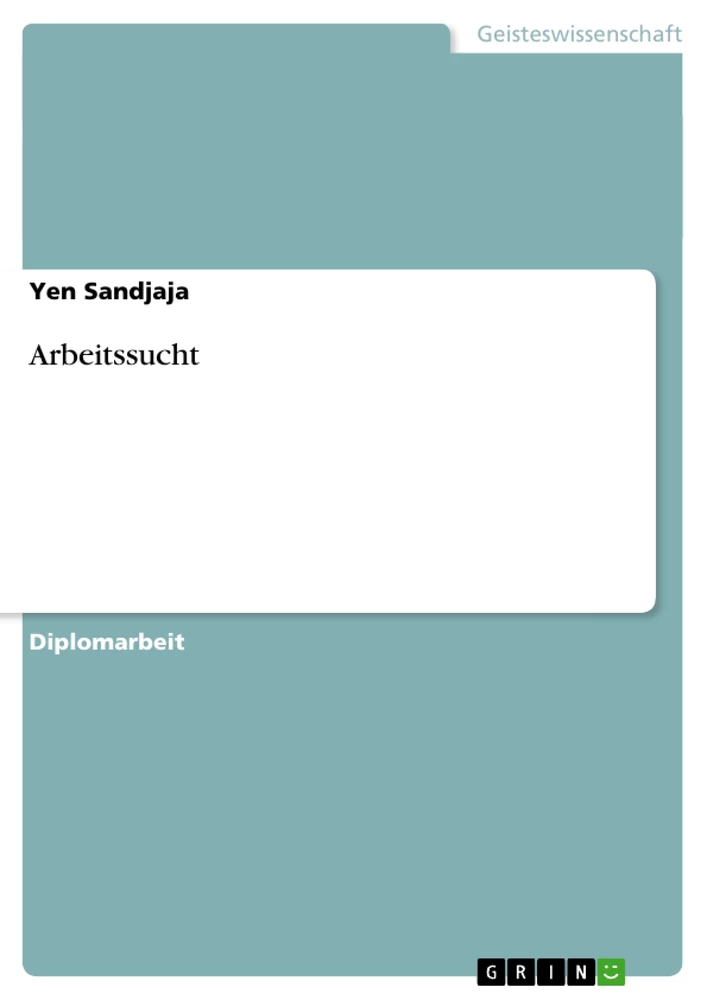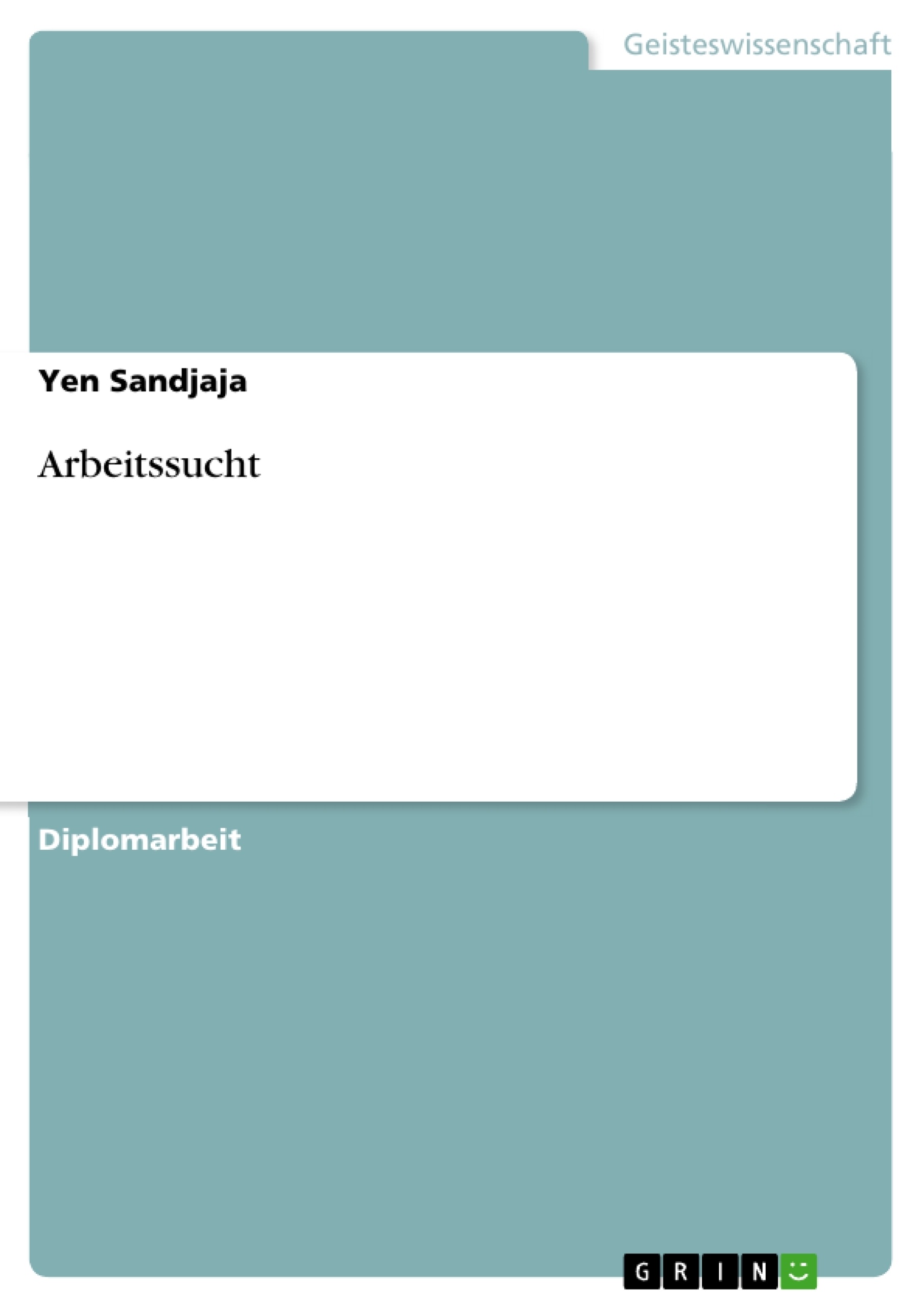Als ich nun nach einem ansprechendem Thema für die vorliegende Diplomarbeit
suchte, ließ ich mich von einem guten Bekannten inspirieren. Er behauptete mit einem Funken Stolz ein „Workaholic“ zu sein. Mit einer gewissen Ungläubigkeit beobachtete ich an ihm, wie viel er arbeitete und stellte ihm die Frage, wie es dazu kommt so viel zu arbeiten. Als antwort erhielt ich die scherzhaft gemeinte doch ernst zu nehmende Aussage, dass er mit seiner Arbeit „verheiratet“ sei und gerne mit seiner „Frau“ zusammen bliebe. Sein Privatleben kommt natürlich zu kurz und findet zwischen Tür und Angel statt. Als defizitär definierte er seinen Lebensumstand nicht, vielleicht weil er berufsbedingt soziale Kontakte zu pflegen hat und weil er wohl über den Alkohol Ablenkung gefunden hat. Den Alkoholismus bekam er vorerst mit Hilfe Dritter in den Griff, doch wurde dabei meiner Ansicht nach die Ursache „Arbeitssucht“ als eigentliches Problem entweder nicht erkannt oder nicht als nennenswert bestätigt. Nun stellt sich berechtigt die Frage, wie ich mich von solch einem Leid habe inspirieren lassen können. Die Antwort kann ich so spontan darauf geben, wie die Frage aufgekommen ist. Zum Einen will ich nicht mit einem Gefühl der Hilflosigkeit (bedingt durch meine Unwissenheit über die Arbeitssucht) zusehen müssen, wie mein guter Bekannter sich arbeitsunfähig oder in den Tod arbeitet. Ich will begreifen, was unter Arbeitssucht zu verstehen ist, um nach Aufdeckung der Ursache und Aufrechterhaltung der Arbeitssucht eine entsprechende Hilfe und/ oder Beratung leisten zu können, wenn diese denn auch erwünscht ist.
Zum Anderen will ich mit dieser vorliegenden Facharbeit Sozialpädagogen und Angehörige verwandter Professionen Kenntnisse über den aktuellen wissenschaftlichen Stand der Arbeitssucht vermitteln. Für meine Intention spricht, dass die Arbeitssucht als stoffungebundene Suchtform bisher nur rudimentär erforscht und beschrieben worden ist. Diesen Zielen folgend, führe ich in die Arbeitssuchtthematik ein, indem ich kläre, was Arbeit für den Menschen bedeutet und welche Entwicklung die Funktionalität der Arbeit
durchgemacht hat. Überdies erläutere ich über den Begriff Sucht, wie Arbeitssucht definiert wird. In der vorliegende Arbeit gebe ich im Anschluss daran einen Überblick über den gegenwärtigen Stand der wissenschaftlichen Auseinandersetzung, wobei ich die Schwerpunkte auf die Diagnostik, Stadien, Typen, Symptome und Folgen der Arbeitssucht gelegt habe.
Inhaltsverzeichnis
- Präambel
- Arbeit und Sucht
- Was Arbeit für den Menschen bedeutet
- Die Funktionalität der Arbeit und ihre Entwicklung
- Differenzierung zwischen Sucht und Arbeitssucht
- Arbeitssucht
- Diagnostik
- Stadien und Symptome der Arbeitssucht
- Erstes Modell der Entwicklung der Arbeitssucht
- Zweites Modell der Entwicklung der Arbeitssucht
- Typen der Arbeitssucht
- Erster exemplarischer Typologisierungsversuch
- Zweiter exemplarischer Typologisierungsversuch
- Folgen für das soziale Umfeld
- Interviews
- Zielsetzung und Hypothesen der Interviews
- Methodik
- Die Interviews
- Auswertung: Themenanalyse
- Themenanalyse zu Interview 1 nach dem Textreduktionsverfahren
- Themenanalyse zu Interview 2 nach dem Textreduktionsverfahren
- Themenanalyse zu Interview 3 nach dem Textreduktionsverfahren
- Themenanalyse zu Interview 4 nach dem Textreduktionsverfahren
- Themenanalyse zu Interview 5 nach dem Textreduktionsverfahren
- Themenanalyse zu Interview 6 nach dem Textreduktionsverfahren
- Themenanalyse zu Interview 7 nach dem Textreduktionsverfahren
- Die Hypothesen auf den Prüfstand
- Vielarbeiter arbeiten nach wirtschaftlichen Prinzipien
- Das Leben des Vielarbeiters ist ganz auf die Arbeit ausgerichtet
- Vielarbeiter wissen mit Muße nichts anzufangen, denn sie arbeiten lieber
- Vielarbeiter wurden vorrangig durch die Eltern und andere erziehungsberechtigte Personen zu Vielarbeitern
- Hilfsmöglichkeiten
- Öffentliche Anlaufstellen
- Therapie
- Allgemeine Anmerkungen zur Therapie
- Das verhaltenstherapeutische Konzept
- Die psychoanalytische Therapie
- Konzept der humanistischen Psychologie
- Eklektizistisches Konzept
- Sozialpädagogik in der Beratung Arbeitssüchtiger und deren sozialem Umfeld
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht das Phänomen der Arbeitssucht. Ziel ist es, Arbeitssucht zu definieren, ihre Ursachen und Folgen zu beleuchten und mögliche Hilfsmöglichkeiten aufzuzeigen. Die Arbeit basiert auf wissenschaftlicher Literatur und qualitativen Interviews.
- Definition und Abgrenzung von Arbeitssucht
- Symptome, Stadien und Typen der Arbeitssucht
- Soziale und psychische Folgen der Arbeitssucht
- Mögliche Therapieansätze
- Rolle der Sozialpädagogik in der Beratung
Zusammenfassung der Kapitel
Präambel: Die Einleitung beschreibt die Motivation der Autorin, sich mit dem Thema Arbeitssucht auseinanderzusetzen, ausgelöst durch die Beobachtung eines Bekannten. Es wird die Notwendigkeit der Forschung zu diesem Thema betont, da Arbeitssucht als stoffungebundene Suchtform bisher wenig erforscht ist. Die Arbeit soll sowohl persönliches Verständnis fördern als auch Sozialpädagogen und verwandte Berufsgruppen informieren.
Arbeit und Sucht: Dieses Kapitel beleuchtet den Begriff „Arbeit“ aus verschiedenen Perspektiven. Es werden philosophische (Hegel, Freud, Marx), psychologische und sozioökonomische Definitionen vorgestellt, die übereinstimmend die Bedürfnisbefriedigung als zentralen Aspekt der Arbeit hervorheben. Die Kapitel differenziert zwischen den Begriffen Sucht und Arbeitssucht. Der Fokus liegt auf dem Verständnis von Arbeit als essentiellem Bestandteil menschlichen Lebens und ihrer komplexen Beziehung zu individuellen Bedürfnissen und gesellschaftlichen Erwartungen.
Arbeitssucht: Dieser Abschnitt bietet einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand zur Arbeitssucht. Es werden Aspekte der Diagnostik, Stadien, Symptome und Typen der Arbeitssucht detailliert behandelt, inklusive verschiedener Modelle der Entwicklung von Arbeitssucht. Die Konsequenzen für das soziale Umfeld von Arbeitssüchtigen werden ebenfalls erörtert, um das komplexe Bild der Suchtform zu verdeutlichen.
Interviews: Das Kapitel beschreibt die Methodik und die Ergebnisse der durchgeführten qualitativen Interviews. Die Autorin erläutert ihre Zielsetzung und Hypothesen, bevor sie die einzelnen Interviews und deren Auswertung nach dem Textreduktionsverfahren darstellt. Die Ergebnisse werden genutzt, um die im vorherigen Kapitel aufgestellten Thesen zu überprüfen.
Schlüsselwörter
Arbeitssucht, Sucht, Arbeit, Diagnostik, Symptome, Therapie, Sozialpädagogik, qualitative Interviews, Bedürfnisbefriedigung, soziale Folgen, Vielarbeiter.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Arbeitssucht
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Diese Diplomarbeit untersucht das Phänomen der Arbeitssucht. Sie definiert Arbeitssucht, beleuchtet Ursachen und Folgen und zeigt mögliche Hilfsmöglichkeiten auf. Die Arbeit basiert auf wissenschaftlicher Literatur und qualitativen Interviews.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunkte: Definition und Abgrenzung von Arbeitssucht, Symptome, Stadien und Typen der Arbeitssucht, soziale und psychische Folgen der Arbeitssucht, mögliche Therapieansätze und die Rolle der Sozialpädagogik in der Beratung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel: Eine Präambel, die den Ausgangspunkt der Arbeit beschreibt. Ein Kapitel über Arbeit und Sucht, welches den Begriff „Arbeit“ aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet und Sucht von Arbeitssucht abgrenzt. Ein Kapitel über Arbeitssucht selbst, welches Diagnostik, Stadien, Symptome und Typen detailliert behandelt. Ein Kapitel zu Interviews, mit Methodik, Auswertung und Überprüfung der Hypothesen. Abschließend ein Kapitel über Hilfsmöglichkeiten mit Fokus auf Therapieansätze und die Rolle der Sozialpädagogik.
Welche Methodik wurde verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf wissenschaftliche Literatur und qualitative Interviews. Die Interviews wurden nach dem Textreduktionsverfahren ausgewertet, um die Hypothesen der Autorin zu überprüfen. Die Hypothesen selbst betreffen unter anderem die wirtschaftlichen Prinzipien im Handeln von Vielarbeitern, deren Lebensausrichtung und die Rolle der Erziehung.
Welche konkreten Fragen werden in den Interviews untersucht?
Die Interviews untersuchen, ob Vielarbeiter nach wirtschaftlichen Prinzipien arbeiten, ob ihr Leben ganz auf die Arbeit ausgerichtet ist, ob sie mit Muße nichts anfangen können und ob sie vorrangig durch Eltern und Erziehungsberechtigte zu Vielarbeitern wurden.
Welche Therapieansätze werden diskutiert?
Die Arbeit diskutiert verschiedene Therapieansätze, darunter verhaltenstherapeutische Konzepte, die psychoanalytische Therapie, Konzepte der humanistischen Psychologie und ein eklektizistisches Konzept. Zusätzlich wird die Rolle der Sozialpädagogik in der Beratung von Arbeitssüchtigen und deren sozialem Umfeld behandelt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Arbeitssucht, Sucht, Arbeit, Diagnostik, Symptome, Therapie, Sozialpädagogik, qualitative Interviews, Bedürfnisbefriedigung, soziale Folgen, Vielarbeiter.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit basiert auf wissenschaftlicher Literatur und qualitativen Interviews. Konkrete Quellenangaben sind im Haupttext der Diplomarbeit zu finden.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Sozialpädagogen, verwandte Berufsgruppen, Personen, die sich mit dem Thema Arbeitssucht auseinandersetzen möchten und alle, die an einem besseren Verständnis des Phänomens interessiert sind.
- Citation du texte
- Yen Sandjaja (Auteur), 2005, Arbeitssucht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/51156