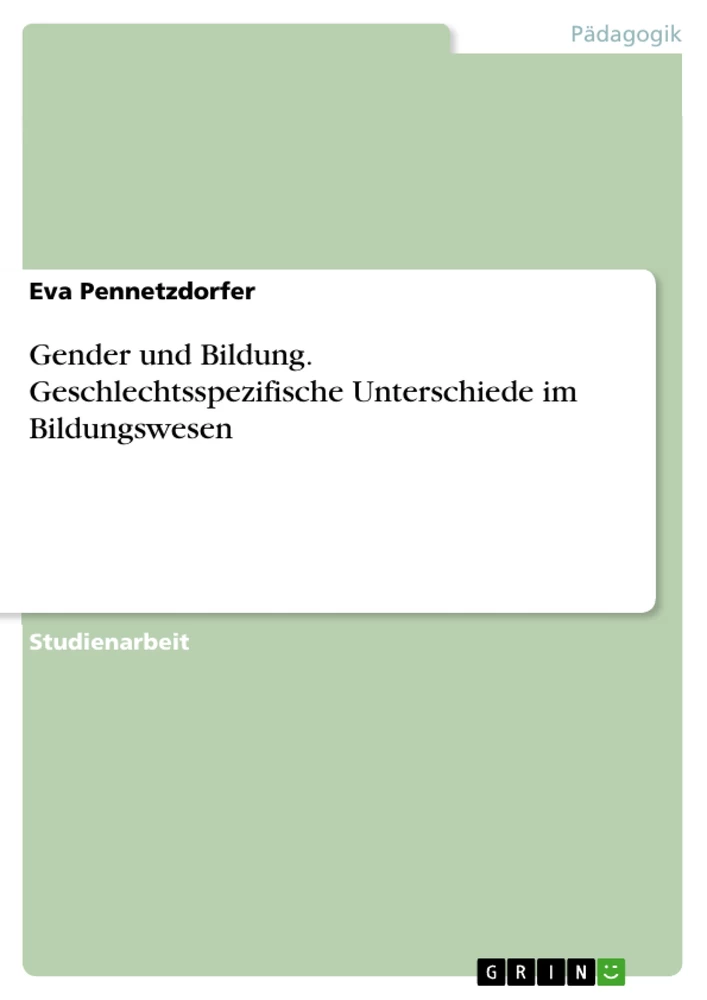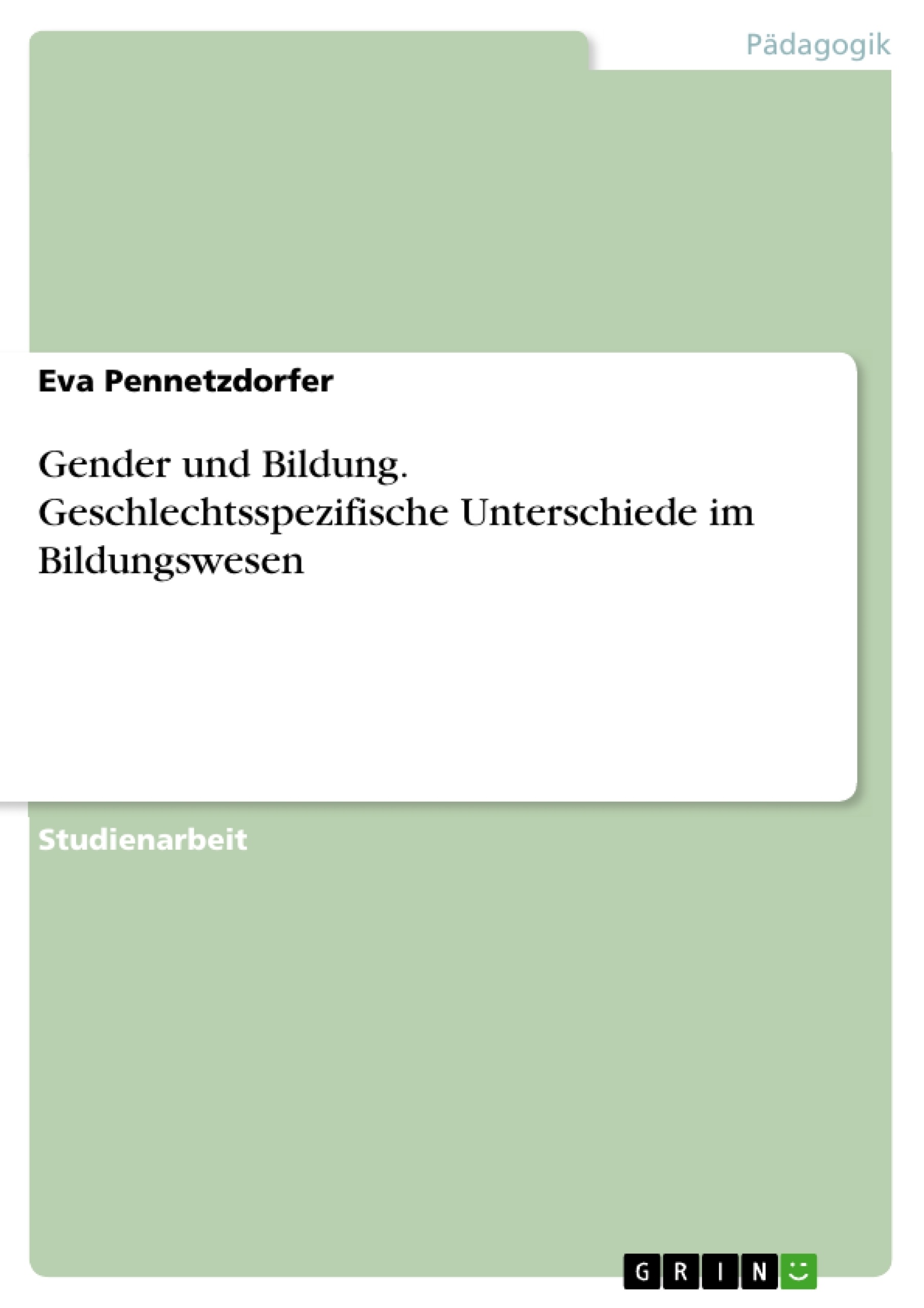In dieser Seminararbeit werden zu Beginn die Begriffsdefinitionen von Gender und Geschlecht sowie deren Unterschiede erklärt. Danach werden die Geschlechterunterschiede in der Bildungswahl durch eine Tabelle näher erläutert. Im darauffolgenden Punkt geht es um geschlechtsspezifische Schulleistungen, wobei hier näher auf die Leseleistung und auf Mathematik und Naturwissenschaften eingegangen wird. Im Anschluss werden mögliche Ursachen der Geschlechterunterschiede im Bildungserfolg erläutert und der letzte Punkt der Arbeit handelt von der Geschlechtergerechtigkeit in der Schule. Den Schluss der Seminararbeit bildet ein persönliches Resümee, das sich nach der Bearbeitung des Themas eingestellt hat.
Die Diskussion um das Genderthema im Bildungswesen ist bereits seit einigen Jahren präsent. Mit einem steigenden Frauenanteil, unter dem Schlagwort "Feminisierung des Lehrerberufs", werden negative Entwicklungen im Bildungswesen in Verbindung gebracht. Es ist die Rede von der Bevorzugung von Mädchen, einer "Verweiblichung" des Schulklimas und von einer Diskriminierung der Buben. Durch die PISA-Ergebnisse sowie durch den ersten nationalen Bildungsbericht wurde die Aufmerksamkeit auf die neue Problemthematik gelenkt: "Jungen sind in der Schule weniger erfolgreich als Mädchen." PISA hat im Gegensatz zu Deutschland in Österreich nur ein sehr geringes mediales und politisches Echo ausgelöst. Dies ist jedoch überraschend, da das österreichische Bildungssystem bekanntlich stark selektiv ist und die Bildungschancen auch davon abhängen, welches Geschlecht man hat.
In Europa ist die Gleichstellung der beiden Geschlechter bereits seit längerem ein wichtiges gestecktes Ziel. 1970 wurde bereits damit begonnen, einen Grundstein für die Gleichbehandlung und die Chancengleichheit der Geschlechter in Europa zu setzen. Doch die Umsetzung bereitet immer noch große Schwierigkeiten. In den meisten Staaten bilden die Frauen an den Hochschulen und Universitäten zwar die Mehrheit, jedoch ist ihr Verdienst im späteren Beruf im Gegensatz zu den Männern immer noch geringer. In der Allgemein- und Berufsbildung gibt es ebenfalls geschlechtsspezifische Unterschiede in Bezug auf den Bildungserfolg und die Wahl der Bildungsgänge. Über die letzten Jahrzehnte hinweg gab es starke Veränderungen, wenn man die Differenzen zwischen den Geschlechtern in der Bildung betrachtet und sie sind im Zusammenhang mit dem Bildungserfolg auch komplexer geworden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Unterschiedliche Auffassungen von Gender, Geschlecht und Geschlechterunterschieden
- Geschlechterunterschiede in der Bildungswahl
- Geschlechtsspezifische Schulleistungen
- Geschlechtsspezifische Muster in den Leseleistungen
- Geschlechtsspezifische Muster in Mathematik und Naturwissenschaften
- Ursachen der Geschlechterunterschiede im Bildungserfolg
- Geschlechtergerechtigkeit in der Schule
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit dem Genderthema im Bildungswesen und untersucht die Auswirkungen geschlechtsspezifischer Unterschiede auf die Bildungswahl und den Bildungserfolg. Die Arbeit befasst sich mit den unterschiedlichen Auffassungen von Gender und Geschlecht, analysiert die geschlechtsspezifischen Muster in den Schulleistungen, insbesondere in den Bereichen Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften, und diskutiert mögliche Ursachen für diese Unterschiede. Schließlich wird der Fokus auf die Förderung von Geschlechtergerechtigkeit in der Schule gelegt.
- Geschlechterunterschiede in der Bildungswahl und -erfolg
- Unterschiedliche Auffassungen von Gender und Geschlecht
- Geschlechtsspezifische Muster in den Schulleistungen
- Ursachen für geschlechtsspezifische Unterschiede im Bildungserfolg
- Förderung von Geschlechtergerechtigkeit in der Schule
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas Gender im Bildungswesen dar und beleuchtet die Diskussion um die „Feminisierung des Lehrerberufs“ und die daraus resultierenden negativen Entwicklungen. Die PISA-Ergebnisse und der erste nationale Bildungsbericht lenken die Aufmerksamkeit auf die Unterschiede im Bildungserfolg zwischen Jungen und Mädchen. Es wird deutlich, dass das österreichische Bildungssystem selektiv ist und die Bildungschancen vom Geschlecht abhängig sind.
Kapitel 2 befasst sich mit den Begriffen „Geschlecht“ und „Gender“ und erläutert die unterschiedlichen Ansätze zur Betrachtung der geschlechtsspezifischen Unterschiede in der Bildung. Es werden zwei verschiedene Ansätze vorgestellt: Der erste Ansatz betrachtet die Unterschiede zwischen Männern und Frauen als biologisch bedingt und unveränderlich. Der zweite Ansatz hingegen sieht die sozialen Rollen der Geschlechter als veränderbar und abhängig von historischen, gesellschaftlichen und kulturellen Einflüssen.
Kapitel 3 analysiert die Geschlechterunterschiede in der Bildungswahl anhand einer Studie des Österreichischen Instituts für Berufsbildungsforschung (öibf). Die Studie untersucht die Motive und Hintergründe für die Entscheidung eines Bildungsweges und zeigt, dass Mädchen im Vergleich zu Jungen eine höhere Chance haben, eine AHS-Unterstufe zu besuchen. Die Unterschiede steigen in der Sekundarstufe I an, da Jungen häufiger die Unterstufe wiederholen und aussteigen.
Kapitel 4 beleuchtet die geschlechtsspezifischen Muster in den Schulleistungen, wobei der Fokus auf den Bereichen Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften liegt. Es wird aufgezeigt, dass Mädchen in der Regel bessere Leseleistungen erbringen, während Jungen im Bereich Mathematik und Naturwissenschaften stärker vertreten sind. Die Ursachen für diese Unterschiede werden in Kapitel 5 diskutiert.
Schlüsselwörter
Gender, Geschlecht, Bildungswesen, Bildungswahl, Bildungserfolg, Schulleistung, Leseleistung, Mathematik, Naturwissenschaften, Geschlechtergerechtigkeit, Geschlechterstereotypisierung, soziale Rollen, biologische Faktoren, kulturelle Einflüsse, Bildungschancen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen "Gender" und "Geschlecht"?
Geschlecht bezieht sich meist auf biologische Merkmale, während Gender die soziale Geschlechterrolle beschreibt, die durch Kultur und Gesellschaft geprägt und veränderbar ist.
Sind Jungen heute die "Bildungsverlierer"?
PISA-Ergebnisse zeigen, dass Jungen in der Schule oft weniger erfolgreich sind als Mädchen, häufiger Klassen wiederholen und geringere Leseleistungen erbringen.
Was versteht man unter der "Feminisierung des Lehrerberufs"?
Damit ist der steigende Frauenanteil im Lehrkörper gemeint, der in der öffentlichen Diskussion teils mit einer Benachteiligung von Jungen und einer "Verweiblichung" des Schulklimas verknüpft wird.
Warum verdienen Frauen trotz oft besserer Bildung später weniger?
Obwohl Frauen an Hochschulen oft die Mehrheit bilden, führen geschlechtsspezifische Berufswahlen und gesellschaftliche Strukturen dazu, dass ihr späterer Verdienst oft geringer ausfällt als der von Männern.
Wie kann Geschlechtergerechtigkeit in der Schule gefördert werden?
Durch die Reflexion von Geschlechterstereotypen im Unterricht, eine bewusste Bildungswahlberatung und die Schaffung eines Schulklimas, das individuelle Potenziale unabhängig vom Geschlecht fördert.
- Arbeit zitieren
- Eva Pennetzdorfer (Autor:in), 2017, Gender und Bildung. Geschlechtsspezifische Unterschiede im Bildungswesen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/511734