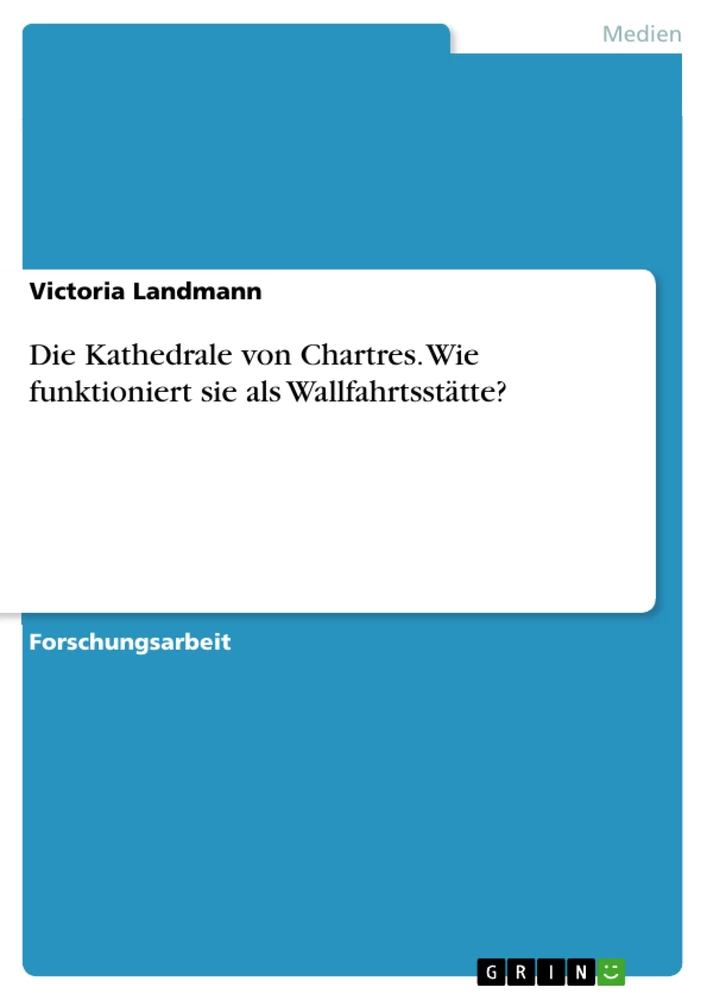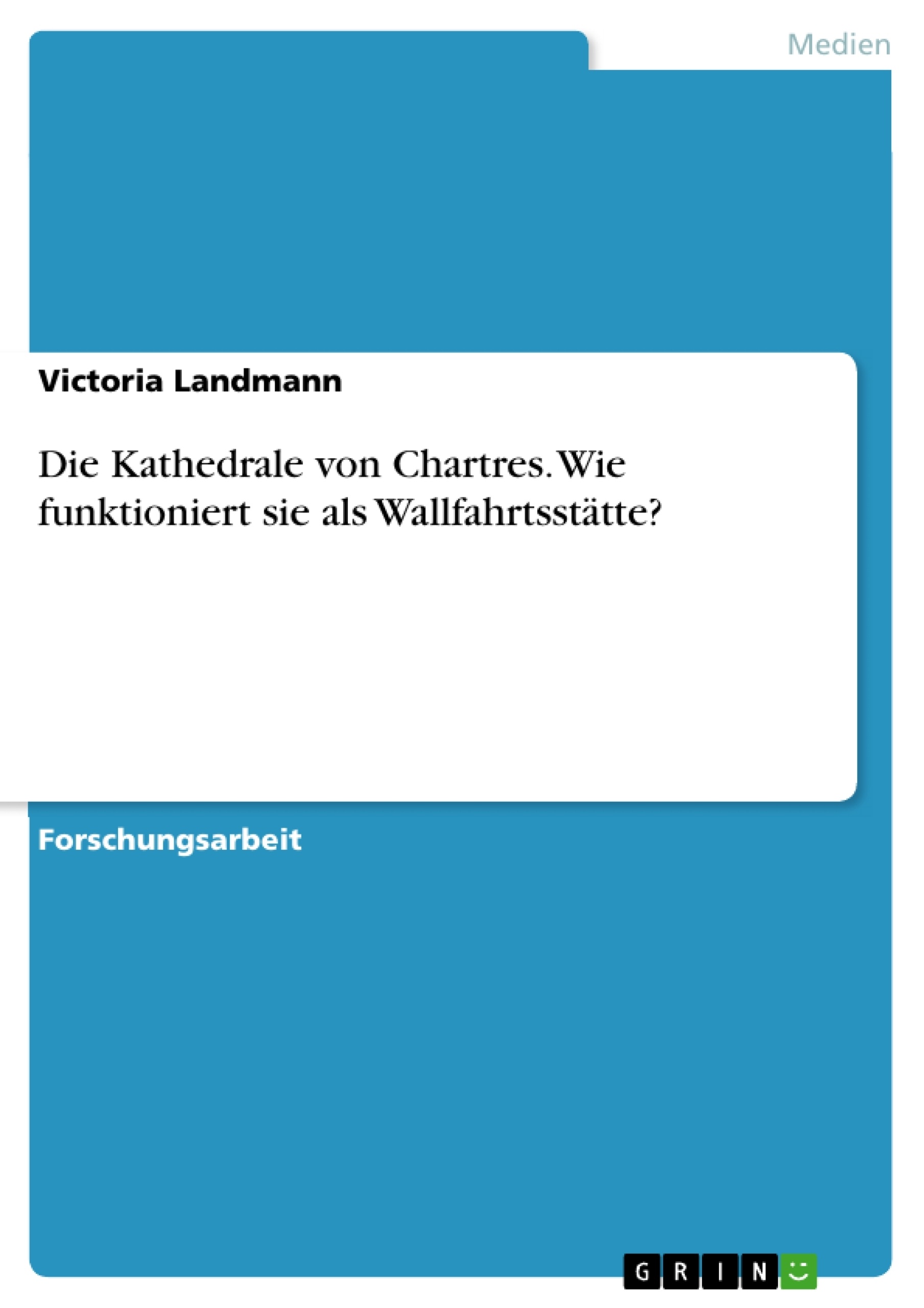Das Ziel dieser Arbeit ist zu untersuchen, wie die Kathedrale von Chartres als Wallfahrtskirche funktioniert. Hierbei steht die Heilige Jungfrau und deren Heilsbotschaft, die sie durch ihre multimediale Präsenz im äußeren und inneren der Kathedrale an die Gläubigen richtet, im Mittelpunkt.
„So wächst aus urgrauen Tagen die Kathedrale empor: Wie sie mit ihrer Krypta tief in der Erde wurzelt, so wurzelt sie in der Zeit; weiterhin überragt sie die Landschaft, die ihr das beste Ihres Wesens zugetragen hat, und mit ihren Türmen stößt sie an den Himmel. Wenn man es nirgends sonst erführe, hier erfährt man es, dass die Wahrheit und die Schönheit von uns nie begriffen, sondern nur erpilgert werden können.“ Diese ekstatischen Zeilen schrieb einst der Dichter Charles Péguy (1873-1914), der 1912 zur Kathedrale Nôtre-Dame von Charters pilgerte um zu beten, dass sein Sohn vom Typhus geheilt werde und dort Erlösung fand.
Bereits seit Jahrhunderten gilt die dreischiffige Kreuzbasilika, welche nach einem Brand der romanischen Kirche im Jahre 1194 neu errichtet wurde, als wichtigster Marienwallfahrtsort von Frankreich. Hier tritt die Jungfrau nicht nur als Schutzpatronin in Erscheinung. Der gesamte Bau ist von zahlreichen, sich wiederholenden Darstellungen der Muttergottes durchzogen, die auf die übergeordnete Bedeutung der Mutterfigur hinweisen wollen. Dabei wird man in der Kathedrale mit Maria nicht nur durch ihre verehrten Reliquien und Kultbilder konfrontiert, sondern auch durch die Reliefs an den Außenportalen und in den biblischen Erzählungen der überaus bedeutsamen Glasmalereien. Der Ursprung dieses Marien-Kanons in Chartres liegt dabei in einem nicht eindeutig bestätigten Kult um eine Mutterfigur mit Kind, der so genannten Virgo paritura, die schon in vorchristlicher Zeit in Charters verehrt worden sein soll, jedoch die Marienverehrung und die Bedeutung der Kathedrale als Marienwallfahrtsstätte maßgeblich geprägt hat.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Forschungsstand
- 3. Reliquien und Kultbilder in der Kathedrale von Chartres
- 3.1 Der Marienkult um die Marienreliquie von Chartres
- 3.2 Die Legende der Virgo Paritura
- 4. Die Wiederspieglung Mariens in der Architektur und Glasmalerei
- 4.1 Der Multimediale Ausdruck der Kathedrale
- 4.2 Der Westkomplex
- 4.2.1 Die Muttergottes am Königsportal
- 4.2.2 Maria in den Glasmalereien der Westfassade
- 4.3 Der Nordkomplex
- 4.3.1 Maria und Anna am nördlichen Querhaus
- 4.3.2 Maria und Anna in der Glasmalereien des nördlichen Querhauses
- 4.4 Das Südkomplex
- 4.4.1 Die Madonnen der drei Giebelreliefs der südlichen Portalanlage
- 4.4.2 Maria in der Glasmalereien des südlichen Querhauses
- 4.5 Der Chor
- 4.5.1 Maria in den sieben Apsisfenstern
- 4.5.2 Die Nôtre-Dame de la Belle-Verrière
- 5. Der mittelalterliche Pilgerweg durch die Kathedrale
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Forschungsarbeit untersucht die Funktion der Kathedrale von Chartres als Wallfahrtskirche, mit besonderem Fokus auf die Darstellung der Jungfrau Maria und deren Heilsbotschaft. Die Arbeit beleuchtet den Zusammenhang zwischen Kirchenbau und Wallfahrt in Chartres und analysiert die multimediale Präsenz Mariens im Innen- und Außenraum der Kathedrale.
- Die Bedeutung der Marienreliquie (Heiliges Hemd) für den Marienwallfahrtsort Chartres.
- Die Rolle der Legende der Virgo Paritura für den Marienkulkt in Chartres.
- Die Darstellung Mariens in Architektur und Glasmalerei der Kathedrale.
- Die Analyse der Marien-Darstellungen an den Portalen (West-, Nord- und Südportal).
- Der mittelalterliche Pilgerweg durch die Kathedrale.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beginnt mit einem Zitat von Charles Péguy, das die Kathedrale von Chartres als Ort der Erlösung und Pilgerfahrt beschreibt. Sie führt in die Thematik der Kathedrale als wichtigster Marienwallfahrtsort Frankreichs ein und benennt die zentrale Rolle der Jungfrau Maria und deren vielschichtige Darstellung im Bauwerk. Der Fokus liegt auf der Untersuchung der Funktion der Kathedrale als Wallfahrtskirche und der multimedialen Präsenz Mariens, die die Gläubigen erreichen soll. Die Arbeit skizziert den Untersuchungsweg, beginnend mit den Gründen für die Pilgerfahrten nach Chartres und dem unauflöslichen Verhältnis von Kirchenbau und Wallfahrt, um dann die Darstellung der Madonna in Architektur und Glasmalerei zu untersuchen.
2. Forschungsstand: Dieses Kapitel beschreibt die verwendeten Quellen und Literatur für die Forschungsarbeit. Es werden wichtige Werke zur Marienthematik, zum Königsportal, den Querhäusern und zur Glasmalerei der Kathedrale von Chartres genannt, inklusive spezifischer Beiträge von Roland Halfen und Bruno Boerner. Der Schwerpunkt liegt auf den Werken von Colette und Jean-Paul Deremble bezüglich der Glasmalereien und deren Ikonografie, einschließlich ihres Beitrags zu dem Sammelband "Chartres, La Grâce d'une Cathédrale". Die Ausführungen von Colette Deremble aus der Reihe des französischen Corpus Vitrearum werden ebenfalls als bedeutsam hervorgehoben.
3. Reliquien und Kultbilder in der Kathedrale von Chartres: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Marienkult in Chartres und der Bedeutung der Marienreliquie, dem "Heiligen Hemd" (la Sainte chemise). Es beschreibt die Legende um die Reliquie, deren Stiftung durch Karl den Kahlen und den damit verbundenen Legenden und Wunderheilungen. Die Diskussion umfasst unterschiedliche Interpretationen der Geschichte der Reliquie, einschließlich der Frage, ob Karl der Kahle sie Karl dem Großen geschenkt bekam oder sie unerlaubt entwendete. Das Kapitel legt den Grundstein für die weitere Analyse der Marienverehrung in Chartres, indem es die historische und legendäre Bedeutung der Reliquie in den Kontext der Kathedrale stellt.
Schlüsselwörter
Kathedrale von Chartres, Marienwallfahrt, Jungfrau Maria, Marienreliquie, Virgo Paritura, Glasmalerei, Architektur, Königsportal, Querhäuser, Multimediale Darstellung, Heilsbotschaft, Kultbild, Pilgerweg, Mittelalter.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Forschungsarbeit: Die Jungfrau Maria in der Kathedrale von Chartres
Was ist der Gegenstand der Forschungsarbeit?
Die Forschungsarbeit untersucht die Kathedrale von Chartres als Marienwallfahrtskirche und analysiert die multimediale Darstellung der Jungfrau Maria im Kirchenbau. Der Fokus liegt auf dem Zusammenhang zwischen Kirchenbau, Wallfahrt und der Heilsbotschaft Mariens.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Bedeutung der Marienreliquie ("Heiliges Hemd"), die Legende der Virgo Paritura, die Darstellung Mariens in Architektur und Glasmalerei (insbesondere an den West-, Nord- und Südportalen und im Chor), den mittelalterlichen Pilgerweg durch die Kathedrale und den Marienkulkt in Chartres.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Forschungsstand, Reliquien und Kultbilder in der Kathedrale von Chartres, Die Wiederspieglung Mariens in der Architektur und Glasmalerei, Der mittelalterliche Pilgerweg durch die Kathedrale und Fazit.
Welche Quellen wurden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf diverse Quellen zur Marienthematik, zum Königsportal, den Querhäusern und zur Glasmalerei der Kathedrale von Chartres. Besonders hervorgehoben werden die Werke von Roland Halfen, Bruno Boerner, und Colette und Jean-Paul Deremble (insbesondere deren Beiträge zu "Chartres, La Grâce d'une Cathédrale" und dem französischen Corpus Vitrearum).
Welche Rolle spielt die Marienreliquie ("Heiliges Hemd")?
Die Marienreliquie, das "Heilige Hemd", spielt eine zentrale Rolle im Marienwallfahrtsort Chartres. Die Arbeit untersucht die Legende um die Reliquie, deren Stiftung durch Karl den Kahlen und deren Bedeutung für den Marienkulkt.
Wie wird Maria in der Architektur und Glasmalerei dargestellt?
Die Arbeit analysiert die Darstellungen Mariens an den verschiedenen Portalen (West-, Nord- und Südportal) und im Chor der Kathedrale. Dabei wird die multimediale Präsenz Mariens im Innen- und Außenraum untersucht und deren Wirkung auf die Gläubigen beleuchtet.
Was ist die Bedeutung des mittelalterlichen Pilgerwegs?
Die Arbeit untersucht den mittelalterlichen Pilgerweg durch die Kathedrale von Chartres und dessen Bedeutung im Kontext der Marienverehrung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Kathedrale von Chartres, Marienwallfahrt, Jungfrau Maria, Marienreliquie, Virgo Paritura, Glasmalerei, Architektur, Königsportal, Querhäuser, Multimediale Darstellung, Heilsbotschaft, Kultbild, Pilgerweg, Mittelalter.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Funktion der Kathedrale von Chartres als Wallfahrtskirche zu untersuchen, mit besonderem Fokus auf die Darstellung der Jungfrau Maria und deren Heilsbotschaft. Es wird der Zusammenhang zwischen Kirchenbau und Wallfahrt analysiert.
Gibt es eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Ja, die Arbeit enthält eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel, die die jeweiligen Inhalte und Schwerpunkte detailliert beschreibt.
- Citar trabajo
- Victoria Landmann (Autor), 2018, Die Kathedrale von Chartres. Wie funktioniert sie als Wallfahrtsstätte?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/511812