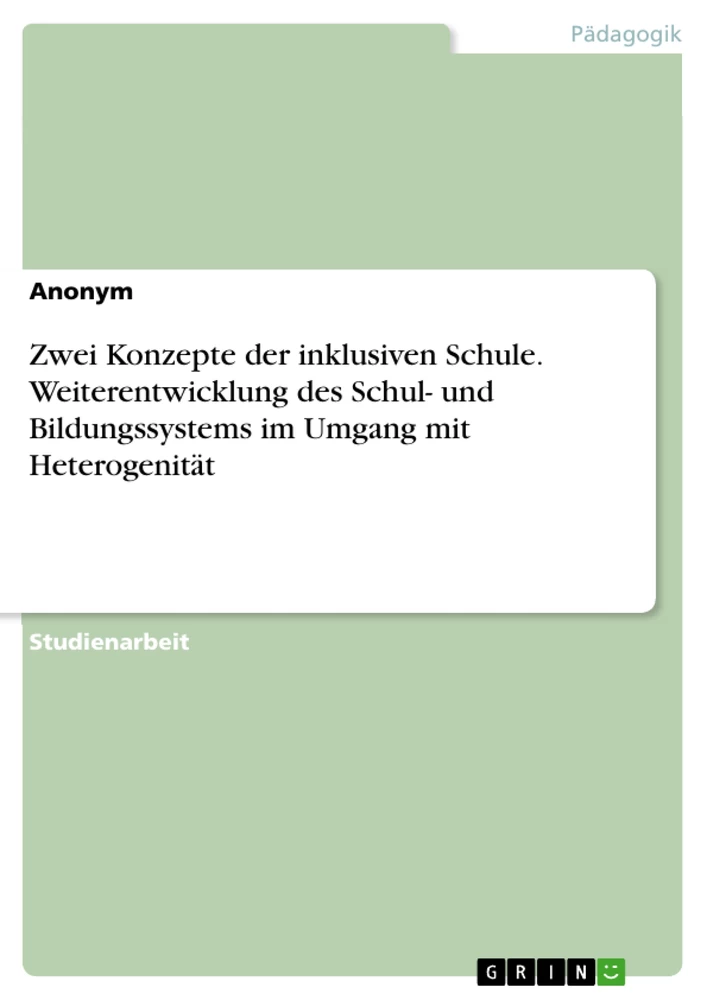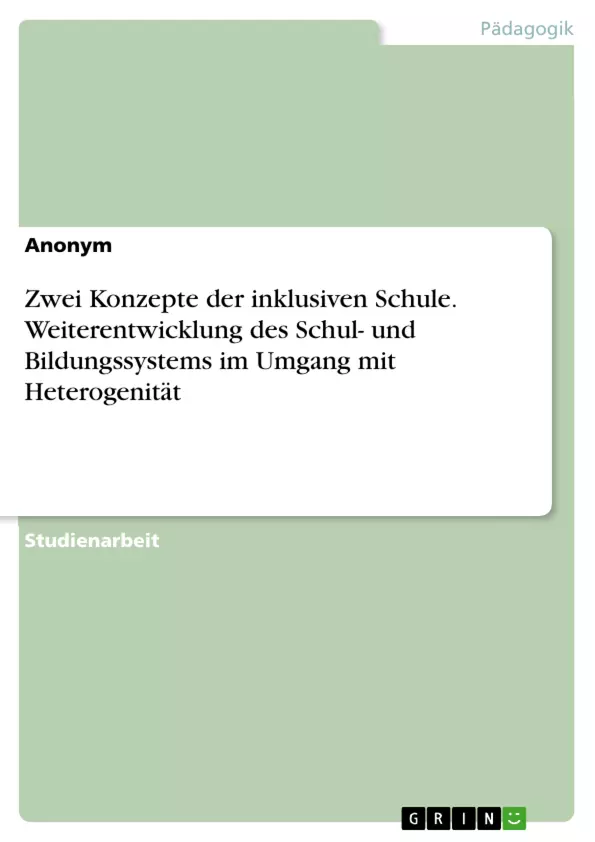Katzenbach und Schroeder haben zwei Konzepte dargelegt, wie das Schul- und Bildungssystem im Umgang mit Heterogenität weiterentwickelt werden kann. In dieser Hausarbeit werden die beiden Konzepte gegenübergestellt und es wird der Frage nachgegangen, ob diese Konzepte unabhängig voneinander funktionieren oder ob sie sich gegenseitig ergänzen. Der erste Teil der Arbeit beschreibt das Recht auf Bildung, welches im Kontext der inklusiven Pädagogik einen besonderen Stellenwert einnimmt und die Basis aller pädagogischen und konzeptionellen Bemühungen in der Inklusionspädagogik darstellt. Das Recht auf Bildung wird konkretisiert im Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, welches im weiteren Verlauf der Arbeit dargelegt wird. Daran schließt sich eine Definition der relevanten Begrifflichkeiten Inklusion und Heterogenität an. In einem nächsten Schritt wird der Zustand des deutschen Bildungssystems betrachtet. Der Hauptteil der Arbeit stellt die Konzepte "die Inklusive Schule - eine Schule für alle Kinder und die lebenslagenorientierten Profilbildungen - Milieusensible Bildungslandschaften" dar. Im abschließenden Fazit werden die Ergebnisse der Arbeit zusammengefasst und die eingangs gestellte Frage beantwortet.
Inklusive Pädagogik beschreibt erziehungswissenschaftliche Ansätze, die einen erfolgreichen Umgang mit der Vielfalt von Kindern und Jugendlichen im schulischen Kontext anstreben. So können Behinderungen, Armut oder Migrationshintergründe Gefahren von Ausgrenzungen darstellen, sodass das Ausschöpfen ihres vollen Lernpotenzials nicht gewährleistet werden kann. Vor dem Hintergrund unseres mehrgliedrigen und hochselektierenden Schulsystems in Deutschland ist es naheliegend, dass der Umgang mit Heterogenität gegenwärtig eine der zentralen Herausforderungen des deutschen Bildungssystems ist. Dabei ist Heterogenität im schulischen Kontext kein neues Phänomen. Schon im Jahr 1806 stellte der Pädagoge Johann Friedrich Herbart fest, dass "[d]ie Verschiedenheit der Köpfe [..] das größte Hindernis aller Schulbildungen" darstellt. Das deutsche Schulsystem steht aktuell vor der großen Aufgabe, allen Kindern und Jugendlichen das gleiche Recht auf Bildung und die gleichen Zugangschancen zu Schulen zu gewährleisten. Die Inklusionspädagogik hat sich das Ziel gesetzt, die Teilhabe aller Menschen unabhängig von Geschlecht, Alter, Herkunft, Religionszugehörigkeit, Bildung, eventuellen Behinderungen oder individuellen Merkmalen zu ermöglichen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Menschenrechte als zentrales Instrument zur Verwirklichung von Chancengleichheit im Bildungssystem
- 3. Begriffsdefinition
- 3.1 Inklusion
- 3.2 Heterogenität
- 4. Zum Zustand des deutschen Bildungssystems
- 5. Visionäre Konzepte zur Entwicklung der Inklusionspädagogik
- 5.1 Die Inklusive Schule - Eine Schule für alle Kinder
- 5.2 Lebenslagenorientierte Profilbildungen
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Konzept der Inklusiven Schule und untersucht zwei visionäre Konzepte zur Entwicklung der Inklusionspädagogik. Die Arbeit zielt darauf ab, die Konzepte von Katzenbach und Schroeder zu vergleichen und zu analysieren, ob sie sich gegenseitig ergänzen oder unabhängig voneinander funktionieren.
- Das Recht auf Bildung im Kontext der inklusiven Pädagogik
- Die Bedeutung des Übereinkommens über die Rechte von Menschen mit Behinderungen
- Definition der zentralen Begriffe Inklusion und Heterogenität
- Der aktuelle Zustand des deutschen Bildungssystems
- Die Konzepte "Die Inklusive Schule - Eine Schule für alle Kinder" und "Lebenslagenorientierte Profilbildungen"
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung Dieses Kapitel führt in das Thema der Inklusiven Schule ein und stellt die zentralen Forschungsfragen der Arbeit vor. Es wird die Bedeutung des Rechts auf Bildung im Kontext der Inklusionspädagogik hervorgehoben und auf das Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen verwiesen.
- Kapitel 2: Menschenrechte als zentrales Instrument zur Verwirklichung von Chancengleichheit im Bildungssystem Dieses Kapitel beleuchtet die zentrale Bedeutung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und des Übereinkommens über die Rechte von Menschen mit Behinderungen für die Verwirklichung von Chancengleichheit im Bildungssystem.
- Kapitel 3: Begriffsdefinition Dieses Kapitel liefert Definitionen der zentralen Begriffe Inklusion und Heterogenität.
- Kapitel 4: Zum Zustand des deutschen Bildungssystems Dieses Kapitel analysiert den aktuellen Zustand des deutschen Bildungssystems und die Herausforderungen, die sich aus der Heterogenität der Schülerschaft ergeben.
- Kapitel 5: Visionäre Konzepte zur Entwicklung der Inklusionspädagogik Dieses Kapitel stellt die beiden Konzepte "Die Inklusive Schule - Eine Schule für alle Kinder" und "Lebenslagenorientierte Profilbildungen" vor und untersucht ihre Funktionsweise.
Schlüsselwörter
Die Hausarbeit beschäftigt sich mit den Themen Inklusion, Chancengleichheit, Bildungssystem, Menschenrechte, Heterogenität, Inklusive Schule, Lebenslagenorientierte Profilbildungen, Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen und Bildungslandschaften.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Inklusion und Heterogenität?
Heterogenität beschreibt die tatsächliche Vielfalt (Herkunft, Behinderung, Alter), während Inklusion der pädagogische Ansatz ist, der die Teilhabe aller Menschen unabhängig von diesen Merkmalen anstrebt.
Welche Bedeutung hat das UN-Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen?
Es bildet die völkerrechtliche Basis für das Recht auf Bildung und verpflichtet das deutsche Schulsystem zur Weiterentwicklung hin zu einer inklusiven Schule für alle Kinder.
Was ist das Konzept der „Schule für alle Kinder“?
Es ist ein visionäres Modell von Katzenbach, das die Überwindung des mehrgliedrigen Schulsystems fordert, um Ausgrenzung zu vermeiden und Lernpotenziale voll auszuschöpfen.
Was versteht man unter lebenslagenorientierten Profilbildungen?
Dieses Konzept von Schroeder zielt auf milieusensible Bildungslandschaften ab, die die spezifischen Lebensumstände (z. B. Armut, Migration) der Schüler in der Schulentwicklung berücksichtigen.
Warum ist Heterogenität eine Herausforderung für deutsche Schulen?
Das deutsche Schulsystem ist traditionell hochselektierend. Inklusive Pädagogik fordert jedoch einen erfolgreichen Umgang mit Vielfalt statt der Trennung nach Leistung oder Merkmalen.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2017, Zwei Konzepte der inklusiven Schule. Weiterentwicklung des Schul- und Bildungssystems im Umgang mit Heterogenität, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/511854