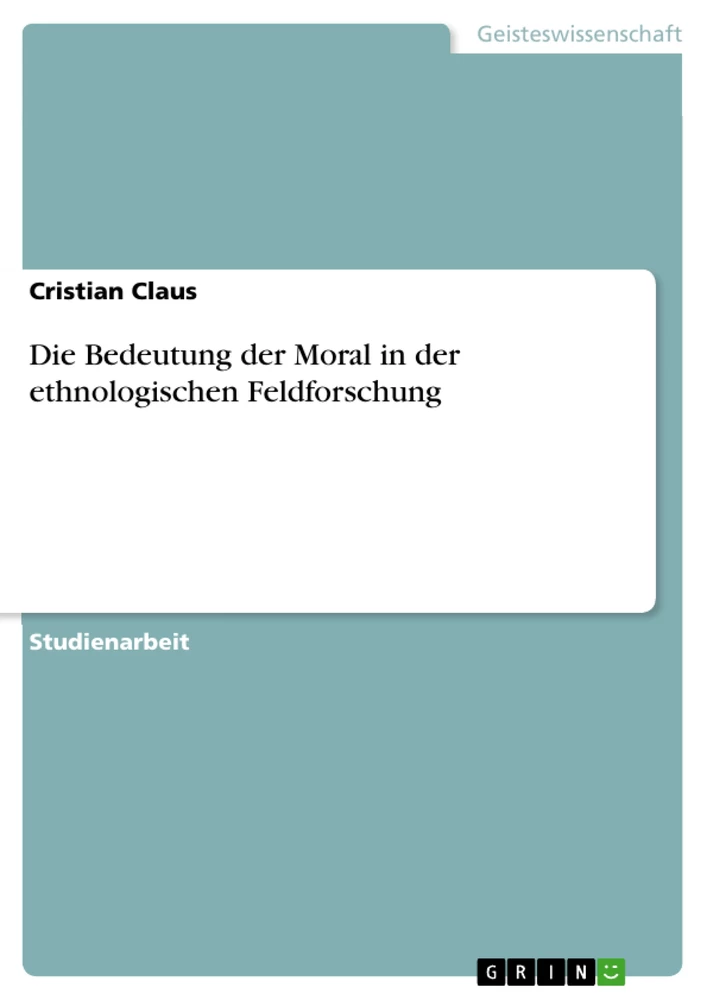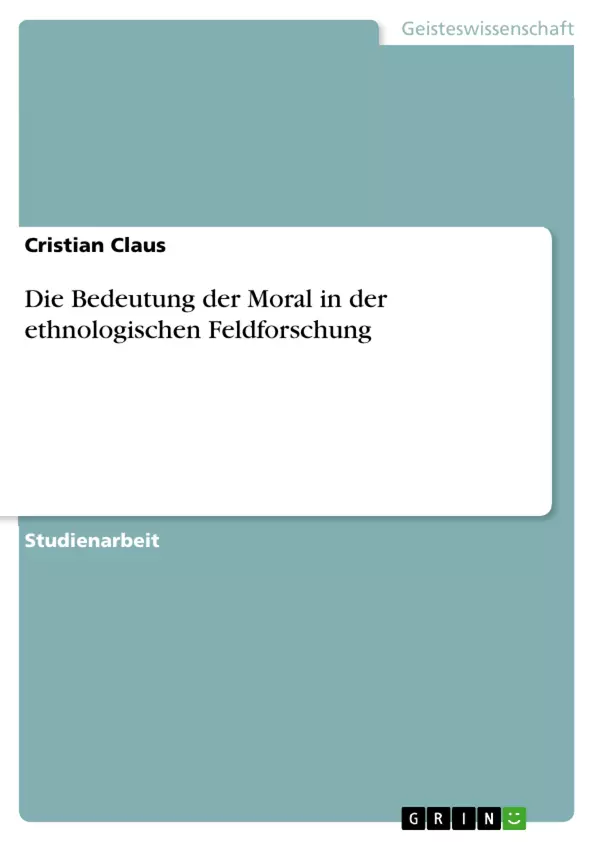Die Fragestellung dieser Hausarbeit lautet: Inwiefern spielt die Moral eine zentrale Rolle in der ethnologischen Feldforschung? Die Frage nach der Moral in der ethnologischen Feldforschung ist angesichts der historischen Verantwortung der Ethnologen von zentraler Bedeutung für die Disziplin. Allerdings wurde erst ab den 1960er Jahren die Thematik der Moral von der Ethnologie aufgegriffen und Ungerechtigkeiten wie der Vietnam-Krieg, Rassismus, Ungleichbehandlung der Geschlechter oder ökonomische Ungerechtigkeiten kritisiert. So ist die Relevanz, in der Ethnologie und gerade in der ethnologischen Feldforschung nach dem Sinn und Zweck der Moral zu fragen, vollkommen verständlich, da sich die Verantwortung nach dieser Frage aus der Geschichte des Faches selbst ergibt.
Um zu befriedigenden Antworten zu gelangen, muss als erstes die Frage nach der Moral gestellt werden. Was ist die Moral eigentlich und woraus setzt sie sich zusammen? Gibt es eine Universalmoral oder womöglich mehrere Moralen? Da sich die Fragestellung um Feldforschung als ethnologische Forschungsmethode dreht und darin enthalten ist, dass der Ethnologe sich als teilnehmender Beobachter definiert, muss, nachdem die Moral verständlich gemacht wurde, der Fokus auf moralisches Handeln gelegt werden, was durch die Vorstellung des kategorischen Imperativs erfolgt. Hier werden auch Grundtermini der Moral wie die praktische Vernunft und vernünftiges Handeln erläutert. Darauf folgend werden die ethnologischen Moralaspekte in den Fokus dieser Hausarbeit gerückt, um danach die Moral in der Disziplin der Ethnologie vorzustellen, welche in Form der „Frankfurter Erklärung“ zur Ethik und dem „Code of the American Anthropological Association“ dargestellt werden. Um das Kapitel zu vollenden, wird hier noch eine Abschlussbemerkung folgen, welche die wichtigsten Punkte abschließend zusammenfasst. Hiernach wird die Moral in der ethnologischen Feldforschung vorgestellt, wobei die Feldforschung als moralischer Gegenstand untersucht wird, um anschließend auf das moralische Spannungsverhältnis zwischen Forscher und Individuum einzugehen, welches verschiedene Rollenbilder beinhaltet und anhand eines ausgesuchten Fallbeispiels dargestellt wird.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Frage nach Moral
- 2.1 Moral im Singular oder Moralen im Plural?
- 2.2 Der kategorische Imperativ und/oder moralisches Handeln
- 3. Ethnologische Moralaspekte
- 3.1 Moral in der Disziplin Ethnologie
- 3.1.1 „Frankfurter Erklärung“ zur Ethik in der Ethnologie
- 3.1.2 Code of Ethics of the American Anthropological Association (AAA)
- 3.1.3 Bemerkung zur „Frankfurter Erklärung“ zur Ethik in der Ethnologie und dem „Code of Ethics of the American Anthropological Association“
- 3.2 Moral in der ethnologischen Feldforschung
- 3.2.1 Feldforschung als moralischer Gegenstand
- 3.2.2 Das moralische Spannungsverhältnis zwischen Forscher und Individuum
- 4. Mögliche Beantwortung der Fragestellung
- 5. Literaturhinweise
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die zentrale Rolle der Moral in der ethnologischen Feldforschung. Sie beleuchtet die Frage nach der Definition von Moral, die Existenz einer Universalmoral oder verschiedener Moralsysteme und den Einfluss kultureller Faktoren. Die Arbeit analysiert auch das moralische Handeln im Kontext der Feldforschung und das Spannungsverhältnis zwischen Forscher und Individuum.
- Definition und Vielschichtigkeit von Moral und Ethik
- Existenz einer Universalmoral oder Pluralität von Moralen
- Moralisches Handeln in der ethnologischen Feldforschung
- Ethische Richtlinien in der Ethnologie (Frankfurter Erklärung und AAA Code of Ethics)
- Spannungsverhältnis zwischen Forscher und Individuum in der Feldforschung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Moral in der ethnologischen Feldforschung ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Bedeutung der Moral in diesem Kontext. Sie beleuchtet die historische Verantwortung der Ethnologen im Kontext des Kolonialismus und die späte Auseinandersetzung der Disziplin mit ethischen Fragen. Die Einleitung skizziert den Aufbau der Arbeit und die einzelnen Kapitel.
2. Die Frage nach Moral: Dieses Kapitel befasst sich mit der grundlegenden Frage nach der Moral. Es erörtert die interdisziplinäre Natur des Themas und die Schwierigkeit, Moral kurz und prägnant zu definieren. Es wird das Verhältnis zwischen Theorie und Praxis in Bezug auf moralisches Handeln diskutiert, wobei das Verhältnis von Verantwortung und Freiheit im menschlichen Verhalten im Mittelpunkt steht. Die Komplexität der Frage nach der Moral wird hervorgehoben, die über eine einfache Beantwortung hinausgeht.
2.1 Moral im Singular oder Moralen im Plural?: Dieses Kapitel analysiert die Definition von Moral und Ethik, wobei die Definitionen von Otfried Höffe herangezogen werden. Es wird die enge Verbindung zwischen den Begriffen Moral und Ethik betont und die Bedeutung des Begriffs "Tugend" im Kontext des moralischen Handelns erläutert. Die Rolle von Kultur und Sozialisation im Verständnis von Moral wird diskutiert, und die Frage nach der Existenz einer Universalmoral oder der Pluralität von Moralen wird thematisiert.
3. Ethnologische Moralaspekte: Dieses Kapitel konzentriert sich auf ethische Aspekte innerhalb der Ethnologie. Es präsentiert die „Frankfurter Erklärung“ und den „Code of Ethics“ der American Anthropological Association (AAA) als wichtige ethische Richtlinien in der Feldforschung. Es folgt eine abschliessende Bemerkung, welche die wichtigsten Punkte beider Richtlinien zusammenfasst. Der Fokus liegt auf der Anwendung ethischer Prinzipien in der Praxis der ethnologischen Feldforschung.
3.2 Moral in der ethnologischen Feldforschung: Dieses Kapitel untersucht die Feldforschung selbst als moralischen Gegenstand. Es analysiert das Spannungsverhältnis zwischen Forscher und Individuum, die verschiedenen Rollenbilder und die damit verbundenen ethischen Herausforderungen. Ein konkretes Fallbeispiel (wenn vorhanden im Originaltext) veranschaulicht dieses Spannungsverhältnis und die komplexen moralischen Dilemmata, denen Forscher in der Feldforschung begegnen können.
Schlüsselwörter
Ethnologie, Feldforschung, Moral, Ethik, Universalmoral, Moralen im Plural, ethische Richtlinien, Frankfurter Erklärung, AAA Code of Ethics, Verantwortung, Forscherethik, kulturelle Unterschiede, moralisches Handeln, Spannungsverhältnis Forscher-Individuum.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Moral in der ethnologischen Feldforschung
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die zentrale Rolle der Moral in der ethnologischen Feldforschung. Sie beleuchtet die Frage nach der Definition von Moral, die Existenz einer Universalmoral oder verschiedener Moralsysteme und den Einfluss kultureller Faktoren auf das moralische Handeln im Kontext der Feldforschung und das Spannungsverhältnis zwischen Forscher und Individuum.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Definition und Vielschichtigkeit von Moral und Ethik, Existenz einer Universalmoral oder Pluralität von Moralen, moralisches Handeln in der ethnologischen Feldforschung, ethische Richtlinien in der Ethnologie (Frankfurter Erklärung und AAA Code of Ethics), und das Spannungsverhältnis zwischen Forscher und Individuum in der Feldforschung.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel: Eine Einleitung, ein Kapitel zur grundlegenden Frage nach Moral, ein Kapitel zur Pluralität von Moral, ein Kapitel zu ethnologischen Moralaspekten (inkl. Frankfurter Erklärung und AAA Code of Ethics), ein Kapitel zur Moral in der ethnologischen Feldforschung und abschließende Literaturhinweise. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel detaillierter beschrieben.
Was sind die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit zum Thema Moral?
Die Arbeit analysiert die Komplexität der Definition von Moral und Ethik, diskutiert die Frage nach einer Universalmoral vs. der Pluralität von Moralen und beleuchtet die ethischen Herausforderungen in der ethnologischen Feldforschung, insbesondere das Spannungsverhältnis zwischen Forscher und Individuum. Die „Frankfurter Erklärung“ und der „AAA Code of Ethics“ werden als wichtige ethische Richtlinien vorgestellt.
Wie wird die Frage nach der Universalmoral behandelt?
Die Arbeit diskutiert explizit die Frage nach der Existenz einer Universalmoral oder der Pluralität von Moralen. Sie analysiert die Rolle von Kultur und Sozialisation im Verständnis von Moral und bezieht sich dabei auf relevante Definitionen von Moral und Ethik (z.B. Otfried Höffe).
Welche Rolle spielen die „Frankfurter Erklärung“ und der „AAA Code of Ethics“?
Die „Frankfurter Erklärung“ und der „Code of Ethics“ der American Anthropological Association (AAA) werden als wichtige ethische Richtlinien in der ethnologischen Feldforschung vorgestellt und analysiert. Die Arbeit vergleicht und fasst die wichtigsten Punkte beider Richtlinien zusammen.
Wie wird das Spannungsverhältnis zwischen Forscher und Individuum dargestellt?
Die Arbeit untersucht die Feldforschung als moralischen Gegenstand und analysiert das Spannungsverhältnis zwischen Forscher und Individuum, die verschiedenen Rollenbilder und die damit verbundenen ethischen Herausforderungen. Es wird ein Schwerpunkt auf die komplexen moralischen Dilemmata gelegt, denen Forscher in der Feldforschung begegnen können.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Ethnologie, Feldforschung, Moral, Ethik, Universalmoral, Moralen im Plural, ethische Richtlinien, Frankfurter Erklärung, AAA Code of Ethics, Verantwortung, Forscherethik, kulturelle Unterschiede, moralisches Handeln, Spannungsverhältnis Forscher-Individuum.
- Quote paper
- Cristian Claus (Author), 2016, Die Bedeutung der Moral in der ethnologischen Feldforschung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/512004