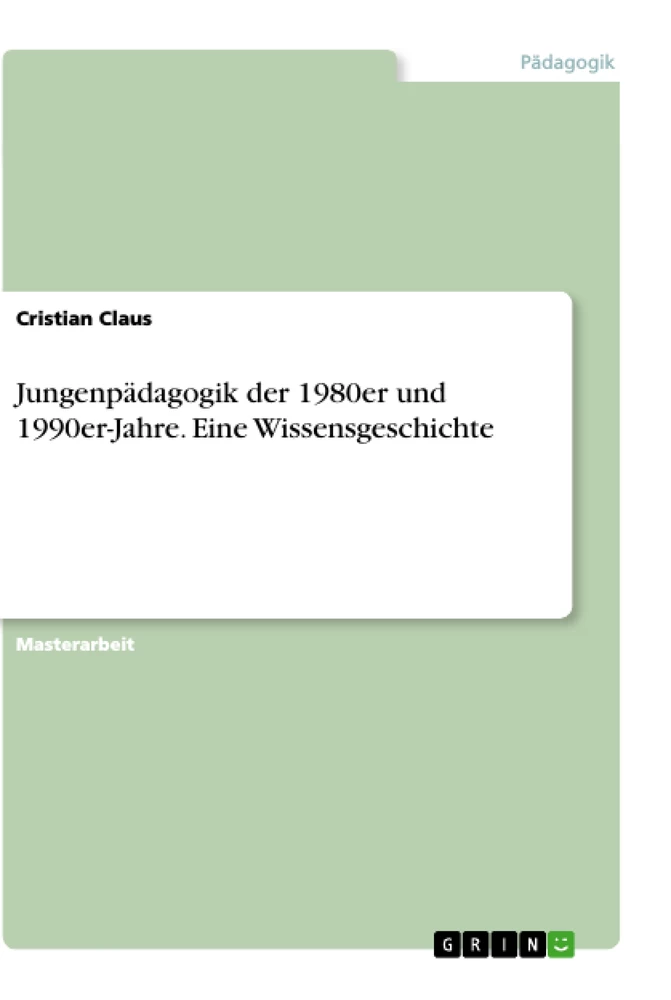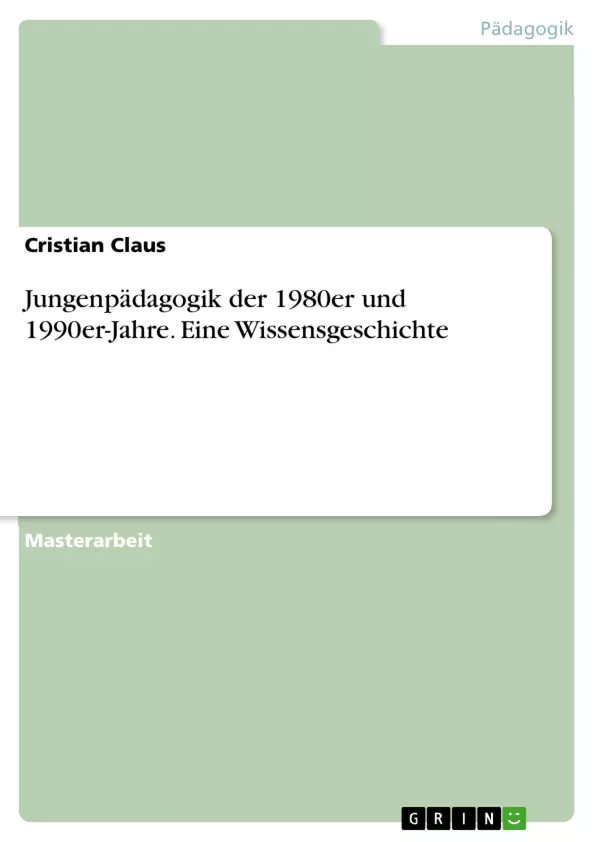Diese Arbeit verbindet verschiedene Dimensionen einer wissens(diskurs)theoretischen und -geschichtlichen Herangehensweise einer Beschreibung der modernen Jungenpädagogik und seinen Entstehungsmöglichkeiten. Diese Wissensgeschichte beschäftigt sich mit dem (veränderten) Wissen von und über Jungenpädagogik, was eine geschlechtertheoretische Betrachtung voraussetzt. Nach Phillip Sarasin und Michel Foucault wird ein Dispositiv herausgearbeitet, welches als Bezugssystem von sozialen, kulturellen und politischen Wissensordnungen ein Umdenken bzw. Neudenken von Männlichkeit und dementsprechend von Jungenpädagogik zulässt.
Dabei wird die Hippie-Bewegung, die 68er-Bewegungen, die Schwulenbewegungen, die zweite Frauenbewegung sowie Männer in Bewegung als Veränderungspotenziale dargestellt und in ein geschlechterhistorisches Verhältnis eingefügt und eine Zeit des Umdenkens und Umbruches charakterisiert. Soziokulturelle Dynamiken der Kulturgesellschaft (Film, Theater und Musik) der 1970er- und 1980er-Jahre in Deutschland werden interdependent mit den sozialen und politischen Dimensionen verknüpft. Danach folgt eine Aufarbeitung der modernen Jungenpädagogik, welche beginnend in der Alten Molkerei Frille und ihrem Ansatz einer Antisexistischer Jungenarbeit zu finden ist. Der Kritische Ansatz jungenpädagogischer Arbeit nach Lothar Böhnisch und Reinhard Winter sowie der Emanzipatorische Ansatz nach Michael Schenk und Reflektierte Jungenarbeit nach Uwe Sielert komplementieren die Betrachtung einer modernen Jungenarbeit.
Dabei spielen die männliche Sozialisation und der gesellschaftliche Ausdruck von Männlichkeit sowie der Ablehnung von Weiblichkeit eine übergeordnete Rolle. Am Schluss wird die Produktion und Zirkulation von geschlechtsbezogenem pädagogischem Wissen in einen Zusammenhang mit Umdenkungsprozessen der Gesellschaft gebracht, um daraus ein Postulat einer modernen Jungenpädagogik ziehen zu können.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- 1. Einleitung
- 1.1 Problemlage und Fragestellung
- 1.2 Forschungsstand
- 1.3 Geschlechtergeschichtliche Perspektive der Untersuchung
- 2. Theoretische Aspekte zu Männlichkeit und Jungenpädagogik
- 2.1 Männliche Sozialisation und der Zwang der anscheinenden Überlegenheit gegenüber Frauen und Mädchen
- 2.2 Historische Annäherung an eine Jungenpädagogik bis 1985: Geschlechtererziehung, Koedukation und Jugendarbeit
- 3. Zur methodologischen Umsetzung der Fragestellung
- 3.1 Zum wissensgeschichtlichen Forschungsansatz
- 3.1.1 Wissensgeschichte - Was ist die Geschichte des Wissens und welcher Wissensbegriff liegt ihr zu Grunde?
- 3.1.2 Wissensgeschichte und diskurstheoretische Elemente
- 3.1.3 Die vier Untersuchungselemente des wissensgeschichtlichen Forschungsansatzes
- 3.2 Grenzen des wissensgeschichtlichen Forschungsansatzes
- 4. Das Dispositiv als Bezugssystem von sozialen, kulturellen und politischen Wissensordnungen
- 4.1 Theoretische Annäherung
- 4.2 Eine Zeit des Umdenkens: Sozialgeschichtliche Dynamiken der 1960er-, 1970er- und 1980er-Jahre als Bedingungen der Entstehungsmöglichkeiten einer modernen Jungenpädagogik
- 4.2.1 Die Hippie-Bewegung als Beginn eines globalen Umdenkungsprozesses
- 4.2.2 Die 68er-Bewegung(en) als Beginn eines deutschen Umdenkungsprozesses
- 4.2.3 Die Zweite Frauenbewegung als Bezugspunkt eines männlichen Umdenkungsprozesses
- 4.2.4 Die Schwulenbewegungen als Umdenkungsprozess der tradiert-maskulinen Lebensweisen in Westdeutschland
- 4.2.5 Männer in Bewegung und die Krise des Mannes als Resultat eines Umdenkungsprozesses der Gesellschaft und Geschlechter
- 4.3 Soziokulturelle Dynamiken der Kulturgesellschaft der 1970er- und 1980er-Jahre in Deutschland: Interdependenz der sozialen Bewegungen und der Kulturgesellschaften Theater, Film und Musik
- 4.3.1 Theater
- 4.3.2 Film
- 4.3.3 Musik
- 4.4 Einfluss der sozialgeschichtlichen und -kulturellen Dynamiken auf politische Entscheidungen
- 4.5 Zwischenfazit (1)
- 5. Geschlechtsbezogene Ansätze der modernen Jungenpädagogik
- 5.1 Der Ansatz „Antisexistische Jungenarbeit“
- 5.1.1 Der Beginn der Alten Molkerei Frille
- 5.1.2 Antisexistische Jungenarbeit
- 5.1.2.1 Antisexistische Jungenarbeit bei der Heimvolkshochschule Alte Molkerei Frille (1988)
- 5.1.2.2 Der Ansatz „Antisexistischer Jungenarbeit“ nach Holger Karl (1994)
- 5.1.2.3 Infomaterial für Fortbildungen zu geschlechtsbezogener Pädagogik in der Alten Molkerei Frille (1990 - 1994)
- 5.2 Der Ansatz „Kritische Jungenarbeit“
- 5.2.1 Der Ansatz „Kritische Jungenarbeit“ nach Lothar Böhnisch (1987)
- 5.2.2 Der Ansatz „Kritische Jungenarbeit“ nach Reinhard Winter (1991)
- 5.3 Der Ansatz „Emanzipatorische Jungenarbeit“ nach Michael Schenk (1991)
- 5.4 Der Ansatz „Reflektierte Jungenarbeit“ nach Uwe Sielert (1989)
- 5.5 Zwischenfazit (2)
- 6. Analyse der dargestellten Ansätze einer Jungenarbeit im Verhältnis zum entwickelten Dispositiv
- 6.1 Herausgearbeitete Wissensfelder und Wissensordnungen
- 6.2 Die Produktion und Zirkulation von geschlechtsbezogenem pädagogischem Wissen im Zusammenhang mit Umdenkungsprozessen der Gesellschaft
- 6.3 Versuch einer Beantwortung der Fragestellung
- 7. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht die Wissensgeschichte der Jungenpädagogik der 1980er und 1990er Jahre. Ziel ist es, die Entstehung und Entwicklung verschiedener pädagogischer Ansätze in diesem Kontext zu analysieren und in ihren soziokulturellen und politischen Bedingungen zu verorten. Die Arbeit betrachtet dabei die Interdependenz zwischen gesellschaftlichen Veränderungen und der Entwicklung spezifischer pädagogischer Konzepte.
- Entwicklung verschiedener Ansätze der Jungenpädagogik
- Soziokulturelle und politische Bedingungen der Entstehung von Jungenpädagogik
- Wissensgeschichte als methodischer Ansatz
- Bedeutung gesellschaftlicher Umdenkprozesse
- Analyse der Interdependenz von gesellschaftlichen und pädagogischen Entwicklungen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik ein, benennt die Forschungsfrage und skizziert den Forschungsstand. Es wird die Problematik einer geschlechtertheoretisch unreflektierten Jungenpädagogik angesprochen und der methodische Ansatz der Wissensgeschichte begründet. Die Geschlechtergeschichte liefert den Rahmen für die Analyse.
2. Theoretische Aspekte zu Männlichkeit und Jungenpädagogik: Dieses Kapitel beleuchtet die theoretischen Grundlagen. Es untersucht die männliche Sozialisation und den damit verbundenen Druck zur Überlegenheit gegenüber Frauen und Mädchen. Ein historischer Überblick der Jungenpädagogik bis 1985 unter Berücksichtigung von Geschlechtererziehung, Koedukation und Jugendarbeit bildet einen weiteren Schwerpunkt.
3. Zur methodologischen Umsetzung der Fragestellung: Hier wird der wissensgeschichtliche Forschungsansatz detailliert erläutert. Es werden die zentralen Elemente dieses Ansatzes definiert, seine Grenzen aufgezeigt und der Bezug zu diskurstheoretischen Überlegungen hergestellt. Die vier Untersuchungselemente des wissensgeschichtlichen Forschungsansatzes werden explizit dargelegt.
4. Das Dispositiv als Bezugssystem von sozialen, kulturellen und politischen Wissensordnungen: Dieses Kapitel untersucht die soziokulturellen und politischen Bedingungen, die die Entstehung von Jungenpädagogik beeinflusst haben. Es analysiert die Rolle von sozialen Bewegungen der 60er, 70er und 80er Jahre (Hippie-Bewegung, 68er-Bewegung, Frauenbewegung, Schwulenbewegung) sowie deren Einfluss auf die Kultur (Theater, Film, Musik) und politische Entscheidungen.
5. Geschlechtsbezogene Ansätze der modernen Jungenpädagogik: Dieses Kapitel präsentiert und analysiert verschiedene Ansätze der Jungenpädagogik der 1980er und 1990er Jahre, wie den Ansatz der antisexistischen, kritischen, emanzipatorischen und reflektierten Jungenarbeit. Es werden die jeweiligen Konzepte und ihre Entstehungszusammenhänge detailliert dargestellt und verglichen. Die einzelnen Ansätze werden im Kontext ihrer jeweiligen Entstehungsgeschichte und der sie prägenden Akteure beleuchtet.
6. Analyse der dargestellten Ansätze einer Jungenarbeit im Verhältnis zum entwickelten Dispositiv: In diesem Kapitel werden die im vorherigen Kapitel vorgestellten Ansätze der Jungenpädagogik im Kontext des zuvor entwickelten Dispositivs analysiert. Es werden die Wissensfelder und Wissensordnungen untersucht, die die Produktion und Zirkulation geschlechtsbezogenen pädagogischen Wissens geprägt haben.
Schlüsselwörter
Jungenpädagogik, Wissensgeschichte, Männlichkeit, Geschlechterrollen, Sozialisation, Antisexistische Jungenarbeit, Kritische Jungenarbeit, Emanzipatorische Jungenarbeit, Reflektierte Jungenarbeit, 1980er Jahre, 1990er Jahre, Soziale Bewegungen, Kulturgeschichte, Diskursanalyse, Dispositiv.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Masterarbeit: Wissensgeschichte der Jungenpädagogik der 1980er und 1990er Jahre
Was ist das Thema dieser Masterarbeit?
Die Masterarbeit untersucht die Wissensgeschichte der Jungenpädagogik in den 1980er und 1990er Jahren. Sie analysiert die Entstehung und Entwicklung verschiedener pädagogischer Ansätze in diesem Zeitraum und deren soziokulturellen und politischen Bedingungen.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, die Entstehung und Entwicklung verschiedener pädagogischer Ansätze der Jungenpädagogik zu analysieren und in ihren soziokulturellen und politischen Kontexten zu verorten. Ein weiterer Fokus liegt auf der Interdependenz zwischen gesellschaftlichen Veränderungen und der Entwicklung spezifischer pädagogischer Konzepte.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung verschiedener Ansätze der Jungenpädagogik, die soziokulturellen und politischen Bedingungen ihrer Entstehung, die Wissensgeschichte als methodischen Ansatz, die Bedeutung gesellschaftlicher Umdenkprozesse und die Analyse der Interdependenz von gesellschaftlichen und pädagogischen Entwicklungen.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit verwendet einen wissensgeschichtlichen Forschungsansatz. Dieser Ansatz wird detailliert erläutert, seine Grenzen aufgezeigt und der Bezug zu diskurstheoretischen Überlegungen hergestellt. Die vier Untersuchungselemente des wissensgeschichtlichen Forschungsansatzes bilden die Grundlage der Analyse.
Welche sozialen und kulturellen Bewegungen werden untersucht?
Die Arbeit analysiert den Einfluss verschiedener sozialer Bewegungen der 60er, 70er und 80er Jahre, darunter die Hippie-Bewegung, die 68er-Bewegung, die zweite Frauenbewegung und die Schwulenbewegung, auf die Entstehung der Jungenpädagogik. Der Einfluss dieser Bewegungen auf Kultur (Theater, Film, Musik) und politische Entscheidungen wird ebenfalls untersucht.
Welche Ansätze der Jungenpädagogik werden analysiert?
Die Arbeit analysiert verschiedene Ansätze der Jungenpädagogik der 1980er und 1990er Jahre, darunter die antisexistische, kritische, emanzipatorische und reflektierte Jungenarbeit. Die jeweiligen Konzepte, Entstehungszusammenhänge und Akteure werden detailliert dargestellt und verglichen.
Wie werden die verschiedenen Ansätze der Jungenpädagogik im Kontext der gesellschaftlichen Entwicklungen analysiert?
Die Arbeit analysiert die im Kontext der gesellschaftlichen Entwicklungen entstandenen Ansätze der Jungenpädagogik im Zusammenhang mit einem entwickelten "Dispositiv", das die sozialen, kulturellen und politischen Wissensordnungen umfasst. Es werden die Wissensfelder und Wissensordnungen untersucht, die die Produktion und Zirkulation von geschlechtsbezogenem pädagogischem Wissen geprägt haben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Jungenpädagogik, Wissensgeschichte, Männlichkeit, Geschlechterrollen, Sozialisation, Antisexistische Jungenarbeit, Kritische Jungenarbeit, Emanzipatorische Jungenarbeit, Reflektierte Jungenarbeit, 1980er Jahre, 1990er Jahre, Soziale Bewegungen, Kulturgeschichte, Diskursanalyse, Dispositiv.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in sieben Kapitel gegliedert: Einleitung, Theoretische Aspekte zu Männlichkeit und Jungenpädagogik, Methodologie, Das Dispositiv, Geschlechtsbezogene Ansätze der Jungenpädagogik, Analyse der Ansätze im Verhältnis zum Dispositiv und Fazit. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel detailliert beschrieben.
- Citar trabajo
- Cristian Claus (Autor), 2019, Jungenpädagogik der 1980er und 1990er-Jahre. Eine Wissensgeschichte, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/512005