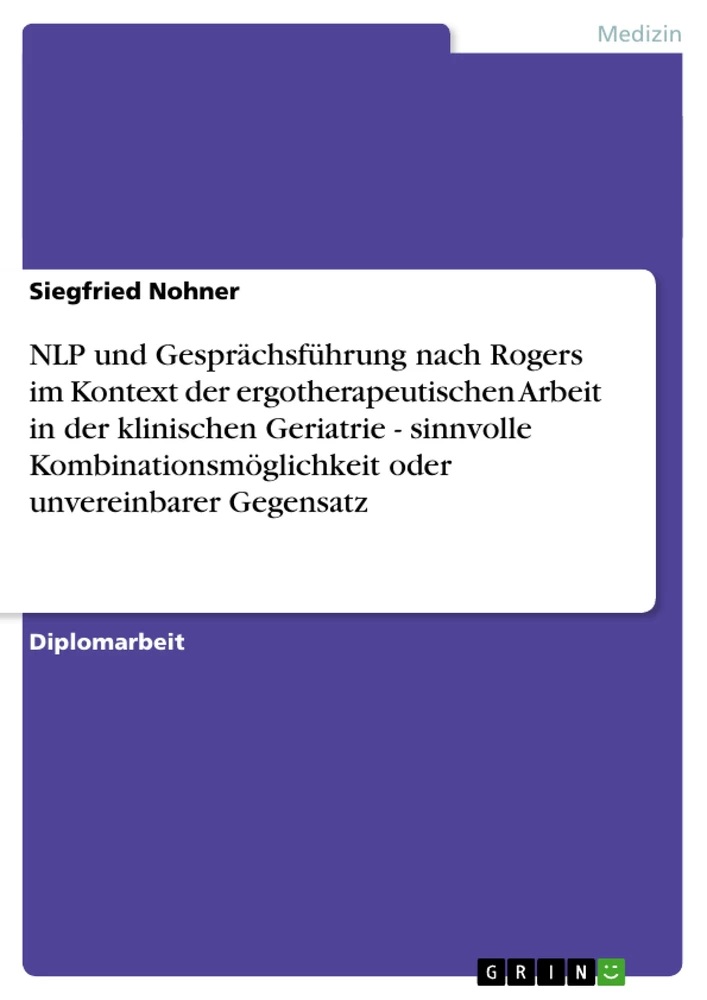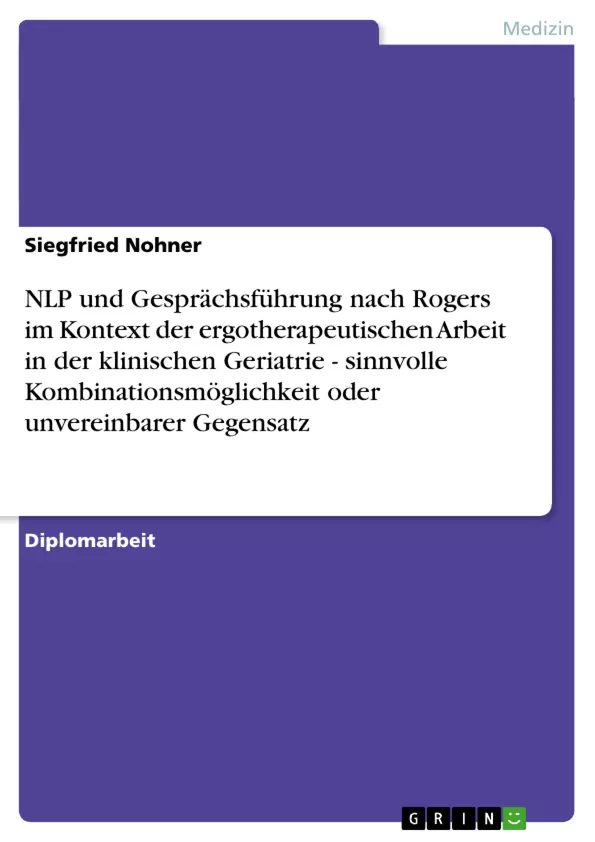Hypothesenentwicklung
Innerhalb therapeutisch vorgehender Berufsgruppen existiert eine große Anzahl von Methoden und Konzepten, welche durchweg sicherlich prinzipiell erfolgreich in ihren jeweiligen Anwendungen funktionieren. Gerade bezogen auf den Beruf des Ergotherapeuten mit seinem breiten Tätigkeitsspektrum können die unterschiedlichsten Behandlungsmethoden auftauchen. Im sensomotorisch- funktionellen Bereich beispielsweise trifft man oft auf die Anwendung verschiedener neurophysiologischer Konzepte (z.B. Bobath, Perfetti, PNF, Affolter, etc.). Alle diese Konzepte sind allgemein anerkannt und ihre Effizienz hinreichend erwiesen. Sie beruhen, so unterschiedlich ihre Herangehensweisen an therapeutische Aufgaben auch sein mögen, jedoch alle auch auf den gleichen neurophysiologischen Erkenntnissen und können sich somit prinzipiell nicht widersprechen. Nach subjektiver Erfahrung ist ihre erfolgreiche Anwendung eher von Vorlieben des Therapeuten einerseits als auch von der Individualität des Klienten andererseits abhängig. Ein von seinem Wesen her eher sehr autonom eingestellter Klient vermag beispielsweise unter Umständen gut von einer Therapie in Anlehnung an PNF profitieren, einem neurophysiologischen Konzept, welches in seiner Anwendung dem Klienten oft viel Bewegungskontrolle überlässt. Dem gegenüber wird ein Klient, welcher sich eher „in die Hände seines Therapeuten“ begeben möchte, möglicherweise größeren Nutzen aus einer Bobath-Behandlung ziehen, da diese Methode häufig über die Führung der Bewegung durch den Therapeuten funktioniert. In beiden Fällen ist der Behandlungserfolg jedoch auch von der Überzeugung des Therapeuten selbst von der Wirksamkeit des jeweiligen Konzeptes abhängig.
Gleiches gilt sicherlich auch für Vorgehensweisen im psychosozialen Bereich ergotherapeutischer Arbeit. Auch hier sollte man davon ausgehen können, dass Konzepte, welche in ihrer Wirksamkeit hinreichend anerkannt sind, sich in ihren Grundlagen nicht fundamental widersprechen. Inwiefern diese Annahme zutreffend ist, soll unter anderem innerhalb dieser Arbeit geklärt werden.
Die beiden gewählten Gesprächsmethoden bieten sich für eine ergotherapeutische Betrachtung gut an. Das Konzept nach Rogers ist, wie bereits erwähnt, in Grundlagen Inhalt der ergotherapeutischen Ausbildung...
Inhaltsverzeichnis
- 1. Stilistisches zur vorliegenden Arbeit
- 2. Persönliches zur Wahl des Themas
- 3. Hypothesenentwicklung
- 4. Zum Aufbau und Inhalt der Arbeit
- 5. Vorstellung der Modelle
- 5.1 Die Klientenzentrierte Gesprächsführung nach Carl Rogers
- 5.1.1 Die Basisvariablen des Therapeuten
- 5.1.2 Die Aktualisierungstendenz des Klienten
- 5.1.3 Vor- und Nachteile der Klientenzentrierten Gesprächsführung bezüglich der ergotherapeutischen Arbeit in der klinischen Geriatrie
- 5.2 Das Neuro-Linguistische Programmieren (NLP)
- 5.2.1 Pacing und Rapport
- 5.2.2 Wirklichkeitsebenen / Oberflächen- und Tiefenstruktur
- 5.2.3 Ankern
- 5.2.4 Kooperationsstile
- 5.2.5 Symptomverschreibungen
- 5.2.6 Refraiming
- 5.2.7 Blickkontakt / Augenzugangshinweise
- 5.2.8 Wohlgeformte Ziele
- 5.2.9 Vor- und Nachteile des NLP bezüglich der ergotherapeutischen Arbeit in der klinischen Geriatrie
- 5.1 Die Klientenzentrierte Gesprächsführung nach Carl Rogers
- 6. Gemeinsamkeiten und Gegensätze
- 6.1 Gemeinsamkeiten
- 6.2 Gegensätze
- 7. Erstellung eines Kombinationsmodells bezogen auf die ergotherapeutische Arbeit in der klinischen Geriatrie
- 8. Überprüfung des Kombinationsmodells im Zuge exemplarischer Anwendungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Kombinationsmöglichkeiten der klientenzentrierten Gesprächsführung nach Rogers und des Neuro-Linguistischen Programmierens (NLP) im Kontext der ergotherapeutischen Arbeit in der klinischen Geriatrie. Ziel ist es, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede beider Konzepte zu analysieren und ein praktikables Kombinationsmodell zu entwickeln und anhand von Beispielen zu überprüfen.
- Klientenzentrierte Gesprächsführung nach Rogers
- Neuro-Linguistisches Programmieren (NLP)
- Kombinationsmöglichkeiten beider Ansätze in der geriatrischen Ergotherapie
- Entwicklung eines praktikablen Kombinationsmodells
- Anwendung und Überprüfung des Modells in der Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
1. Stilistisches zur vorliegenden Arbeit: Diese Einleitung beschreibt den Stil und Aufbau der Arbeit, dient aber nicht der inhaltlichen Zusammenfassung.
2. Persönliches zur Wahl des Themas: Dieser Abschnitt beschreibt die persönlichen Beweggründe des Autors für die Themenwahl und ist daher nicht für eine inhaltliche Zusammenfassung relevant.
3. Hypothesenentwicklung: Diese Sektion formuliert die Hypothesen, die im weiteren Verlauf der Arbeit untersucht werden. Eine Zusammenfassung würde die Kernhypothesen wiedergeben, jedoch ohne die späteren Ergebnisse vorwegzunehmen.
4. Zum Aufbau und Inhalt der Arbeit: Dieser Abschnitt beschreibt den Aufbau der Arbeit und dient lediglich als Übersicht, beinhaltet aber keine inhaltliche Zusammenfassung.
5. Vorstellung der Modelle: Dieses Kapitel stellt die klientenzentrierte Gesprächsführung nach Carl Rogers und das Neuro-Linguistische Programmieren (NLP) vor. Es werden die zentralen Konzepte beider Ansätze detailliert erläutert, ihre jeweiligen Stärken und Schwächen im Kontext der geriatrischen Ergotherapie werden herausgearbeitet und analysiert. Die Beschreibung der Basisvariablen des Therapeuten (Wertschätzung, Kongruenz, Empathie) nach Rogers und NLP-Techniken wie Pacing, Rapport, Ankern und Reframing bilden den Kern dieses Kapitels. Die jeweiligen Vor- und Nachteile beider Verfahren für die ergotherapeutische Praxis in der Geriatrie werden gegeneinander abgewogen.
6. Gemeinsamkeiten und Gegensätze: Dieses Kapitel vergleicht die klientenzentrierte Gesprächsführung und das NLP. Es werden sowohl Gemeinsamkeiten (z.B. Empathie, Wertschätzung, Fokus auf die Ressourcen des Klienten) als auch Unterschiede (z.B. Interventionsstil, Geschwindigkeit der Veränderung, Zielformulierung) der beiden Methoden im Detail analysiert und kritisch beleuchtet. Die Analyse konzentriert sich auf zentrale Aspekte wie die Intervention, die Therapeutenkongruenz, die Zielformulierung und die Geschwindigkeit der Veränderung, wobei jeweils die Perspektiven beider Modelle und die persönliche Sichtweise des Autors dargelegt werden.
7. Erstellung eines Kombinationsmodells bezogen auf die ergotherapeutische Arbeit in der klinischen Geriatrie: Dieses Kapitel präsentiert ein vom Autor entwickeltes Kombinationsmodell, das Elemente der klientenzentrierten Gesprächsführung und des NLP integriert. Es werden die Grundgedanken, das Setting, die innere Vorbereitung des Therapeuten, der Gesprächseinstieg, der weitere Gesprächsverlauf sowie die Erarbeitung eines Ziels detailliert beschrieben. Die Zusammenfassung dieses Kapitels würde das neue Modell, seine Komponenten und deren Zusammenspiel im Kontext der geriatrischen Ergotherapie umfassend erläutern. Dabei wird die Begründung der gewählten Kombination und deren jeweiliger Beitrag zur Therapie beschrieben.
Schlüsselwörter
Klientenzentrierte Gesprächsführung, Carl Rogers, Neuro-Linguistisches Programmieren (NLP), Geriatrische Ergotherapie, Kombinationsmodell, Intervention, Therapeutenkongruenz, Zielformulierung, Empathie, Wertschätzung, Praxisbeispiel.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Kombinationsmodell klientenzentrierte Gesprächsführung und NLP in der geriatrischen Ergotherapie
Was ist das Thema der vorliegenden Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Kombinationsmöglichkeiten der klientenzentrierten Gesprächsführung nach Rogers und des Neuro-Linguistischen Programmierens (NLP) in der ergotherapeutischen Arbeit mit geriatrischen Patienten. Ziel ist die Entwicklung und Überprüfung eines praktikablen Kombinationsmodells.
Welche Modelle werden vorgestellt und verglichen?
Die Arbeit stellt die klientenzentrierte Gesprächsführung nach Carl Rogers und das Neuro-Linguistische Programmieren (NLP) detailliert vor. Es werden die zentralen Konzepte, Stärken und Schwächen beider Ansätze im Kontext der geriatrischen Ergotherapie analysiert und verglichen. Die Basisvariablen des Therapeuten nach Rogers (Wertschätzung, Kongruenz, Empathie) und NLP-Techniken wie Pacing, Rapport, Ankern und Refraiming werden erläutert.
Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den beiden Modellen werden aufgezeigt?
Die Arbeit analysiert Gemeinsamkeiten (z.B. Empathie, Wertschätzung, Ressourcenorientierung) und Unterschiede (z.B. Interventionsstil, Veränderungsgeschwindigkeit, Zielformulierung) der klientenzentrierten Gesprächsführung und des NLP. Die Analyse konzentriert sich auf Aspekte wie Intervention, Therapeutenkongruenz, Zielformulierung und Veränderungsgeschwindigkeit.
Wie wird das Kombinationsmodell entwickelt?
Die Arbeit entwickelt ein Kombinationsmodell, das Elemente der klientenzentrierten Gesprächsführung und des NLP integriert. Das Modell beschreibt Grundgedanken, Setting, therapeutische Vorbereitung, Gesprächseinstieg, Gesprächsverlauf und Zielerarbeitung. Die Begründung der gewählten Kombination und deren Beitrag zur Therapie werden detailliert dargelegt.
Wie wird das Kombinationsmodell überprüft?
Das entwickelte Kombinationsmodell wird anhand exemplarischer Anwendungen in der Praxis überprüft. (Details zur Überprüfungsmöglichkeit werden im Haupttext beschrieben.)
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Klientenzentrierte Gesprächsführung, Carl Rogers, Neuro-Linguistisches Programmieren (NLP), Geriatrische Ergotherapie, Kombinationsmodell, Intervention, Therapeutenkongruenz, Zielformulierung, Empathie, Wertschätzung, Praxisbeispiel.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu: Stilistik der Arbeit, persönliche Themenwahl, Hypothesenentwicklung, Aufbau und Inhalt der Arbeit, Vorstellung der Modelle (Klientenzentrierte Gesprächsführung und NLP), Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Modelle, Erstellung des Kombinationsmodells, und Überprüfung des Kombinationsmodells anhand exemplarischer Anwendungen.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Ergotherapeuten, die in der klinischen Geriatrie tätig sind und ihr Wissen über klientenzentrierte Gesprächsführung und NLP erweitern möchten, sowie für alle, die sich für Kombinationsmodelle in der Therapie interessieren.
- Citation du texte
- Siegfried Nohner (Auteur), 2005, NLP und Gesprächsführung nach Rogers im Kontext der ergotherapeutischen Arbeit in der klinischen Geriatrie - sinnvolle Kombinationsmöglichkeit oder unvereinbarer Gegensatz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/51209