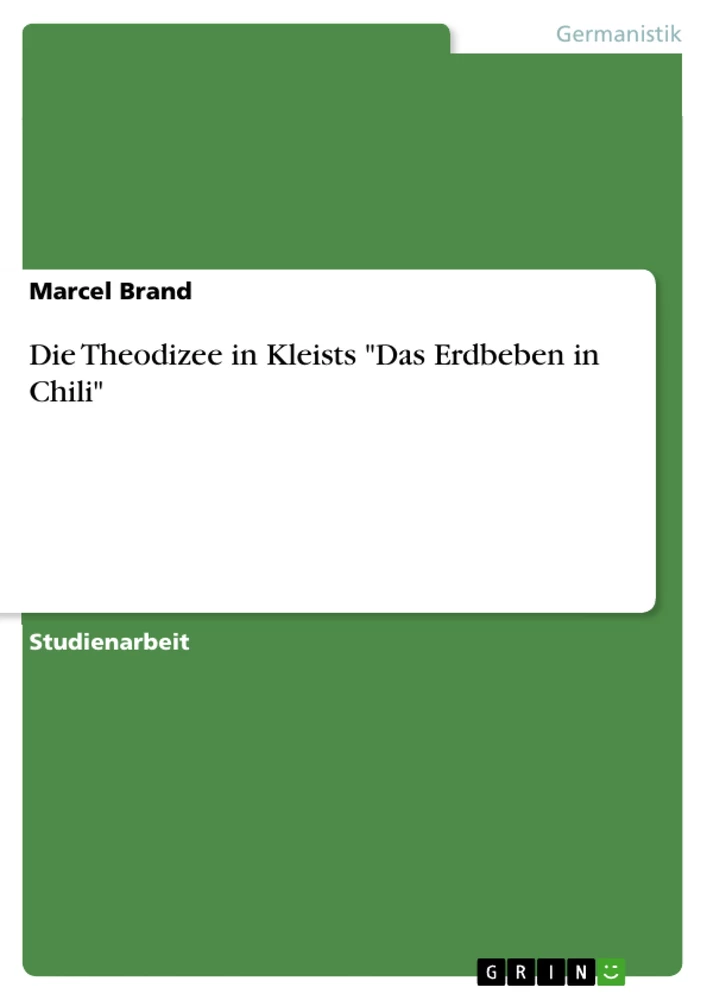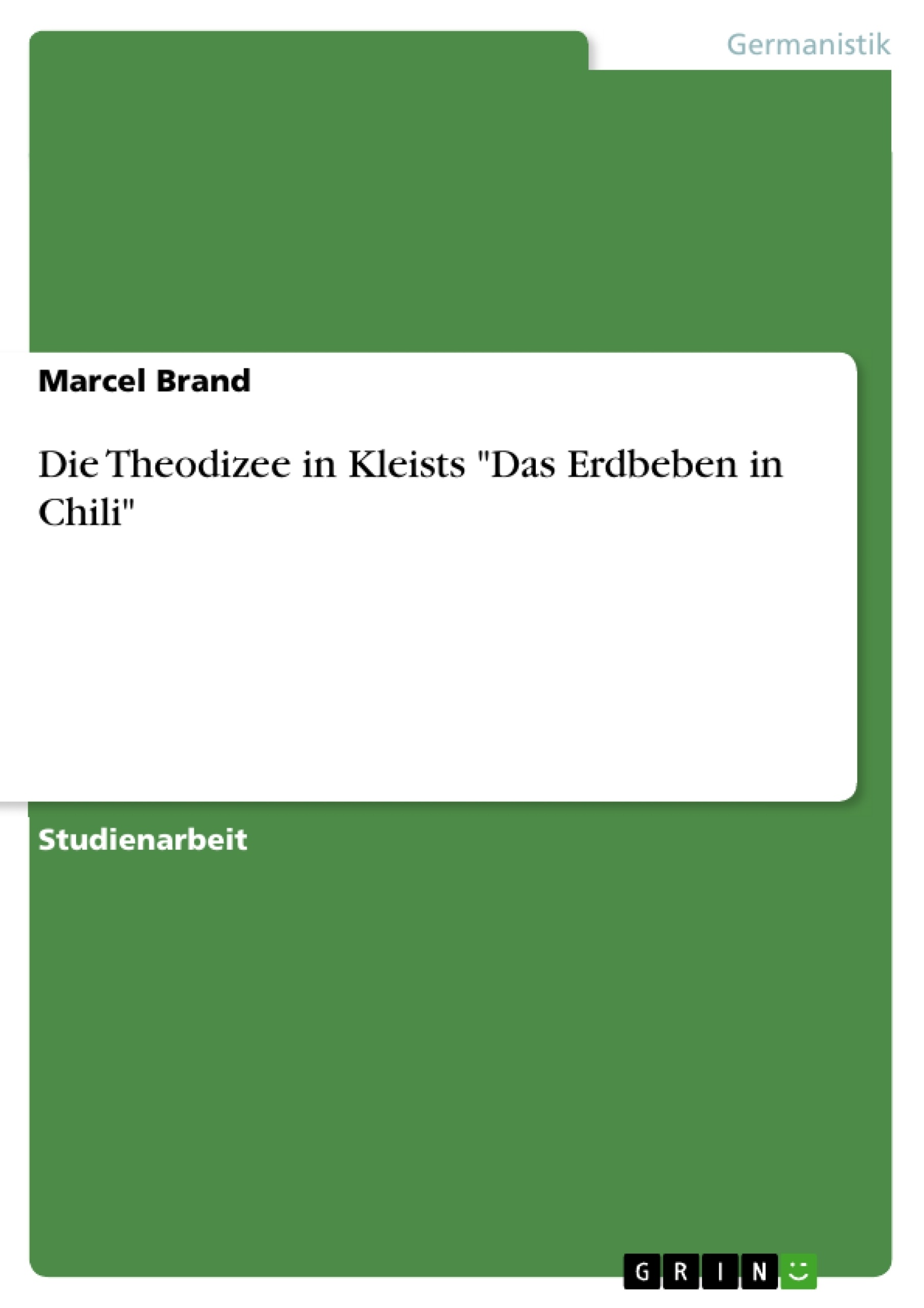Die Novelle Das Erdbeben in Chili ist als Kleists Beitrag zur Theodizeedebatte des achtzehnten Jahrhunderts zu sehen. Dabei untersucht diese Ausarbeitung, inwieweit er den ursprünglichen Theodizeegedanken Leibniz' eingebunden beziehungsweise dargestellt hat.
Insgesamt ist diese Arbeit in zwei Teile gegliedert. Zunächst erfolgt eine knappe Ausführung der Theodizeetheorie Gottfried Wilhelm Leibniz', die auch Heinrich von Kleist beeinflusst hat. Sein Umgang mit der von Leibniz aufgestellten Theorie wird folg- lich ebenfalls untersucht, bevor es zur Betrachtung der Umsetzung dieser Gedanken in seiner Novelle kommt, welche den zweiten Teil dieser Ausarbeitung bildet. Hierbei werden diverse Erklärungsmuster und immer wieder auftretende Merkmale analysiert. Es wird die Frage geklärt, ob Kleist die Katastrophe in St. Jago mit einem tieferen Sinn behaftet hat und so den Theodizeegedanken Leibniz' in seiner Novelle wi- derspiegeln lässt oder ob sein Werk als eine Art Abrechnung zu sehen ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Theodizeedebatte im 18. Jahrhundert
- Leibniz` Theodizee
- Der Umgang Kleists mit der Theodizee
- Das Erdbeben in Chili – Kleists Verarbeitung der Theodizee
- Die Gesellschaft St. Jagos im Kontrast zur Aufklärung
- Die Funktion des (un-)glücklichen Zufalls
- Privates und gesellschaftliches Übel
- Die Strafpredigt nach dem Rückzug aus der Utopie
- Deutung des Erdbebens
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Novelle „Das Erdbeben in Chili“ von Heinrich von Kleist als Beitrag zur Theodizeedebatte des 18. Jahrhunderts. Sie analysiert, inwieweit Kleist den ursprünglichen Theodizeegedanken von Leibniz in seiner Novelle aufgreift und umsetzt. Dabei werden die unterschiedlichen Erklärungsmuster und wiederkehrenden Merkmale des Textes analysiert, um zu ergründen, ob Kleist die Katastrophe in St. Jago mit einem tieferen Sinn behaftet hat und so die Theodizee von Leibniz widerspiegelt oder ob seine Novelle als eine Art Abrechnung zu verstehen ist.
- Die Theodizeetheorie von Leibniz
- Kleists Umgang mit der Theodizee
- Die Bedeutung des Erdbebens in Chili für Kleists Novelle
- Die Rolle des Zufalls in der Geschichte
- Das Verhältnis zwischen individuellem und gesellschaftlichem Übel
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung skizziert die Einordnung der Novelle "Das Erdbeben in Chili" als Kleists Beitrag zur Theodizeedebatte des 18. Jahrhunderts. Der erste Teil der Arbeit behandelt die Theodizeetheorie von Leibniz, die auch Heinrich von Kleist beeinflusst hat. Der zweite Teil widmet sich Kleists Umsetzung dieser Gedanken in seiner Novelle.
Kapitel 2 untersucht die Theodizeedebatte im 18. Jahrhundert und beschreibt die Bedeutung des Erdbebens von Lissabon 1755 für die Auseinandersetzung mit der Frage nach dem Verhältnis von Gottes Güte und dem Übel in der Welt.
Kapitel 3 beleuchtet Leibniz' Theodizee, seine Vorstellung von der besten aller möglichen Welten und seine Argumentation, wie das Übel mit der Güte Gottes vereinbar ist.
Kapitel 4 untersucht Kleists Umgang mit der Theodizee und seine Interpretation des Erdbebens von Chili.
Kapitel 5 analysiert die Gesellschaft St. Jagos im Kontrast zur Aufklärung und zeigt auf, wie Kleist das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft in seiner Novelle darstellt.
Kapitel 6 beleuchtet die Funktion des Zufalls in Kleists Novelle und untersucht die Bedeutung des (un-)glücklichen Zufalls für die Handlung.
Kapitel 7 analysiert die Darstellung von privatem und gesellschaftlichem Übel in "Das Erdbeben in Chili" und untersucht, wie Kleist die verschiedenen Formen von Übel in seiner Novelle miteinander verbindet.
Kapitel 8 betrachtet die Strafpredigt nach dem Rückzug aus der Utopie und zeigt auf, wie Kleist die Folgen des Erdbebens und die Reaktion der Menschen auf die Katastrophe darstellt.
Schlüsselwörter
Theodizee, Erdbeben, Chili, Leibniz, Kleist, Aufklärung, Utopie, Zufall, Übel, Strafpredigt, Gesellschaft, Individuum, Katastrophe, Sinn
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet „Theodizee“ im Kontext von Kleists Novelle?
Die Theodizee befasst sich mit der Frage, wie das Übel in der Welt mit der Güte Gottes vereinbar ist. Kleist nutzt das Erdbeben in Chili, um diese Debatte des 18. Jahrhunderts literarisch zu verarbeiten.
Wie unterscheidet sich Kleists Sicht von der Leibniz-Theorie?
Während Leibniz argumentiert, wir lebten in der „besten aller möglichen Welten“, zeigt Kleist durch die Katastrophe und die darauffolgende Gewalt eine weitaus pessimistischere Sicht auf die göttliche und gesellschaftliche Ordnung.
Welche Rolle spielt der Zufall in „Das Erdbeben in Chili“?
Der Zufall (glücklich wie unglücklich) ist ein zentrales Element. Er rettet die Liebenden vor der Hinrichtung, führt sie aber letztlich in eine Situation, in der sie der gesellschaftlichen Gewalt zum Opfer fallen.
Ist das Erdbeben eine Strafe Gottes?
In der Novelle interpretiert die Kirche das Beben als Strafe für die Sünden der Liebenden. Kleist stellt diese Deutung jedoch kritisch dar und hinterfragt den tieferen Sinn der Katastrophe.
Was symbolisiert die „Utopie“ im Tal?
Nach dem Beben entsteht im Tal kurzzeitig eine utopische Gemeinschaft, in der Standesunterschiede aufgehoben scheinen. Dieser Rückzug aus der grausamen Realität ist jedoch nur von kurzer Dauer.
- Arbeit zitieren
- Marcel Brand (Autor:in), 2019, Die Theodizee in Kleists "Das Erdbeben in Chili", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/512128