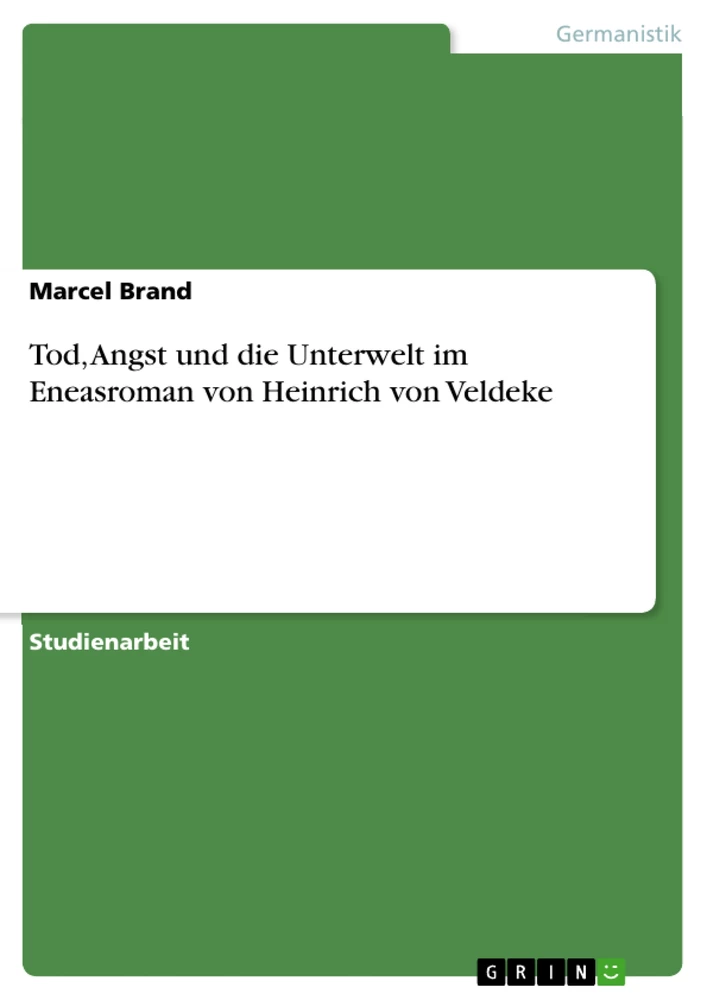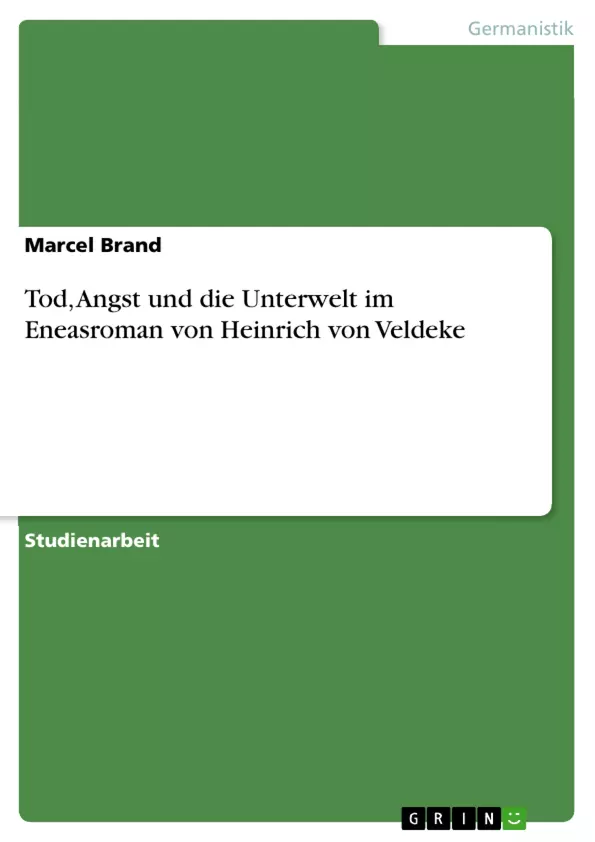Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Konzept der Wiedergeburt und den Begriffen Angst und Tod. Hierfür bezieht sich der Autor auf den Eneasroman von Heinrich von Veldeke. Es erfolgt eine Fixierung auf Eneas Gang durch die Unterwelt. Zunächst wird der Unterweltsgang in verkürzter Form dargestellt, woraufhin Unterschiede zwischen dem Eneasroman und seinen beiden Vorlagen, der "Aeneis" von Vergil und dem "Roman d’Eneas" eines unbekannten französischen Mittelalterautors, aufgezeigt und analysiert werden. Zum Abschluss des ersten Bereiches erfolgt eine sachliche Auseinandersetzung mit den Seelenvorstellungen zu Zeiten Vergils und Veldekes, wobei die unterschiedlichen Konzepte durchleuchtet werden. Der zweite Themenbereich beschäftigt sich mit der Materie der Angst. Bevor eine gezielte Untersuchung des besagten Romanabschnittes in Bezug auf diese Thematik erfolgt, wird der im Mittelalter vorherrschende Umgang nahegelegt. Dabei wird auch auf Erzählstrukturen Rücksicht genommen.
Das Konzept der Wiedergeburt wird schon seit jeher in religiösen Kreisen diskutiert und kritisiert. Hiermit eng verbunden sind auch die Begriffe Angst und Tod, denn wer dem Tod nahe steht, spürt zumeist auch eine omnipotente Gegenwart von Angst.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Veldekes Unterwelt
- Der Gang durch die Unterwelt
- Die Unterschiede der Unterwelt im Eneasroman zur Unterwelt der Aeneis und des Roman d'Eneas
- Die Seelenvorstellungen
- Darstellung von Angst
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert Heinrich von Veldekes Eneasroman, insbesondere Eneas' Gang durch die Unterwelt, und befasst sich mit den Themen Tod, Wiedergeburt und Angst. Sie vergleicht den Unterweltsgang im Eneasroman mit den Vorlagen der Aeneis und des Roman d'Eneas, untersucht die Seelenvorstellungen des Mittelalters und analysiert die Darstellung von Angst im Kontext der mittelalterlichen Erzähltradition.
- Vergleich des Unterweltsgangs im Eneasroman mit der Aeneis und dem Roman d'Eneas
- Analyse der Seelenvorstellungen im Mittelalter
- Darstellung der Angst im Eneasroman
- Verbindung von Tod, Wiedergeburt und Angst in der mittelalterlichen Literatur
- Relevanz des Eneasromans im Kontext der christlichen und römischen Kultur
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt das Konzept der Wiedergeburt und die damit verbundenen Themen Angst und Tod vor. Sie gibt einen Überblick über den Eneasroman und die thematischen Schwerpunkte der Arbeit.
Veldekes Unterwelt
Der Gang durch die Unterwelt
Dieses Kapitel beschreibt Eneas' Reise durch die Unterwelt, wobei die Kennzeichen der Unterwelt, wie Gestank, Feuer und Finsternis, hervorgehoben werden. Es werden die verschiedenen Stationen der Reise, wie die Hölle der Selbstmörder und die Pforte zum Reich des Todes, detailliert beschrieben.
Die Unterschiede der Unterwelt im Eneasroman zur Unterwelt der Aeneis und des Roman d'Eneas
Hier werden die Unterschiede zwischen Veldekes Version des Unterweltsgangs und den Vorlagen von Vergil und dem unbekannten französischen Autor des Roman d'Eneas analysiert.
Die Seelenvorstellungen
Dieses Kapitel beleuchtet die unterschiedlichen Seelenvorstellungen zu Zeiten Vergils und Veldekes.
Darstellung von Angst
Dieses Kapitel befasst sich mit der Darstellung von Angst im Eneasroman, wobei der Umgang mit Angst im Mittelalter sowie die Erzählstrukturen der mittelalterlichen Literatur berücksichtigt werden.
Schlüsselwörter
Eneasroman, Heinrich von Veldeke, Unterwelt, Tod, Wiedergeburt, Angst, Seelen, mittelalterliche Literatur, Vergil, Aeneis, Roman d'Eneas, christliche Kultur, römisches Imperium.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Heinrich von Veldekes Eneasroman primär?
Die Arbeit analysiert insbesondere Eneas' Gang durch die Unterwelt sowie die mittelalterlichen Vorstellungen von Tod, Angst und Wiedergeburt.
Welche Unterschiede bestehen zwischen Veldekes Werk und Vergils Aeneis?
Die Arbeit untersucht strukturelle und inhaltliche Abweichungen im Unterweltsgang zwischen dem mittelhochdeutschen Eneasroman, der antiken Aeneis und dem französischen Roman d’Eneas.
Wie wurde Angst im Mittelalter literarisch dargestellt?
Die Analyse beleuchtet den mittelalterlichen Umgang mit Angst, die durch Gestank, Feuer und Finsternis in der Unterwelt symbolisiert wird, sowie die entsprechenden Erzählstrukturen.
Welche Seelenvorstellungen werden in der Arbeit verglichen?
Es erfolgt eine Gegenüberstellung der Seelenvorstellungen zur Zeit der Antike (Vergil) und des christlich geprägten Mittelalters (Veldeke).
Was kennzeichnet Eneas' Reise durch die Unterwelt?
Die Reise führt durch verschiedene Stationen wie die Hölle der Selbstmörder und das Reich des Todes, geprägt von einer Atmosphäre der omnipotenten Angst.
- Quote paper
- Marcel Brand (Author), 2016, Tod, Angst und die Unterwelt im Eneasroman von Heinrich von Veldeke, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/512136