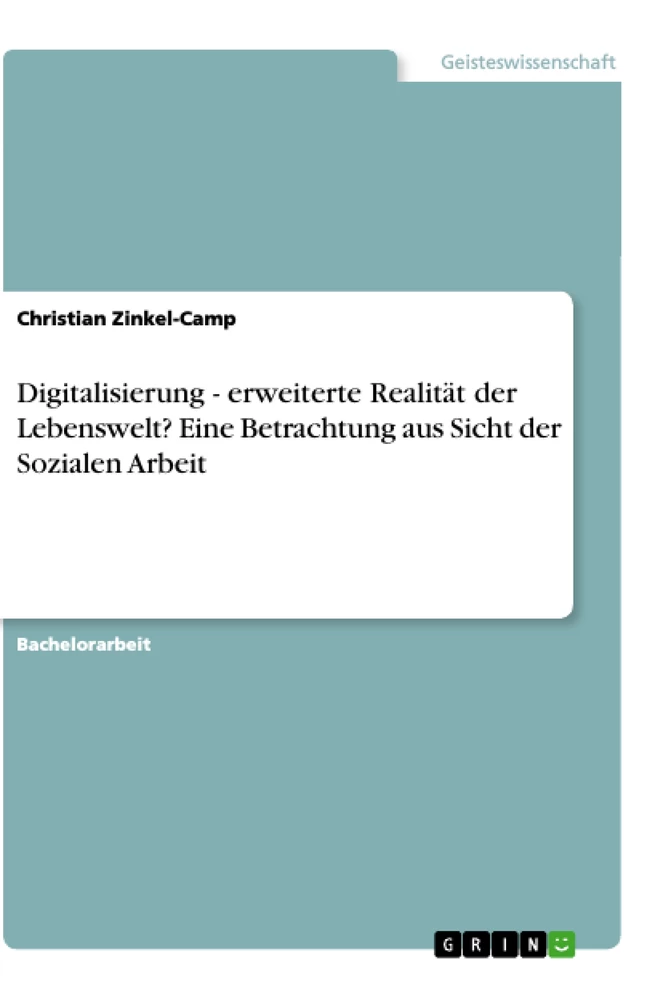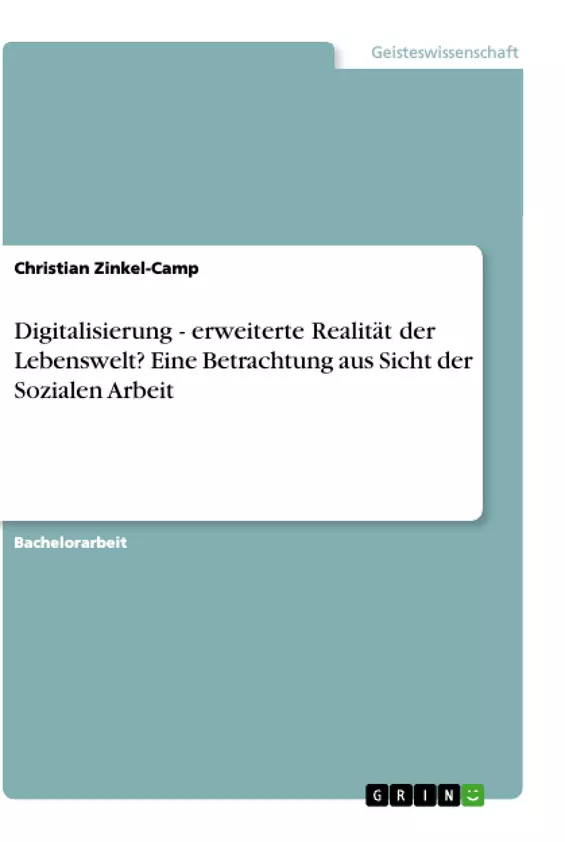Auf Basis von Fachliteratur und aktuellen Forschungen wird in dieser Bachelorarbeit aufgezeigt, dass das digitale und das physisch reale Leben keine parallel und voneinander getrennt existierenden Lebenswelten sind, sondern eine, sich durch beide Einflüsse erweiternde, Lebenswelt. Des Weiteren soll die Bedeutung der Digitalisierung, in Bezug auf die erweiterte Lebenswelt, für die Soziale Arbeit betrachtet werden.
Dabei besteht kein Anspruch darauf, das gesamte Spektrum des Phänomens, vom digitalen Wandel in der Gesellschaft, zu erfassen. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Haltung von Fachkräften und Institutionen der Sozialen Arbeit und die daraus resultierenden Konsequenzen, was dazu führt, dass aufgezeigt werden soll, dass die Sozialarbeitenden und Sozialunternehmen auf digitale Kompetenzen angewiesen sind, um den Anforderungen der digital erweiterten Lebenswelt gerecht zu werden. Um die Bedeutung der digitalen Lebenswelt für die Generationen ab 1977 darzustellen, wird ein Blick auf die Entwicklung von Identität, sowie den digitalen Lösungsstrategien bei Entwicklungsaufgaben im Jugendalter geworfen.
Es werden die generationalen Unterschiede für die Akzeptanz von digitalen Entwicklungen, sowie von gesellschaftlichen Machtverhältnissen und somit den unterschiedlichen Lebenswelten der Generationen aufgezeigt. Auch werden Theorien der Sozialen Arbeit in Anbetracht der digital erweiterten Lebenswelt beleuchtet, um aufzuzeigen, dass die bisherigen Konstrukte auch in der digitalen Welt bestand haben. Dementsprechend werden Erkenntnisse für die Soziale Arbeit auf den Ebenen der Sozialen Arbeit an sich, den Sozialarbeitenden, der Ausbildung, den Trägereinrichtungen und der Ethik beleuchtet.
Inhaltsverzeichnis
- Darstellungsverzeichnis
- 1. Kleine Geschichte der digital erweiterten Lebenswelt
- 1.1 Grundlegende Fragestellung
- 1.2 Zielsetzung
- 1.3 Methodisches Vorgehen
- 1.4 Stand der Forschung
- 2. Begriffserläuterungen
- 2.1 Digital Natives/Digital Immigrants
- 2.2 Digitale Revolution
- 2.3 Arbeit 4.0
- 2.4 Digitale Medien
- 2.5 Web 2.0
- 2.6 Web 3.0 oder das Internet der Dinge
- 3. Problembeschreibung
- 3.1 Clash of Generations
- 3.1.1 Demografische Verteilung in der Bevölkerung
- 3.1.2 Verteilung der Machtpositionen
- 3.2 Digitaler Habitus (digital divide)
- 3.3 Digitalisierung in der Sozialen Arbeit
- 3.3.1 Mikroebene: Mensch
- 3.3.2 Mesoebene: Organisationen der Sozialwirtschaft
- 3.3.3 Makroebene: Auswirkungen auf die Soziale Arbeit
- 3.4 Der Mythos von der nicht digitalisierbaren Sozialen Arbeit
- 4. Persönlichkeitsentwicklung im digitalen Zeitalter
- 4.1 Identität
- 4.2 Jugendalter
- 5. Theoretische Verortung der Digitalisierung
- 5.1 Digitalisierung der Lebenswelt
- 5.2 Lebensweltorientierte Soziale Arbeit nach Thiersch
- 5.3 Virtuelle Menschenrechtsprofession
- 6. Erkenntnis
- 6.1 Digitale Sozialen Arbeit
- 6.2 Digitalisierung der Sozialarbeitenden
- 6.3 Digitalisierung der Ausbildung
- 6.4 Digitalisierung der sozialen Träger*inneneinrichtungen
- 6.5 Digitale Ethik
- 7. Diskussion/Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit untersucht die Bedeutung der Digitalisierung für die Soziale Arbeit im Kontext der sich verändernden Lebenswelt. Sie stellt dar, dass das digitale und das physische reale Leben nicht getrennt voneinander existieren, sondern sich gegenseitig beeinflussen und zu einer erweiterten Lebenswelt verschmelzen. Dabei wird die Haltung von Fachkräften und Institutionen der Sozialen Arbeit in Bezug auf die Digitalisierung betrachtet und gezeigt, dass digitale Kompetenzen für die erfolgreiche Bewältigung der Anforderungen der digitalen Lebenswelt unerlässlich sind.
- Bedeutung der Digitalisierung für die Lebenswelt und die Soziale Arbeit
- Generationaler Wandel und unterschiedliche Akzeptanz von digitalen Entwicklungen
- Digitaler Habitus und soziale Ungleichheit
- Theorien der Sozialen Arbeit im Kontext der digitalen Lebenswelt
- Digitale Kompetenzen für Sozialarbeitende und Institutionen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel befasst sich mit der Entwicklung der digitalen Lebenswelt und stellt die grundlegende Fragestellung, Zielsetzung und methodisches Vorgehen der Arbeit dar. Das zweite Kapitel erläutert wichtige Begriffe wie Digital Natives, Digital Immigrants, Digitale Revolution, Arbeit 4.0, Digitale Medien, Web 2.0 und Web 3.0.
Das dritte Kapitel behandelt die Problematik des Clash of Generations, des digitalen Habitus und der Auswirkungen der Digitalisierung auf die Soziale Arbeit auf verschiedenen Ebenen. Kapitel 4 beleuchtet die Persönlichkeitsentwicklung im digitalen Zeitalter mit Fokus auf Identität und Jugendalter. Das fünfte Kapitel beschäftigt sich mit theoretischen Ansätzen der Sozialen Arbeit im Kontext der Digitalisierung.
Kapitel 6 stellt die Erkenntnisse der Arbeit dar und beleuchtet die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Soziale Arbeit, die Sozialarbeitenden, die Ausbildung, die sozialen Träger*inneneinrichtungen und die Ethik. Abschließend wird im siebten Kapitel eine Diskussion der gewonnenen Ergebnisse und ein Resümee der Arbeit präsentiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Digitalisierung, Lebenswelt, Soziale Arbeit, Digitale Kompetenzen, Generationaler Wandel, Digitaler Habitus, Soziale Ungleichheit, Digitale Medien, Web 2.0, Web 3.0, Arbeit 4.0, Identität, Jugendalter, Lebensweltorientierte Soziale Arbeit, Virtuelle Menschenrechtsprofession und Digitale Ethik.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet "digital erweiterte Lebenswelt" in der Sozialen Arbeit?
Es beschreibt die Verschmelzung von physischem und digitalem Leben. Digitale Medien sind kein paralleles Universum, sondern integraler Bestandteil des Alltags, was neue Anforderungen an die soziale Unterstützung stellt.
Was ist der Unterschied zwischen "Digital Natives" und "Digital Immigrants"?
Digital Natives sind mit digitalen Technologien aufgewachsen (Generationen ab ca. 1977-1980), während Digital Immigrants diese Technologien erst im Erwachsenenalter erlernt haben. Dieser Unterschied führt oft zu einem "Clash of Generations" in Institutionen.
Warum benötigen Fachkräfte der Sozialen Arbeit digitale Kompetenzen?
Da Klienten (insbesondere Jugendliche) ihre Identität und Problemlösungen zunehmend im digitalen Raum entwickeln, müssen Fachkräfte diese Lebenswelt verstehen und dort intervenieren können.
Was versteht man unter dem "digitalen Habitus" (digital divide)?
Der digitale Habitus beschreibt die ungleiche Verteilung von Zugang zu Technik und der Fähigkeit, diese sinnvoll zu nutzen. Dies kann soziale Ungleichheit verstärken, was ein zentrales Thema für die Soziale Arbeit ist.
Wie verändert die Digitalisierung die Ethik in der Sozialen Arbeit?
Digitale Ethik befasst sich mit Datenschutz, der Wahrung von Grenzen in sozialen Netzwerken und der Frage, wie Menschenrechte auch im virtuellen Raum geschützt werden können.
- Citation du texte
- Christian Zinkel-Camp (Auteur), 2019, Digitalisierung - erweiterte Realität der Lebenswelt? Eine Betrachtung aus Sicht der Sozialen Arbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/512182