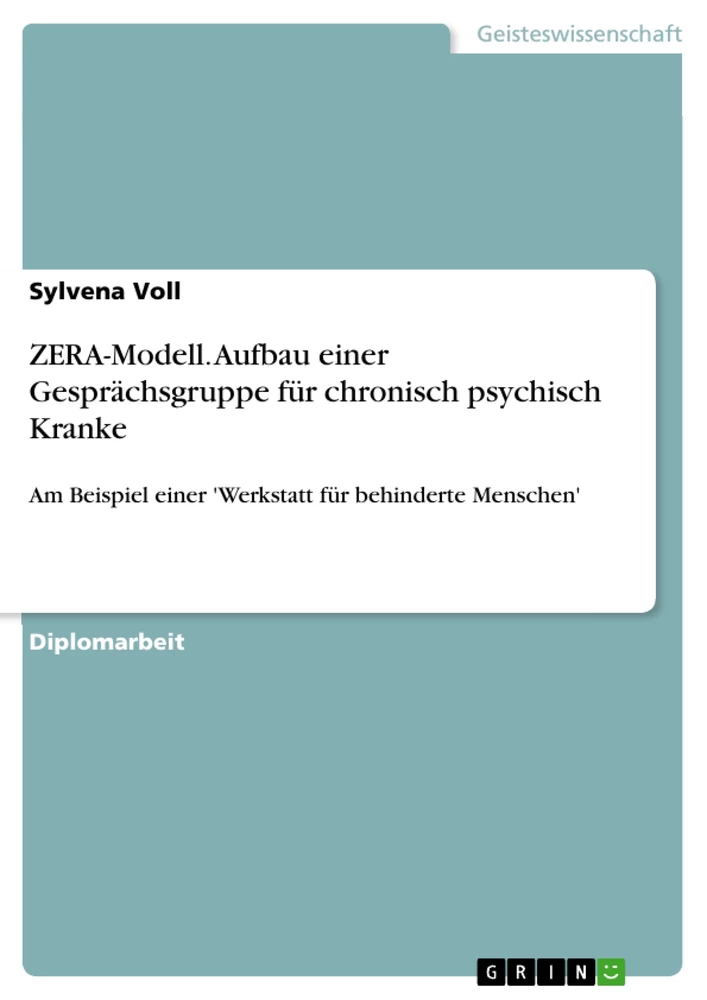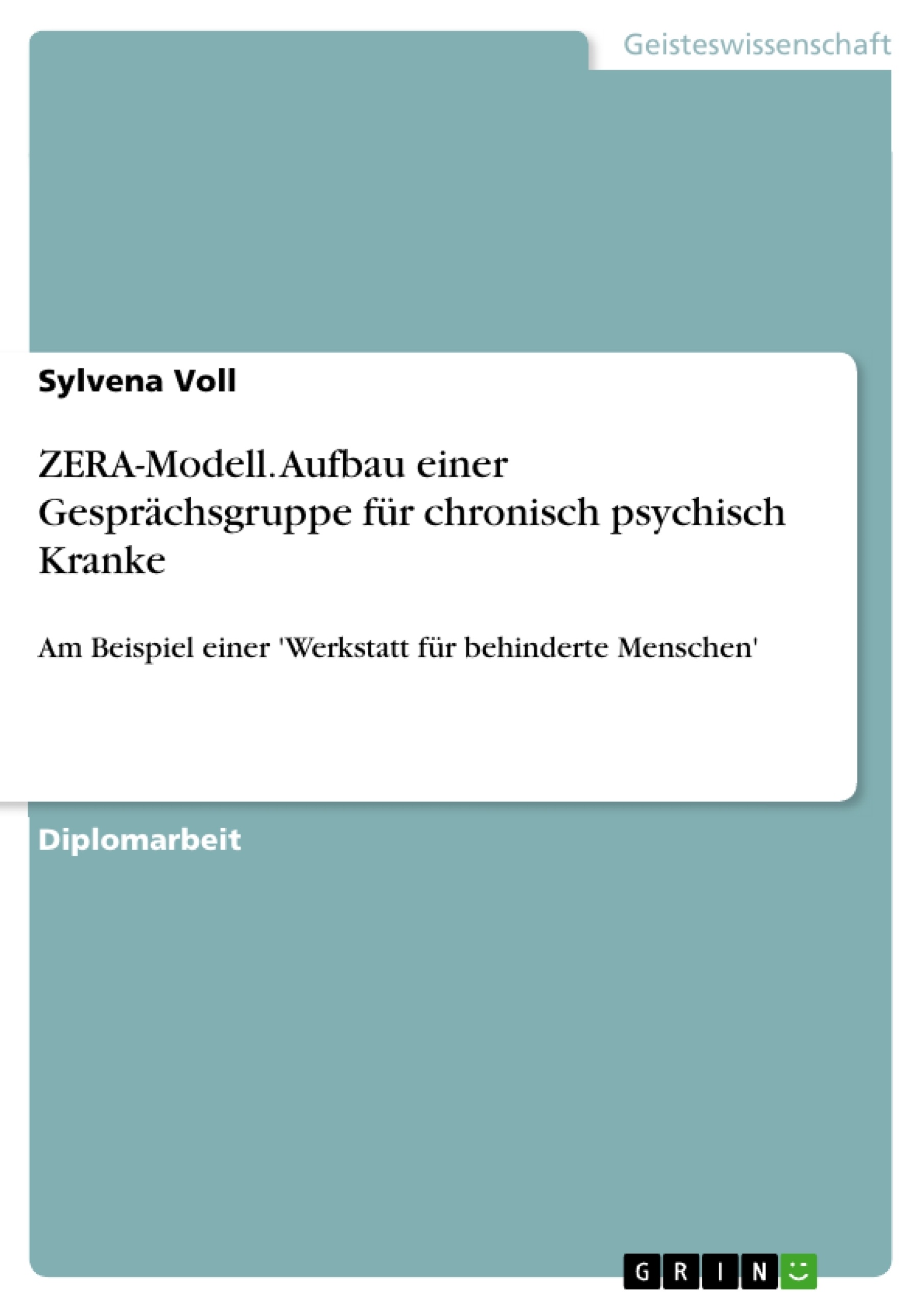Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema „Aufbau einer Gesprächsgruppe für chronisch psychisch kranke Menschen in einer Werkstatt für behinderte Menschen anhand des ZERA – Modells“.
Die Abkürzung ZERA bedeutet: Zusammenhang zwischen Erkrankung, Rehabilitation und Arbeit.
Dieses Modell ist sehr neu, deshalb gibt es nur begrenzt Informationen und Materialien aus der Literatur. Weitestgehend alle vorhandenen Schriften, die dieses Thema bearbeiten, finden sich in dieser Arbeit wieder.
Dieses Modell ist nur eine Form der Hilfe für chronisch psychisch kranke Menschen. Andere Angebote werden nicht in Frage gestellt.
Ziel dieser Arbeit ist es, aufzuzeigen, ob die gesteckten Ziele von ZERA in der Werkstatt für behinderte Menschen, in der ich meinen praktischen Studienteil absolvierte, umsetzbar und realisierbar sind.
Im Buch „Psychosoziale Arbeitshilfen“ von Irmgard Plößl, Matthias Hammer und
Ulrich Schelling heißt es: „Das ZERA – Programm greift Fragen, Ängste und Informationsdefizite auf und vermittelt in strukturierter Form Informationen und Problemlösestrategien, wobei zusätzlich gruppenspezifische Wirkfaktoren gezielt genutzt werden. Die übergeordnete Zielsetzung dabei ist, die TeilnehmerInnen darin zu unterstützen, das jeweils individuell optimale Anforderungsniveau herauszufinden und somit Über- und Unterforderung im beruflichen Bereich so weit wie möglich zu vermeiden.“
Zielgruppe des Modells sind chronisch psychisch kranke Menschen in Bereich der beruflichen Bildung. Diese Voraussetzung ist in der Werkstatt nicht realisierbar, da sich derzeit niemand aus dieser Personengruppe im Berufsbildungsbereich befindet. Die Gesprächsrunden wurden mit chronisch psychisch kranken Menschen aus den verschiedenen Arbeitsbereichen der Werkstatt durchgeführt. Ich denke, der Grund für die Zielgruppe „Chronisch psychisch krank und im Berufsbildungsbereich“ wurde deshalb gewählt, weil diese Menschen am Anfang einer Werkstatttätigkeit stehen und somit unter Umständen erst kurze Zeit vorher den ersten Arbeitsmarkt verlassen haben. Bei ihnen ist eine Rückführung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt wahrscheinlicher als bei Menschen, die schon viele Jahre in einer Werkstatt arbeiten.
Doch auch wenn die Rückführung nicht oder nicht mehr wahrscheinlich ist, denke ich dass auch in den Arbeitsbereichen genügend Probleme auftreten, wo Klärungsbedarf besteht. Es fand zeitweise ein reger Gedanken- und Informationsaustausch unter den Teilnehmern statt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Fragestellung
- 3. Allgemeine Informationen zur Einrichtung; der Situation in der Werkstatt und zu verschiedenen ausgewählten psychischen Erkrankungen
- 3.1 Informationen über die Lukaswerkstatt und das Leitbild
- 3.2 Zusammenarbeit von geistig behinderten Menschen und chronisch psychisch kranken Menschen in einer Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM)
- 3.3 Darstellung der Situation in der Lukaswerkstatt
- 3.4 Allgemeine Bemerkungen zu Formen psychischer Erkrankungen
- 3.4.1 Die Psychose
- 3.4.2 Die Neurose
- 3.4.3 Die Borderline - Störung
- 3.4.4 Die Schizophrenie
- 3.4.5 Die Depression
- 3.4.6 Die Manie
- 3.4.7 Angst- und Zwangsstörungen
- 3.5 Vorhandene Formen in der Gesprächsgruppe
- 4. ZERA - Was ist das?
- 4.1 Allgemeine Punkte zum ZERA - Modell
- 4.2 Konzeption des ZERA - Modells
- 5. Theoretische Grundlagen zur Durchführung der Gesprächsgruppe
- 5.1 Zielgruppe und Zielsetzungen
- 5.2 Methoden und Rahmenbedingungen
- 5.3 Durchführungsweise
- 5.4 Wissenschaftliche Begleitforschung
- 6. Durchführung der Gesprächsgruppe
- 6.1 Umsetzung der Konzeption in der Lukaswerkstatt
- 6.2 Vorstellung der Gruppe anhand des Krankheitsbildes
- 6.2.1 Frau W.
- 6.2.2 Frau B.
- 6.2.3 Frau G.
- 6.2.4 Herr S.
- 6.3 Verlauf, Beobachtungen und Ergebnisse der Sitzungen
- 6.3.1 Erste Sitzung
- 6.3.2 Zweite Sitzung
- 6.3.3 Dritte Sitzung
- 6.4 Feedback
- 7. Ein Beispiel für die soziale Arbeit mit chronisch psychisch kranken Menschen und einige berufsethische Grundpositionen
- 7.1 Soziale Arbeit mit chronisch psychisch kranken Menschen
- 7.2 Berufsethische Grundpositionen
- 8. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit untersucht die Umsetzbarkeit des ZERA-Modells (Zusammenhang zwischen Erkrankung, Rehabilitation und Arbeit) zur Etablierung einer Gesprächsgruppe für chronisch psychisch kranke Menschen in einer Werkstatt für behinderte Menschen. Ziel ist es, die praktische Anwendbarkeit des Modells zu evaluieren und Herausforderungen aufzuzeigen.
- Umsetzbarkeit des ZERA-Modells in der Praxis
- Erfahrungen und Herausforderungen bei der Arbeit mit chronisch psychisch kranken Menschen in einer WfbM
- Analyse der individuellen Krankheitsbilder und deren Auswirkungen auf die Gruppenarbeit
- Berufsethische Aspekte der sozialen Arbeit mit dieser Zielgruppe
- Bewertung der Wirksamkeit der Gesprächsgruppe
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Arbeit untersucht die Implementierung des neuartigen ZERA-Modells zur Unterstützung chronisch psychisch kranker Menschen in einer Werkstatt für behinderte Menschen. Aufgrund der Modellneuheit ist die Literaturlage begrenzt, und die Arbeit konzentriert sich auf die praktische Anwendung und deren Bewertung. Das Hauptziel ist die Evaluierung der Umsetzbarkeit des Modells im konkreten Kontext der Lukaswerkstatt.
3. Allgemeine Informationen zur Einrichtung; der Situation in der Werkstatt und zu verschiedenen ausgewählten psychischen Erkrankungen: Dieses Kapitel liefert den Kontext der Studie, indem es die Lukaswerkstatt, das Leitbild und die Zusammenarbeit zwischen geistig und chronisch psychisch behinderten Menschen beschreibt. Es werden verschiedene psychische Erkrankungen wie Psychosen, Neurosen, Borderline-Störungen, Schizophrenie, Depressionen, Manien und Angst- und Zwangsstörungen vorgestellt, um das Verständnis für die Teilnehmer der Gesprächsgruppe zu vertiefen. Der aktuelle Zustand der chronisch psychisch kranken Menschen in der Lukaswerkstatt wird ebenfalls dargestellt. Die Beschreibung der Erkrankungen dient als Grundlage für die spätere Analyse der Gruppensituation.
4. ZERA - Was ist das?: Dieses Kapitel erläutert das ZERA-Modell, seine allgemeinen Prinzipien und seine Konzeption. Es wird detailliert auf die Struktur und die Ziele des Programms eingegangen, welches darauf abzielt, den Betroffenen zu helfen, ein für sie optimales Anforderungsniveau im beruflichen Bereich zu finden und Über- oder Unterforderung zu vermeiden. Die Beschreibung des Modells bildet die theoretische Basis für die praktische Umsetzung und Evaluation in der folgenden Kapitel.
5. Theoretische Grundlagen zur Durchführung der Gesprächsgruppe: Dieses Kapitel beschreibt die Zielgruppe, die Zielsetzungen, Methoden und Rahmenbedingungen der Gesprächsgruppe, die auf dem ZERA-Modell basieren. Es werden die Durchführungsweise und die wissenschaftliche Begleitforschung erläutert. Die Ausführungen dieses Kapitels legen die theoretischen Grundlagen für die im folgenden Kapitel beschriebenen praktischen Erfahrungen dar.
6. Durchführung der Gesprächsgruppe: Dieses Kapitel dokumentiert die praktische Umsetzung des ZERA-Modells in der Lukaswerkstatt. Es werden die Erfahrungen und Beobachtungen während des Gruppenverlaufs beschrieben, indem einzelne Teilnehmer vorgestellt und der Verlauf der Sitzungen detailliert analysiert wird. Die detaillierte Darstellung der einzelnen Sitzungen ermöglicht eine differenzierte Analyse des Prozesses und der Ergebnisse der Gruppenarbeit.
7. Ein Beispiel für die soziale Arbeit mit chronisch psychisch kranken Menschen und einige berufsethische Grundpositionen: Dieses Kapitel beleuchtet die soziale Arbeit mit chronisch psychisch kranken Menschen im Allgemeinen und geht auf relevante berufsethische Aspekte ein. Es wird gezeigt, wie die Arbeit im konkreten Fall der Gesprächsgruppe ethische Herausforderungen mit sich bringt und welche Überlegungen die Sozialpädagogen hierbei anstellen müssen.
Häufig gestellte Fragen zur Diplomarbeit: Umsetzbarkeit des ZERA-Modells in der Lukaswerkstatt
Was ist das Thema der Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht die Umsetzbarkeit des ZERA-Modells (Zusammenhang zwischen Erkrankung, Rehabilitation und Arbeit) in einer Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) zur Etablierung einer Gesprächsgruppe für chronisch psychisch kranke Menschen. Es geht darum, die praktische Anwendbarkeit des Modells zu evaluieren und Herausforderungen aufzuzeigen.
Was ist das ZERA-Modell?
Das ZERA-Modell zielt darauf ab, chronisch psychisch kranken Menschen in einem beruflichen Kontext ein optimales Anforderungsniveau zu ermöglichen, um Über- oder Unterforderung zu vermeiden. Die Diplomarbeit beschreibt detailliert die Prinzipien und die Konzeption des Modells.
Welche psychischen Erkrankungen werden in der Arbeit betrachtet?
Die Arbeit behandelt verschiedene psychische Erkrankungen, darunter Psychosen, Neurosen, Borderline-Störungen, Schizophrenie, Depressionen, Manien und Angst- und Zwangsstörungen. Diese werden im Kontext der Teilnehmer der Gesprächsgruppe erläutert.
Welche Einrichtung ist Gegenstand der Studie?
Die Studie findet in der Lukaswerkstatt statt, einer Werkstatt für behinderte Menschen, in der geistig behinderte und chronisch psychisch kranke Menschen zusammenarbeiten. Die Arbeit beschreibt die Situation in der Werkstatt und das Leitbild der Einrichtung.
Wie ist die Diplomarbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in mehrere Kapitel gegliedert: Einleitung, Fragestellung, allgemeine Informationen zur Einrichtung und zu psychischen Erkrankungen, Beschreibung des ZERA-Modells, theoretische Grundlagen zur Gesprächsgruppe, Durchführung der Gesprächsgruppe (inkl. detaillierter Beschreibung der Sitzungen und Teilnehmer), ein Beispiel für soziale Arbeit mit chronisch psychisch kranken Menschen und berufsethische Aspekte, sowie eine Zusammenfassung.
Welche Methoden wurden angewendet?
Die Arbeit basiert auf der praktischen Umsetzung und Evaluation des ZERA-Modells in der Gesprächsgruppe. Es werden detaillierte Beobachtungen und Ergebnisse der Gruppensitzungen dokumentiert und analysiert.
Welche Ergebnisse liefert die Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit evaluiert die Umsetzbarkeit des ZERA-Modells in der Praxis, zeigt Herausforderungen bei der Arbeit mit chronisch psychisch kranken Menschen in einer WfbM auf, analysiert individuelle Krankheitsbilder und deren Auswirkungen auf die Gruppenarbeit, beleuchtet berufsethische Aspekte und bewertet die Wirksamkeit der Gesprächsgruppe.
Welche Zielgruppe wird in der Arbeit betrachtet?
Die Zielgruppe der Arbeit sind chronisch psychisch kranke Menschen in einer Werkstatt für behinderte Menschen.
Welche berufsethischen Aspekte werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die berufsethischen Herausforderungen der sozialen Arbeit mit chronisch psychisch kranken Menschen und diskutiert relevante ethische Überlegungen im Kontext der Gesprächsgruppe.
Wo finde ich mehr Informationen über das ZERA-Modell?
Die Diplomarbeit bietet eine detaillierte Beschreibung des ZERA-Modells. Für weiterführende Informationen müsste man sich an die in der Arbeit genannten Quellen wenden oder nach weiteren Publikationen zum ZERA-Modell suchen.
- Citar trabajo
- Sylvena Voll (Autor), 2003, ZERA-Modell. Aufbau einer Gesprächsgruppe für chronisch psychisch Kranke, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/51227