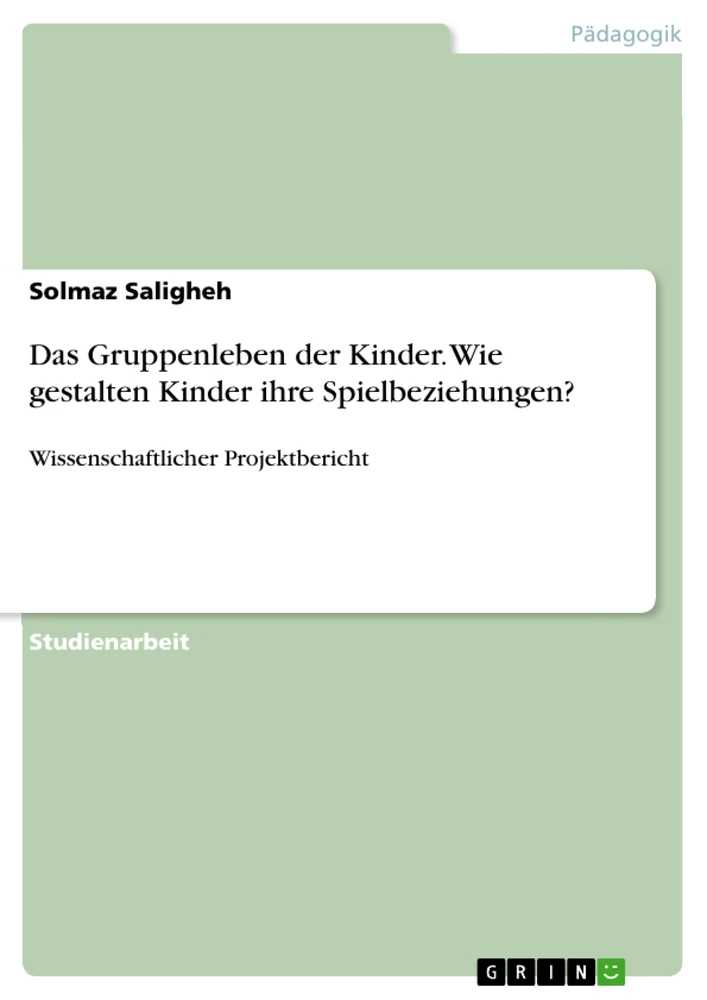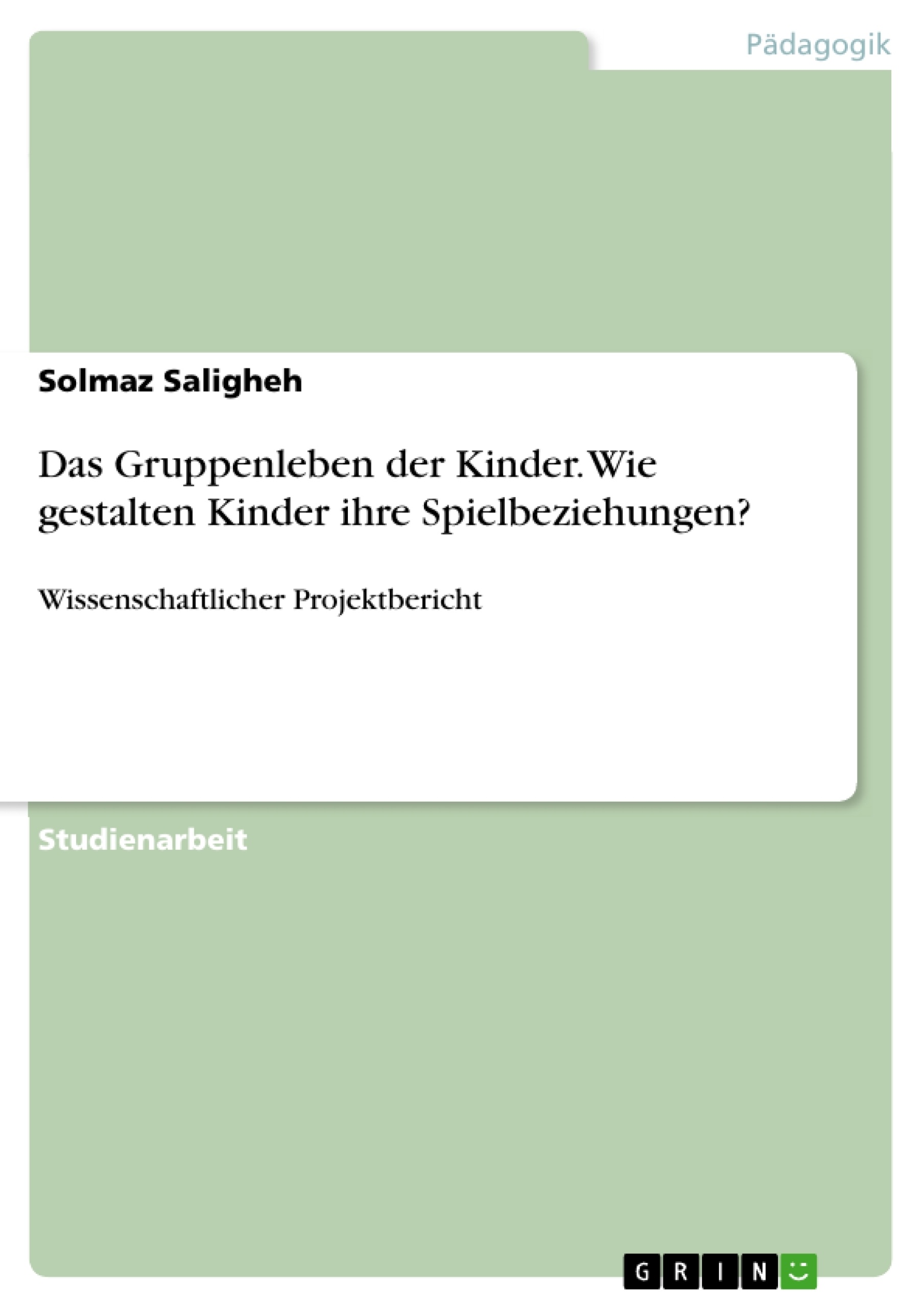Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, wie Kinder ihre Spielbeziehungen gestalten und wie sie in selbst erstellten Gruppen untereinander kommunizieren. Dabei werden unter anderem die Theorien von Piaget, Wygotski und Youniss mit einbezogen.
Kinder sind als soziale Wesen darauf angewiesen, mit anderen Kindern zu interagieren und zu kommunizieren. Beziehungen zu anderen bilden für die meisten von ihnen einen wichtigen, wenn nicht sogar den wichtigsten Bestandteil ihrer Lebensbahn. Fast jeder braucht in bestimmten Situationen und aus bestimmten Gründen andere Personen und wendet sich an sie. Eltern sind in der Regel die erste, aber keineswegs die einzige prägende Sozialisationsinstanz eines Kindes. Die ersten Kinderfreundschaften bilden sich bereits ab dem dritten Lebensjahr, in der Zeit des Eintritts in den Kindergarten. Hier suchen Kinder gezielt nach Spielkameraden. Wenn sich Kinder dann öfter begegnen und miteinander spielen, bilden sich Sympathien, die zur Freundschaft werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition „Peergroups“
- spezifische Merkmale früher Peerbeziehungen
- Soziale Beziehungen im Kindesalter
- Entwicklungstheorien
- Entstehung der Spielgruppen
- Kommunikationstheorie
- Definition „Kommunikation“
- Theorien und Modelle der Kommunikation
- Nonverbale Kommunikationsform
- Übersicht über wichtige Kommunikationsformen
- Kommunikation der Kinder
- Methode
- Nicht-teilnehmende Beobachtung
- Die durchgeführte Beobachtung
- Ergebnisse
- Diskussion und Interpretation
- Schlussfolgerung
- Persönliches Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Gestaltung von Spielbeziehungen und die Kommunikation von Kindern innerhalb selbst erstellter Gruppen. Ziel ist es, zu klären, ob die Beobachtung die Frage anhand verschiedener Theorien belegen kann.
- Definition und spezifische Merkmale früher Peerbeziehungen
- Entwicklungstheorien von Piaget, Wygotski und Youniss im Kontext sozialer Beziehungen
- Entstehung von Spielgruppen und die Rolle der Kommunikation
- Analyse der Kommunikationstheorie und ihrer Anwendung auf Kinder
- Beobachtungsmethoden und Interpretation der gewonnenen Daten
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt den Begriff „Peerbeziehungen“ ein und erläutert die spezifischen Merkmale früher Peerbeziehungen. Die Arbeit geht dabei auf die Bedeutung von Spiel und Übungsfeld für den sozialen Umgang und die Entwicklung eigener Strategien ein. Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit Entwicklungstheorien von Piaget, Wygotski und Youniss im Kontext sozialer Beziehungen. Im Fokus steht die Entwicklung von Spielgruppen und die Rolle der Kommunikation im Kindesalter. Kapitel drei beleuchtet die Kommunikationstheorie und ihre Anwendung auf Kinder. Es werden Definitionen, Theorien, Modelle und verschiedene Formen der Kommunikation, insbesondere die nonverbale Kommunikation, behandelt. Im vierten Kapitel wird die Methode der nicht-teilnehmenden Beobachtung vorgestellt, die in der Arbeit zur Datenerhebung eingesetzt wurde. Das fünfte Kapitel zeigt die Ergebnisse der Beobachtung auf und das sechste Kapitel diskutiert und interpretiert diese im Kontext der zuvor behandelten Theorien. Das siebte Kapitel fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und zieht eine Schlussfolgerung. Im achten Kapitel folgt ein persönliches Fazit, das die Lernprozesse des Projektes aufzeigt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beleuchtet die Themenbereiche Peerbeziehungen, soziale Beziehungen, Kommunikation, Kinder, Spielgruppen, Entwicklungstheorien, Beobachtungsmethoden und Interpretation.
Häufig gestellte Fragen
Was sind "Peergroups" bei Kindern?
Peergroups sind Gruppen von Gleichaltrigen, in denen Kinder soziale Kompetenzen außerhalb der Familie erproben.
Ab welchem Alter bilden sich Kinderfreundschaften?
Erste gezielte Freundschaften und Spielbeziehungen entstehen meist ab dem dritten Lebensjahr mit dem Eintritt in den Kindergarten.
Welche Rolle spielt die nonverbale Kommunikation?
Besonders bei jüngeren Kindern ist die Körpersprache ein wesentliches Mittel, um Spielregeln auszuhandeln und Beziehungen zu festigen.
Welche Theorien werden in der Arbeit zur Kindesentwicklung genutzt?
Die Arbeit stützt sich auf die Ansätze von Piaget, Wygotski und Youniss zur sozialen Interaktion.
Was ist eine "nicht-teilnehmende Beobachtung"?
Es ist eine Forschungsmethode, bei der der Beobachter das Geschehen protokolliert, ohne selbst in das Spiel der Kinder einzugreifen.
- Citation du texte
- Solmaz Saligheh (Auteur), 2017, Das Gruppenleben der Kinder. Wie gestalten Kinder ihre Spielbeziehungen?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/513001