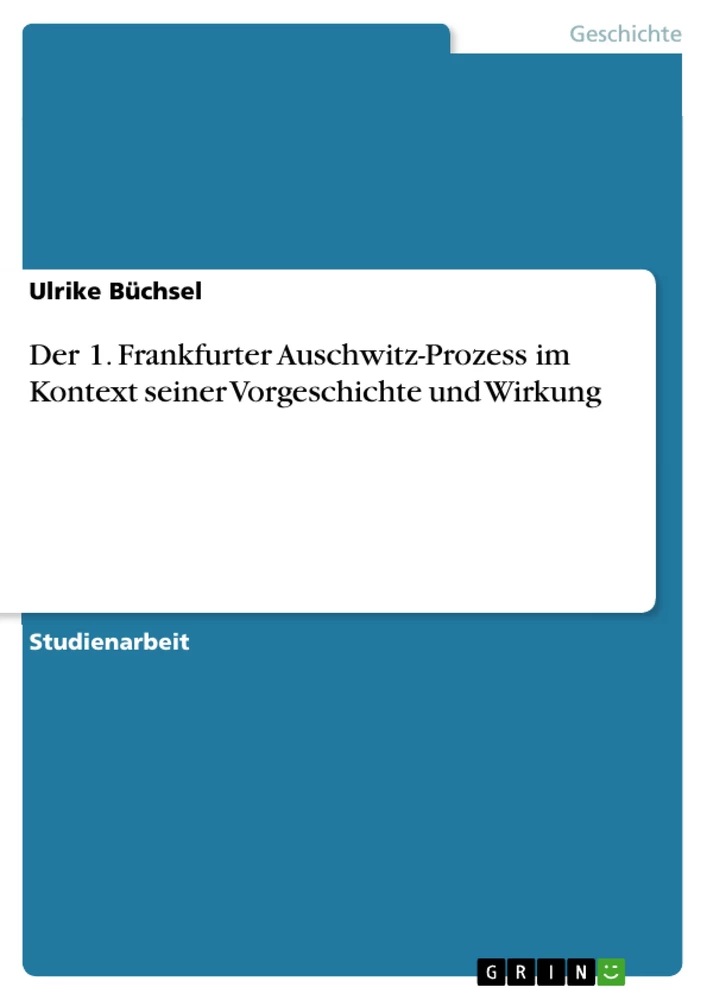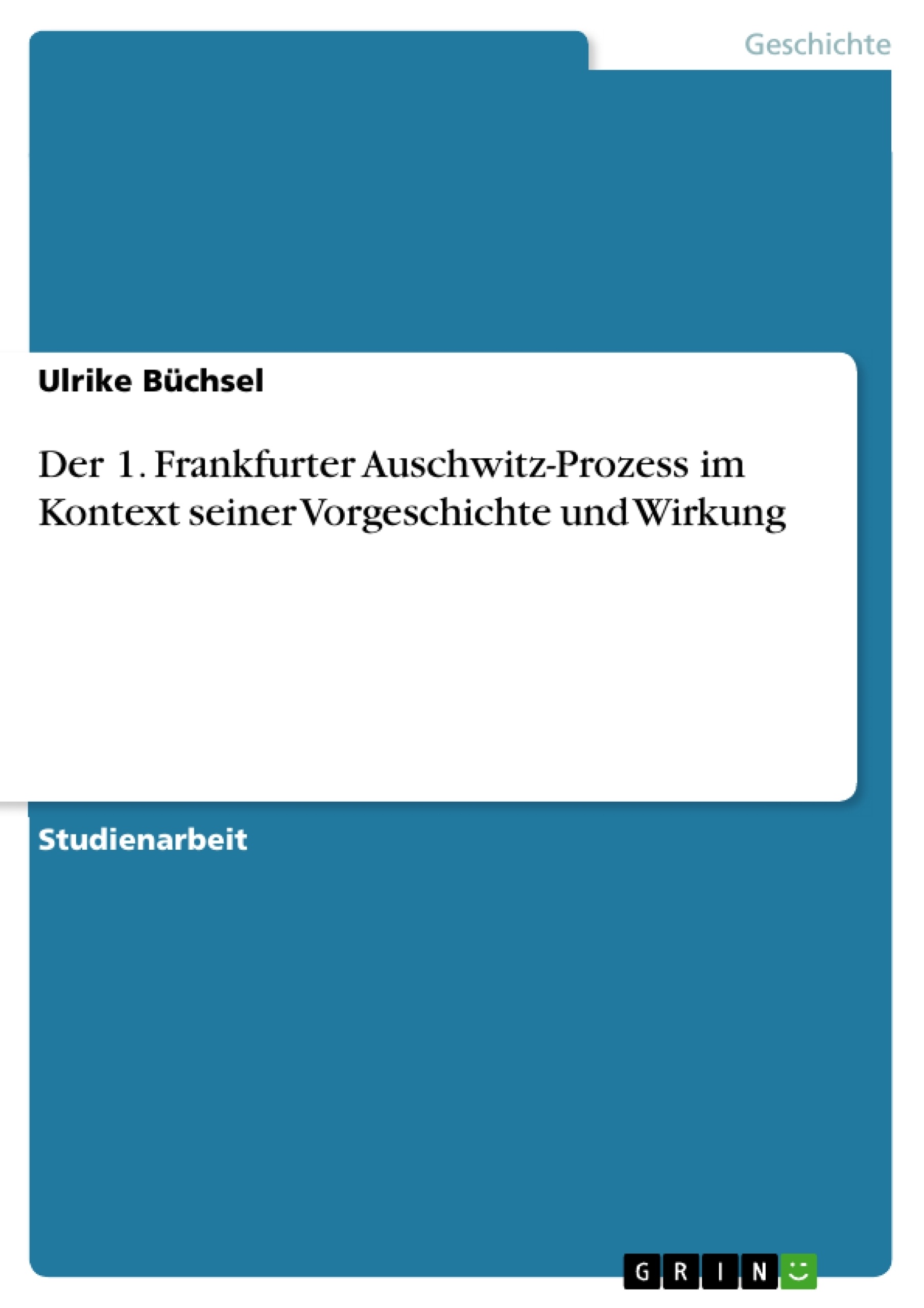Der Auschwitz-Prozess war ein juristisches Großereignis der sechziger Jahre, das den weiteren Verlauf der „Vergangenheitsbewältigung“ sicher entscheidend beeinflusste. Er ist aber gleichzeitig in seiner Form und seinem Ergebnis Resultat einer komplexen Entwicklung der Haltung der deutschen Bevölkerung zur nationalsozialistischen Vergangenheit, und seine spezifischen Eigenheiten sind nur aus dieser heraus zu verstehen. Ziel dieser Arbeit ist es, den Prozess und seine unmittelbare Rezeption in der Öffentlichkeit vor dem Hintergrund jener Entwicklungen zu schildern. Dazu wird zunächst ein Überblick über den gesellschaftlichen, politischen und juristischen Umgang mit dem Nationalsozialismus in den frühen fünfziger Jahren gegeben, um dann die Entwicklung nachzuzeichnen, die dieser im letzten Drittel des Jahrzehnts durchmachte. Dann wird der Auschwitz-Prozess mit seiner Vorgeschichte dargestellt und ein Einblick in die juristischen Grundlagen des Urteils gegeben. Schließlich wird im dritten Kapitel die Presseberichterstattung zum Prozess kurz analysiert und der Versuch unternommen, die allerdings unzureichend dokumentierte Rezeption dieser Berichterstattung zu beschreiben und kurz zu deuten. Bei der verwendeten Literatur sind vor allem die Publikationen des Fritz Bauer-Institutes und Irmtrud Wojaks zu nennen, die den Auschwitz-Prozess am besten abdecken. Außerdem sei auf die Monographie von Gerhard Werle und Thomas Wandres hingewiesen, die neben einer umfassenden Zusammenfassung des Prozesses auch eine auszugsweise Dokumentation des Auschwitz-Urteils bietet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die deutsche Öffentlichkeit und die NS-Vergangenheit in den fünfziger Jahren
- Die frühen fünfziger Jahre
- Beginn eines Umschwungs
- Auschwitz-Prozess in Frankfurt a. M. 1963-1965
- Vorgeschichte
- Der Prozess
- Das Urteil
- Der Auschwitz-Prozess und die deutsche Öffentlichkeit
- Die Presseberichterstattung
- Die Wirkung des Prozesses: Versuch einer Deutung
- Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den ersten Frankfurter Auschwitz-Prozess im Kontext seiner Vorgeschichte und Wirkung auf die deutsche Öffentlichkeit. Ziel ist es, den Prozess und seine Rezeption vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen, politischen und juristischen Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit in den 1950er Jahren zu analysieren.
- Der gesellschaftliche Umgang mit der NS-Vergangenheit in den frühen 1950er Jahren.
- Die Vorgeschichte und der Ablauf des Frankfurter Auschwitz-Prozesses.
- Das Urteil des Auschwitz-Prozesses und seine juristischen Grundlagen.
- Die Presseberichterstattung zum Prozess und die öffentliche Rezeption.
- Die Entwicklung der öffentlichen Meinung zur NS-Vergangenheit im Laufe der 1950er Jahre.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des ersten Frankfurter Auschwitz-Prozesses ein und betont dessen Bedeutung für die „Vergangenheitsbewältigung“. Sie hebt hervor, dass der Prozess und sein Ergebnis aus der Entwicklung der Haltung der deutschen Bevölkerung zur NS-Vergangenheit zu verstehen sind. Die Arbeit verfolgt das Ziel, den Prozess und seine öffentliche Rezeption vor diesem Hintergrund zu schildern, beginnend mit einem Überblick über den Umgang mit dem Nationalsozialismus in den frühen 1950er Jahren.
Die deutsche Öffentlichkeit und die NS-Vergangenheit in den fünfziger Jahren: Dieses Kapitel beschreibt den ambivalenten Umgang der deutschen Öffentlichkeit mit der NS-Vergangenheit in den 1950er Jahren. Es zeigt den Widerspruch zwischen dem staatlichen Neubeginn und der Integration ehemaliger Nationalsozialisten. Der Wunsch nach einem „Ruhenlassen der Vergangenheit“ mündete in ein weit verbreitetes Schweigen, während die Schuld oft einer „verbrecherischen Clique“ zugeschrieben wurde. Das Kapitel beleuchtet die Kontinuität antisemitischer Einstellungen und die personelle Kontinuität im deutschen Staatsapparat, inklusive der Justiz und Verwaltung. Die „Vergangenheitspolitik“ der Bundesregierung, einschließlich der Straffreiheitsgesetze, wird kritisch beleuchtet. Die Ambivalenz und der Widerspruch zwischen dem staatlichen Anspruch auf einen demokratischen Neuanfang und der faktischen Integration vieler ehemaliger Nationalsozialisten wird umfassend dargestellt und anhand von Meinungsforschung und historischer Analyse belegt.
Schlüsselwörter
Auschwitz-Prozess, NS-Vergangenheit, Vergangenheitsbewältigung, Bundesrepublik Deutschland, 1950er Jahre, öffentliche Meinung, Presseberichterstattung, Justiz, Straffreiheitsgesetze, Antisemitismus, personelle Kontinuität.
Häufig gestellte Fragen zum Frankfurter Auschwitz-Prozess und die deutsche Öffentlichkeit
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert den ersten Frankfurter Auschwitz-Prozess (1963-1965) im Kontext seiner Vorgeschichte und seiner Wirkung auf die deutsche Öffentlichkeit in den 1950er Jahren. Der Fokus liegt auf der Rezeption des Prozesses vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen, politischen und juristischen Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den gesellschaftlichen Umgang mit der NS-Vergangenheit in den frühen 1950er Jahren, die Vorgeschichte und den Ablauf des Frankfurter Auschwitz-Prozesses, das Urteil und seine juristischen Grundlagen, die Presseberichterstattung und die öffentliche Rezeption, sowie die Entwicklung der öffentlichen Meinung zur NS-Vergangenheit im Laufe der 1950er Jahre. Besonderes Augenmerk liegt auf der Ambivalenz und den Widersprüchen zwischen staatlichem Anspruch auf einen demokratischen Neuanfang und der faktischen Integration ehemaliger Nationalsozialisten.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zur deutschen Öffentlichkeit und der NS-Vergangenheit in den 1950er Jahren, zum Auschwitz-Prozess selbst (Vorgeschichte, Prozessverlauf, Urteil), zur Wirkung des Prozesses auf die Öffentlichkeit (insbesondere die Presseberichterstattung) und ein Schlusswort. Ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter sind ebenfalls enthalten.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf eine Kombination aus Meinungsforschung, historischer Analyse und der Untersuchung der damaligen Presseberichterstattung. Konkrete Quellenangaben werden im Haupttext der Arbeit selbst aufgeführt (diese sind in der vorliegenden Vorschau nicht enthalten).
Was sind die zentralen Ergebnisse?
Die zentralen Ergebnisse werden im Hauptteil der Arbeit dargelegt und lassen sich hier nur summarisch wiedergeben. Die Arbeit beleuchtet den ambivalenten Umgang der deutschen Gesellschaft mit der NS-Vergangenheit, den Widerspruch zwischen dem staatlichen Neubeginn und der Integration ehemaliger Nationalsozialisten, und die Rolle des Frankfurter Auschwitz-Prozesses als Wendepunkt in der öffentlichen Auseinandersetzung mit der Vergangenheit. Die Analyse der Presseberichterstattung liefert wichtige Erkenntnisse über die öffentliche Rezeption des Prozesses.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Auschwitz-Prozess, NS-Vergangenheit, Vergangenheitsbewältigung, Bundesrepublik Deutschland, 1950er Jahre, öffentliche Meinung, Presseberichterstattung, Justiz, Straffreiheitsgesetze, Antisemitismus, personelle Kontinuität.
- Citation du texte
- Ulrike Büchsel (Auteur), 2005, Der 1. Frankfurter Auschwitz-Prozess im Kontext seiner Vorgeschichte und Wirkung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/51329