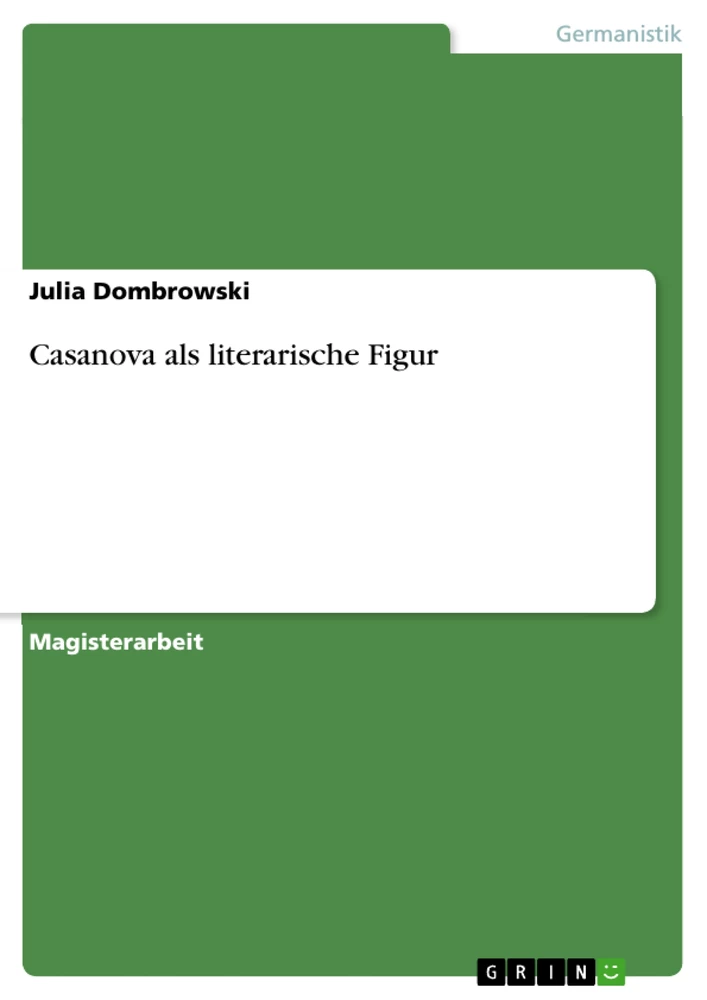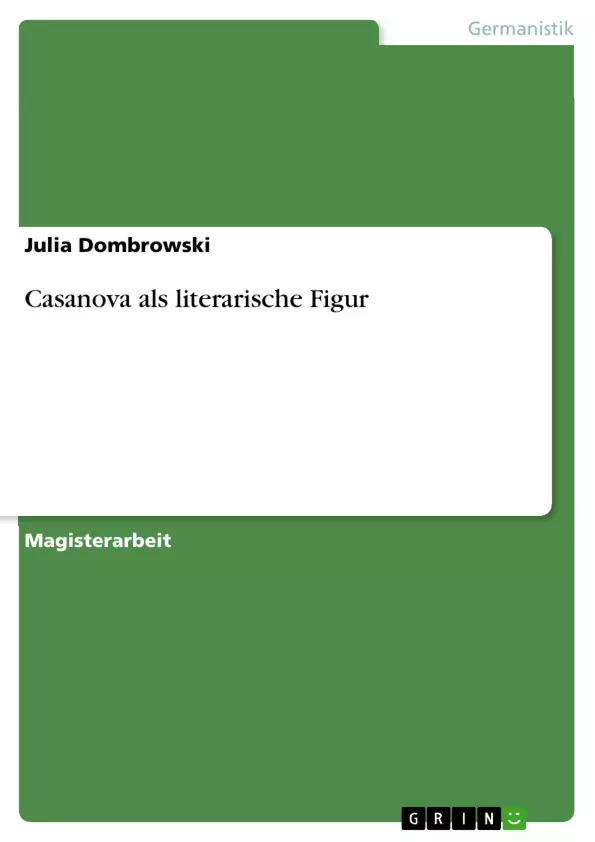Einleitung
Seit 1833 tritt in der europäischen Literatur und auf Europas Bühnen immer wieder eine Gestalt namens Casanova in Erscheinung. Diese literarische Figur hat ein historisches Vorbild: den Abenteurer, Schriftsteller, Juristen, Theologen, Diplomaten und Erfinder der Lotterie Giacomo Giovanni Casanova. Erwiesenermaßen 1725 in Venedig geboren und 1798 auf Schloß Dux in Böhmen gestorben, hinterließ er in Selbstzeugnissen einen umfassenden Bericht über sein Leben. In diesen Aufzeichnungen, die in französischer Sprache unter dem Titel »Histoire de ma vie« verfaßt und erstmalig postum 1822 in deutscher Übersetzung unter dem Titel „Geschichte meines Lebens“ von F.A. Brockhaus in Leipzig veröffentlicht wurden, hat der Transfer vom historischen Casanova in die literarisierte Figur erstmals stattgefunden. Doch der historische Mensch ist hinter dem stilisierten Charakter nicht mehr wiederzuerkennen, wie in den folgenden Kapiteln deutlich werden wird.
Der historische und der literarische Casanova haben selbstverständlich mehr miteinander gemein als ihren Namen; literarische Verarbeitungen beziehen sich immer wieder auf die Episoden, die aus dem Leben des Venezianers überliefert sind. Die Häufigkeit, mit der Casanova in der Literatur auftaucht und die Wiederholung einer Motivik1 läßt begründet vom ‚Casanova-Stoff‘ sprechen. Aber auch in Verarbeitungen, deren Protagonist den Namen Casanova trägt, deren Handlung darüber hinaus aber frei erfunden ist, ist der Held zweifelsfrei als ‚der‘ Casanova identifizierbar.
Welchem Typus die literarische Figur scheinbar entspricht, ist in einem gewöhnlichen Wörterbuch nachzuschlagen. Dort ist unter dem Stichwort ‚Casanova‘ der Eintrag „Frauenheld, Verführer“2 zu lesen, eine Definition, die sich irritierenderweise ebenso bei ‚Don Juan‘ findet.3 Hier spiegelt sich ein verbreiteter Volksglaube wider, nach dem sowohl Don Juan als auch Casanova identische Prototypen des Verführers sind. Dieser Schluß ist jedoch unzulässig.
---
1 Als Motive lassen sich beispielsweise eine große Anzahl Liebschaften, Untreue, ein abenteuerliches Leben, das den Protagonisten weit über die Grenzen seiner Heimat hinaus treibt, aufführen.
2 Eintrag „Casanova“ in: Brockhaus-Wahrig. Deutsches Wörterbuch in sechs Bänden. Hg. von Gerhard Wahrig, Hildegard Krämer, Harald Zimmermann. Zweiter Band BU – FZ. Wiesbaden, Stuttgart 1981. S.73.
3 Vgl. Eintrag ‚Don Juan‘ in: Ebd., S.263.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der literarische Mythos
- 3. Casanovas „Geschichte meines Lebens“
- 3.1 Die Autobiographie als literarische Gattung
- 3.2 Casanovas Selbstdarstellung
- 3.2.1 Erzähltechniken
- 3.2.2 Selbststylisierung als erotischer Held
- 3.2.3 Selbststylisierung als Abenteurer
- 4. Literarische Verarbeitungen des Casanova-Stoffes
- 4.1 Casanova im Kontext des Wiener Umfelds
- 4.2 Arthur Schnitzlers „Casanovas Heimfahrt“: Umkehrung eines Mythos
- 4.2.1 Legende, Verklärung und Realitätsferne als Elemente des Casanova-Bildes
- 4.2.2 Der Casanova der Gegenwart
- 4.2.2.1 Kompensatorische Gewalt
- 4.2.2.2 Omnipotenzstreben
- 4.2.2.3 Ambivalente Rolle Venedigs
- 4.2.3 Verhältnis von Erzählen und Erzähleridentität
- 4.2.4 „Casanovas Heimfahrt“ als Abgrenzung zum Wiener Umfeld
- 4.3 Arthur Schnitzlers „Die Schwestern oder Casanova in Spa“: Casanova als „Bruder Leichtfuß“
- 4.4 Fellinis Casanova
- 4.4.1 Umdeutung der autobiographischen Stylisierung
- 4.4.2 Infantilisierung
- 4.5 Das Mythenverständnis bei Schnitzler und Fellini
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht die Entwicklung der literarischen Figur Casanova von ihren historischen Ursprüngen bis zu ihrer Rezeption in der Literatur des 20. Jahrhunderts. Die Arbeit analysiert die verschiedenen Interpretationen und Umdeutungen des Casanova-Mythos, fokussiert auf die literarischen Bearbeitungen und deren jeweilige Darstellung des Protagonisten.
- Die Transformation des historischen Giacomo Casanova in eine literarische Figur.
- Die Entwicklung des Casanova-Mythos in der Literatur.
- Die verschiedenen literarischen Darstellungen Casanovas und deren Charakteristika.
- Der Vergleich der Casanova-Interpretationen bei Schnitzler und Fellini.
- Die Auseinandersetzung mit dem Bild des „Frauenhelden“ und dessen Ambivalenzen.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die zentrale Frage nach der Transformation des historischen Casanova in eine literarische Figur. Sie betont die Diskrepanz zwischen historischer Person und dem stilisierten Charakter in der Literatur und kündigt die nachfolgende Analyse der verschiedenen literarischen Verarbeitungen an, wobei der Fokus auf den „Casanova-Stoff“ und dessen Wiederholung in der Literatur liegt. Die Einleitung differenziert bereits zwischen dem historischen Casanova und der vielschichtigen literarischen Figur, die im Laufe der Zeit verschiedene Interpretationen erfahren hat, von der einseitigen Darstellung als Frauenheld bis hin zu komplexeren Charakterstudien.
2. Der literarische Mythos: Dieses Kapitel beleuchtet die Entstehung des Casanova-Mythos und seine Verbreitung in der europäischen Literatur und Kultur. Es wird die Entwicklung des Bildes Casanovas als "Frauenheld" und "Abenteurer" analysiert und die damit verbundenen Stereotypen untersucht. Die Entstehung des Mythos wird im Kontext der Rezeption seiner "Geschichte meines Lebens" diskutiert. Das Kapitel legt den Grundstein für die spätere Analyse der literarischen Verarbeitungen, indem es den bereits etablierten Mythos und dessen Interpretationen in den verschiedenen literarischen Werken herausstellt.
3. Casanovas „Geschichte meines Lebens“: Dieses Kapitel widmet sich Casanovas Autobiografie als Grundlage für die literarischen Verarbeitungen. Es analysiert die Autobiografie als literarische Gattung und beleuchtet Casanovas Selbstdarstellung, seine Erzähltechniken und seine Selbstinszenierung sowohl als erotischer Held als auch als Abenteurer. Es wird die Frage nach der Authentizität seiner Darstellung und dem Verhältnis zwischen historischer Person und literarischer Figur untersucht. Durch die detaillierte Auseinandersetzung mit den erzählerischen Mitteln und der Selbstinszenierung in Casanovas Autobiografie wird die Basis für das Verständnis späterer literarischer Adaptionen gelegt, die häufig auf diese Selbstdarstellung Bezug nehmen.
4. Literarische Verarbeitungen des Casanova-Stoffes: Dieses Kapitel analysiert verschiedene literarische Verarbeitungen des Casanova-Stoffes, wobei der Fokus auf den Werken Arthur Schnitzlers und Federico Fellinis liegt. Es werden die unterschiedlichen Interpretationen und Umdeutungen des Casanova-Mythos in diesen Werken untersucht und die jeweiligen Darstellungen des Protagonisten miteinander verglichen. Die Analyse umfasst die Betrachtung von Schnitzlers "Casanovas Heimfahrt" und "Die Schwestern oder Casanova in Spa", sowie Fellinis Film "Casanova". Die Kapitel untersuchen die Motivverwendung, die Charakterisierung und die Gesamtinszenierung des Protagonisten, um Unterschiede und Gemeinsamkeiten in den verschiedenen Adaptionen zu identifizieren. Dabei wird auch auf die jeweiligen historischen und kulturellen Kontexte eingegangen.
Schlüsselwörter
Casanova, literarische Figur, Mythos, Autobiografie, Selbstdarstellung, erotischer Held, Abenteurer, literarische Verarbeitungen, Arthur Schnitzler, Federico Fellini, Wiener Umfeld, Mythenverständnis, Rezeption.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu der Magisterarbeit: Literarische Rezeption des Casanova-Mythos
Was ist der Gegenstand der Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit untersucht die Entwicklung der literarischen Figur Casanova von ihren historischen Ursprüngen bis zu ihrer Rezeption in der Literatur des 20. Jahrhunderts. Im Mittelpunkt steht die Analyse verschiedener Interpretationen und Umdeutungen des Casanova-Mythos, insbesondere in literarischen Bearbeitungen und deren Darstellung des Protagonisten.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Transformation des historischen Giacomo Casanova in eine literarische Figur, die Entwicklung des Casanova-Mythos in der Literatur, verschiedene literarische Darstellungen Casanovas und deren Charakteristika, einen Vergleich der Casanova-Interpretationen bei Schnitzler und Fellini, sowie die Auseinandersetzung mit dem Bild des „Frauenhelden“ und dessen Ambivalenzen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Eine Einleitung, ein Kapitel zum literarischen Mythos, ein Kapitel zu Casanovas „Geschichte meines Lebens“ und ein Kapitel zu literarischen Verarbeitungen des Casanova-Stoffes. Letzteres konzentriert sich auf die Werke Arthur Schnitzlers und Federico Fellinis.
Was ist der Fokus des Kapitels "Der literarische Mythos"?
Dieses Kapitel beleuchtet die Entstehung und Verbreitung des Casanova-Mythos, analysiert die Entwicklung seines Bildes als "Frauenheld" und "Abenteurer" und untersucht die damit verbundenen Stereotype. Die Entstehung des Mythos wird im Kontext der Rezeption seiner "Geschichte meines Lebens" diskutiert.
Worauf konzentriert sich das Kapitel über Casanovas "Geschichte meines Lebens"?
Dieses Kapitel analysiert Casanovas Autobiografie als Grundlage für spätere literarische Verarbeitungen. Es untersucht die Autobiografie als literarische Gattung, Casanovas Selbstdarstellung, seine Erzähltechniken und seine Selbstinszenierung als erotischer Held und Abenteurer. Die Authentizität seiner Darstellung und das Verhältnis zwischen historischer Person und literarischer Figur werden ebenfalls untersucht.
Wie werden Schnitzlers und Fellinis Werke behandelt?
Das Kapitel zu den literarischen Verarbeitungen analysiert Schnitzlers "Casanovas Heimfahrt" und "Die Schwestern oder Casanova in Spa", sowie Fellinis Film "Casanova". Es vergleicht die unterschiedlichen Interpretationen und Umdeutungen des Casanova-Mythos in diesen Werken und deren jeweilige Darstellung des Protagonisten. Die Analyse umfasst Motivverwendung, Charakterisierung und Gesamtinszenierung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Casanova, literarische Figur, Mythos, Autobiografie, Selbstdarstellung, erotischer Held, Abenteurer, literarische Verarbeitungen, Arthur Schnitzler, Federico Fellini, Wiener Umfeld, Mythenverständnis, Rezeption.
Welche zentrale Forschungsfrage wird gestellt?
Die zentrale Frage der Arbeit ist die nach der Transformation des historischen Casanova in eine literarische Figur und die Analyse der vielschichtigen Interpretationen dieser Figur in der Literatur.
- Quote paper
- Julia Dombrowski (Author), 2005, Casanova als literarische Figur, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/51333