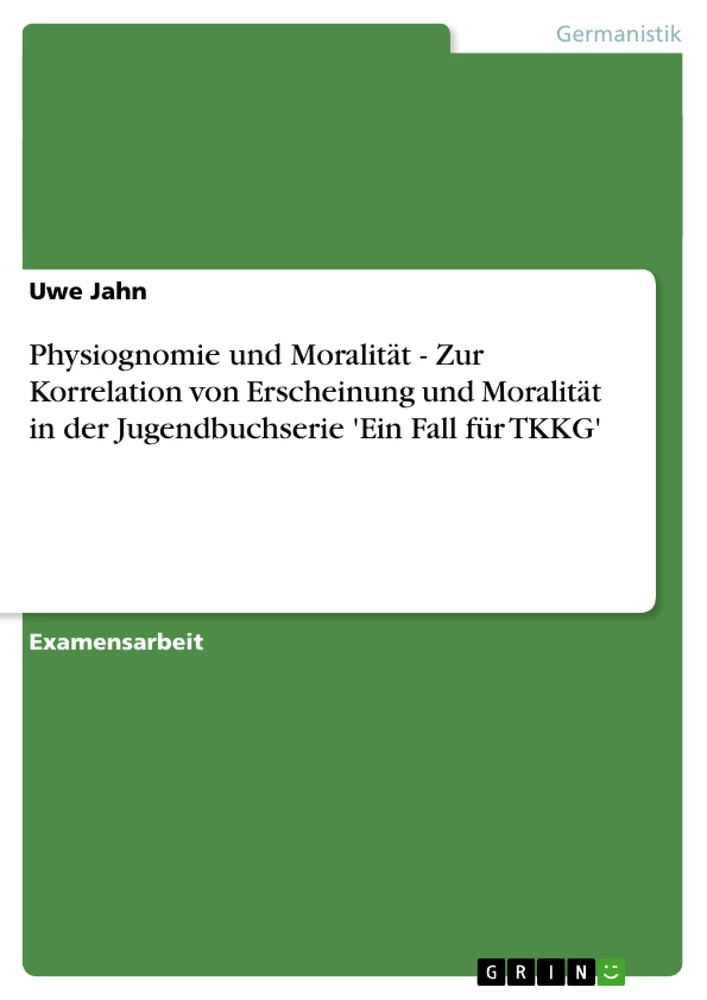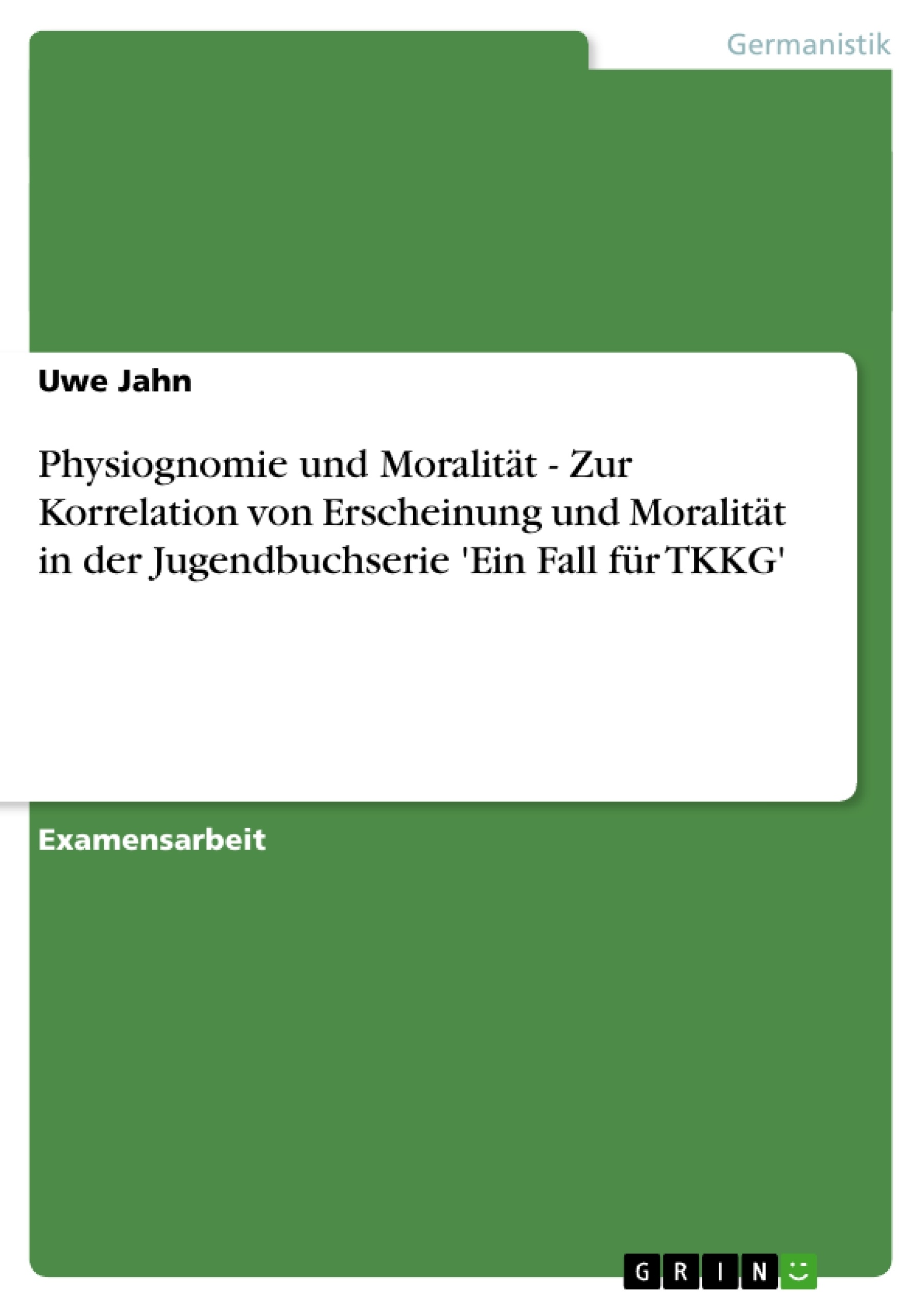Einleitung
Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit ist die von Ralf Kalmuczek unter dem Pseudonym Stefan Wolf geschriebene Jugendbuchserie Ein Fall für TKKG.1 Seit 1979 erscheinen die einzelnen Bände, von denen bisher 102 veröffentlicht wurden. Der Erfolg der Reihe wird aus den hohen Verkaufszahlen deutlich, bereits 1982 waren über eine Million Bücher verkauft, 1997 waren es insgesamt zehn Millionen.2
Die Bezeichnung „TKKG“ setzt sich aus den Anfangsbuchstaben der Namen bzw. Spitznamen der Mitglieder zusammen: Peter Carsten, der Tarzan/Tim3 gerufen wird, Karl mit dem Spitznamen Computer, Willi Sauerlich alias Klößchen und Gaby Glockner, auch Pfote genannt. Ein „Ehrenmitglied“ von TKKG ist Gabys Cockerspaniel Oskar. Die TKKG-Bande hat sich zum Ziel gesetzt, Unrecht und Verbrechen zu bekämpfen, wann und wo immer sie damit in Kontakt kommen, und so werden in den einzelnen Abenteuern eigenständig Verbrechen aufgeklärt und die Täter am Ende der Polizei übergeben.
Neben den vier jugendlichen Protagonisten und Oskar gibt es noch die Figur des Kommissars Glockner, Gabys Vater, der in der Mehrzahl der Folgen, spätestens bei der Verhaftung der überführten Verbrecher, selbst auftritt, ansonsten zumindest in Gesprächen erwähnt wird. Auf Seiten der Antagonisten gibt es keine wiederkehrenden Personen, die Skizzierung dieser Figuren folgt allerdings einem starren Muster.
Diese Arbeit untersucht die Art und Weise der Figurenzeichnung und –charakterisierung. Dabei fragt sie danach, ob und wie die äußere Darstellung der Figuren mit ihrer moralischen Charakterisierung einhergeht.
---
1 Im weiteren Verlauf dieser Arbeit wird auf den Autoren unter seinem Pseudonym Stefan Wolf verwiesen.
2 Die Verkaufszahlen der TKKG-Reihe finden sich in: TKKG-Online. URL: http://www.tkkg-online.de/buecher /buecher_frame.htm. [letzter Besuch: 18.08.2005].
3 Der frühere Spitzname von Tim, Tarzan, wird im Verlauf der Reihe auf dessen eigenen Wunsch zu Tim geändert. Die Gründe hierfür wie auch die Gründe, die zu den Spitznamen der anderen Bandenmitglieder geführt haben, werden im Verlauf der Arbeit expliziert. Im folgenden Text wird der Name Tim verwendet. Zitate, in denen ‚Tarzan’ verwendet wird, entstammen Bänden, die vor dem Wechsel geschrieben wurden, es handelt sich aber immer um ein und dieselbe Person.
Inhaltsverzeichnis
- I.) Einleitung
- II.) Kriminal- und Jugendkriminalliteratur
- III.) Körper und Moralität
- IV.) Charakterisierungen
- IV.1.) Schemata der Figurenkonzeption
- V.) Die Protagonisten
- V.1.) Tim, seine Freunde und ihre Rollen innerhalb der Erzählungen
- V.2.) Die Körper der Helden als Ausdrucksfläche ihres Charakters
- V.3.) TKKG als Identifikationsfiguren und Projektionsfläche
- VI.) Die Antagonisten
- VI.1.) Der jugendliche Schlägertyp oder Rocker
- VI.1.1.) Rudi Kaluschke
- VI.1.2.) Otto Seibold
- VI.1.3.) Fazit jugendlicher Schlägertyp oder Rocker
- VI.2.) Der Gewohnheitsverbrecher
- VI.2.1.) Sigi Malowitz und Herbert Gerlich
- VI.2.2.) Bert Zierhaus und Hajo Kerber
- VI.2.3.) Fazit Gewohnheitsverbrecher
- VI.3.) Der Drogenhändler
- VI.3.1.) „Boxernase“ Zaulich
- VI.3.2.) Dietmar Uhl
- VI.3.3.) Fazit Drogenhändler
- VI.4.) Der Verrückte
- VI.4.1.) Norbert Jokel
- VI.4.2.) Otto Plegel
- VI.4.3.) Fazit Verrückter
- VI.5.) Typologie der Verbrecher in TKKG
- VI.1.) Der jugendliche Schlägertyp oder Rocker
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Figurenzeichnung und -charakterisierung in der Jugendbuchserie „Ein Fall für TKKG“ und analysiert die Korrelation zwischen dem äußeren Erscheinungsbild der Figuren und ihrer moralischen Bewertung. Das Hauptziel ist es, zu erforschen, wie die Serie Stereotypen verwendet und ob und wie die visuelle Darstellung (durch Illustrationen) die moralische Beurteilung der Figuren verstärkt.
- Die Darstellung von Kriminalität und Jugendlichen in der Literatur
- Der Zusammenhang zwischen physischem Aussehen und moralischer Bewertung von Figuren
- Die Verwendung von Stereotypen in der Charakterisierung von Protagonisten und Antagonisten
- TKKG als Identifikationsfiguren und Projektionsfläche für Jugendliche
- Analyse der Typologie der Verbrecherfiguren in der Serie
Zusammenfassung der Kapitel
I.) Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und stellt die Jugendbuchserie „Ein Fall für TKKG“ als Untersuchungsgegenstand vor. Sie erwähnt den Erfolg der Serie und beschreibt die Hauptfiguren (TKKG) und ihre Rolle bei der Aufklärung von Verbrechen. Besonders hervorgehoben wird die Rolle der Illustrationen und die Fragestellung, ob und wie das Aussehen der Figuren deren moralische Bewertung beeinflusst. Die Einleitung legt den Fokus auf die Verbindung von physischer Erscheinung und moralischer Charakterisierung, ein zentraler Aspekt der gesamten Arbeit.
II.) Kriminal- und Jugendkriminalliteratur: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die literarischen Konventionen und Merkmale von Kriminal- und Jugendkriminalliteratur. Es beleuchtet, wie Kriminalität und jugendliche Täter in diesem Genre dargestellt werden. Wahrscheinlich werden hier gängige Tropen und narrative Strukturen diskutiert, um den Kontext für die spätere Analyse der „TKKG“-Serie zu schaffen. Der Abschnitt liefert die theoretischen Grundlagen für die spätere detaillierte Analyse der Figuren in der untersuchten Serie.
III.) Körper und Moralität: Dieses Kapitel befasst sich mit der theoretischen Grundlage des Zusammenhangs von Körper und Moralität. Es wird wahrscheinlich auf literaturwissenschaftliche und soziologische Theorien eingegangen, die die Beziehung zwischen physischer Erscheinung und moralischer Bewertung beleuchten. Das Kapitel dürfte wichtige Begriffe und Konzepte einführen, die für die spätere Analyse der Figuren in „Ein Fall für TKKG“ unerlässlich sind. Es wird den theoretischen Rahmen für die Interpretation der visuellen und beschreibenden Elemente in den Büchern liefern.
IV.) Charakterisierungen: Dieses Kapitel analysiert die Charakterisierung der Figuren in der „TKKG“-Serie, möglicherweise mit dem Fokus auf den schematischen Aufbau der Figurenkonzeption. Es untersucht, wie die Figuren in Bezug auf ihr Aussehen und ihre Persönlichkeit konstruiert werden und welche Rolle Stereotypen dabei spielen. Der Schwerpunkt liegt wohl auf den Methoden und Techniken der Charakterisierung und der Darstellung von moralischen Eigenschaften. Es könnte auch die Rolle der Illustrationen im Kontext der Charakterisierung betrachten.
V.) Die Protagonisten: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die vier Hauptfiguren (TKKG) und ihre Darstellung in der Serie. Es analysiert ihre Rollen innerhalb der Geschichten, ihre physische Beschreibung und wie diese mit ihren Charakteren zusammenhängt, sowie ihre Funktion als Identifikationsfiguren für junge Leser. Der Abschnitt beleuchtet wahrscheinlich die positiven Eigenschaften der Protagonisten und wie diese durch ihr Aussehen und ihre Handlungen hervorgehoben werden.
VI.) Die Antagonisten: Dieser Abschnitt untersucht die verschiedenen Antagonistentypen in der „TKKG“-Serie, kategorisiert nach bestimmten Mustern (z.B. jugendliche Schläger, Gewohnheitsverbrecher, Drogenhändler, Verrückte). Für jeden Typ wird wahrscheinlich eine detaillierte Analyse der physischen Beschreibungen und der zugehörigen moralischen Eigenschaften erfolgen. Der Fokus liegt auf der stereotypen Darstellung von Kriminalität und Bösewichten und deren Funktion innerhalb der Erzählungen.
Schlüsselwörter
TKKG, Jugendbuchserie, Kriminalität, Jugendkriminalität, Figurencharakterisierung, Physiognomie, Moralität, Stereotypen, Illustrationen, Identifikationsfiguren, Antagonisten, Protagonisten, äußeres Erscheinungsbild, moralische Bewertung, Stigma.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse der Figurenzeichnung in der Jugendbuchserie "Ein Fall für TKKG"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Figurenzeichnung und -charakterisierung in der Jugendbuchserie "Ein Fall für TKKG". Der Fokus liegt auf dem Zusammenhang zwischen dem äußeren Erscheinungsbild der Figuren und ihrer moralischen Bewertung, sowie der Verwendung von Stereotypen.
Welche Aspekte der Serie werden untersucht?
Die Analyse umfasst die Darstellung von Kriminalität und Jugendlichen, den Zusammenhang zwischen physischem Aussehen und moralischer Bewertung, die Verwendung von Stereotypen bei Protagonisten und Antagonisten, TKKG als Identifikationsfiguren und eine Typologie der Verbrecherfiguren.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Kriminal- und Jugendkriminalliteratur, Körper und Moralität, Charakterisierungen, Die Protagonisten (TKKG) und Die Antagonisten. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt der Figurenzeichnung und der Serie insgesamt.
Wie werden die Protagonisten (TKKG) dargestellt?
Das Kapitel über die Protagonisten analysiert ihre Rollen in den Geschichten, ihre physische Beschreibung und den Zusammenhang mit ihren Charakteren. Es untersucht auch ihre Funktion als Identifikationsfiguren für junge Leser.
Wie werden die Antagonisten dargestellt?
Die Antagonisten werden nach verschiedenen Typen kategorisiert (jugendliche Schläger, Gewohnheitsverbrecher, Drogenhändler, Verrückte). Für jeden Typ wird die physische Beschreibung und die moralische Bewertung analysiert, mit Fokus auf stereotypische Darstellungen.
Welche Rolle spielen die Illustrationen?
Die Arbeit untersucht, ob und wie die Illustrationen die moralische Beurteilung der Figuren verstärken und zur Charakterisierung beitragen.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf literaturwissenschaftliche und soziologische Theorien zum Zusammenhang von Körper und Moralität, sowie auf die Konventionen der Kriminal- und Jugendkriminalliteratur.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: TKKG, Jugendbuchserie, Kriminalität, Jugendkriminalität, Figurencharakterisierung, Physiognomie, Moralität, Stereotypen, Illustrationen, Identifikationsfiguren, Antagonisten, Protagonisten, äußeres Erscheinungsbild, moralische Bewertung, Stigma.
Was ist das Hauptziel der Arbeit?
Das Hauptziel ist die Erforschung der Verwendung von Stereotypen in der Serie und der Analyse, wie die visuelle Darstellung (Illustrationen) die moralische Beurteilung der Figuren verstärkt.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für akademische Zwecke gedacht und dient der Analyse von Themen in strukturierter und professioneller Weise.
- Citar trabajo
- Uwe Jahn (Autor), 2005, Physiognomie und Moralität - Zur Korrelation von Erscheinung und Moralität in der Jugendbuchserie 'Ein Fall für TKKG', Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/51342