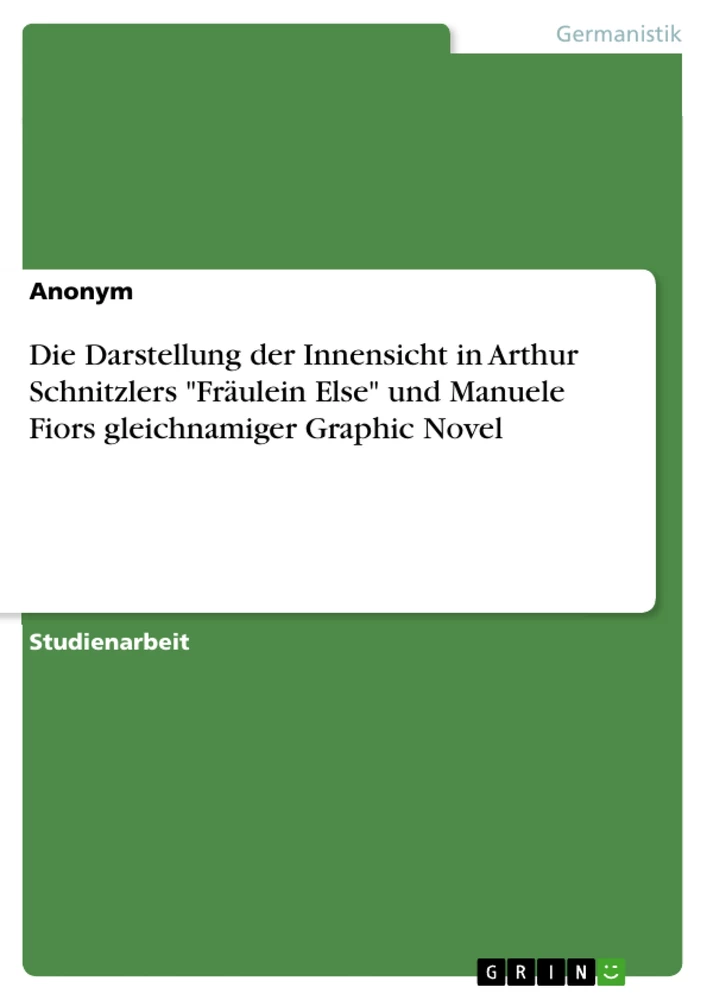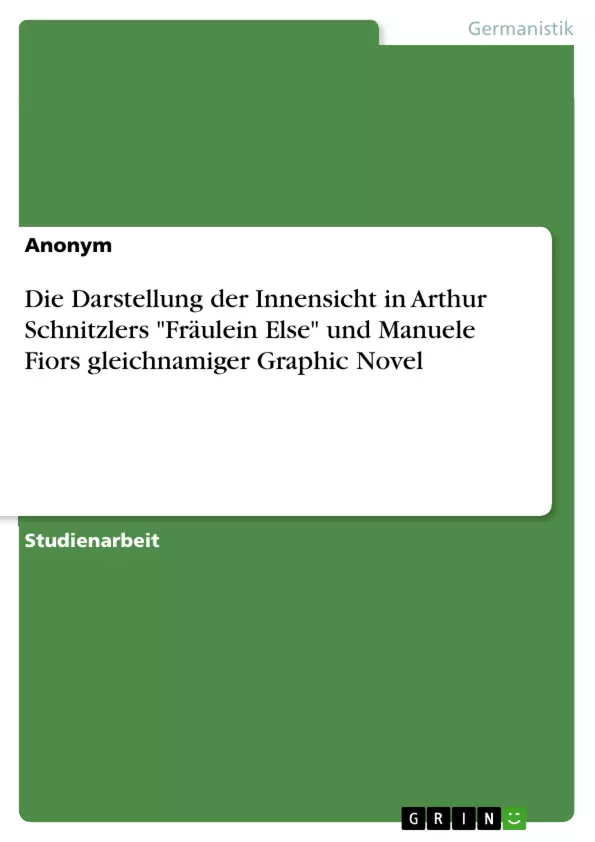In dieser Arbeit werden die Darstellung der Innensicht in Arthur Schnitzlers “Fräulein Else“ und Manuele Fiors gleichnamiger Graphic Novel verglichen. Der Schwerpunkt dieses Vergleichs liegt dabei auf der Darstellung des Inneren Monologs, da diese ein besonderes, stilistisches Merkmal der Novelle und somit des Prätextes darstellt. Die der Arbeit zugrundeliegende These lautet: Manuele Fiors Adaption von “Fräulein Else“ ist aufgrund genrespezifischer Eigenschaften der Graphic Novel in der Lage, die Darstellung des Inneren Monologs vielschichtiger umzusetzen. Um beide Werke miteinander vergleichen zu können, wird im zweiten Teil dieser Arbeit jeweils die “Entblößungsszene“ analysiert.
Der Wiener Schriftsteller Arthur Schnitzler führte 1900 ein neues Stilmittel in den deutschsprachigen Raum ein. Leutnant Gustl war die erste Novelle, in der das sprachliche Mittel des Inneren Monologs konsequent verwendet wurde. Im Oktober 1924 erschien Schnitzlers zweite “Monolognovelle“ Fräulein Else. Es fasziniert, dass dem Leser fast ausschließlich, nur stellenweise mittels wörtlicher Rede unterbrochen, die psychologische Innensicht der Protagonistin Else geschildert wird. Man ist dadurch als Leser in der Lage, unmittelbar von Elses intimsten Gefühlen und Gedankengängen Kenntnis zu nehmen.
Die geringe Distanz zwischen Figur und Leser, die Schnitzler schafft, macht das Rezipieren dieses Werkes so reizvoll. Sowohl die inhaltliche Brisanz der Novelle als auch dessen stilistische Umsetzung, trugen zum großen Interesse an diesem literarischen Werk bei. Im Jahr 2009 wurde eine weitere mediale Adaption des Werkes Fräulein Else, erstmals als Graphic Novel durch Manuele Fior, veröffentlicht. Ein Jahr später erschien diese, übersetzt ins Deutsche von Maximilian Lenz, im avant-verlag. Manuele Fiors Graphic Novel erfreut sich großer Beliebtheit.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Innensicht in der Novelle
- 2.1. Stimme
- 2.2. Modus
- 2.3 Innerer Monolog
- 3. Innensicht der Graphic Novel
- 4. Analyse der "Entblößungsszene"
- 4.1. Entblößungsszene in Schnitzlers Novelle Fräulein Else
- 4.2. Analyse Fiors Graphic Novel Fräulein Else
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Darstellung der Innensicht in Arthur Schnitzlers Novelle "Fräulein Else" und Manuele Fiors gleichnamiger Graphic Novel. Ziel der Analyse ist es, die Umsetzung des Inneren Monologs in beiden Medien zu vergleichen und die Besonderheiten der Graphic Novel in Bezug auf die Darstellung der inneren Welt der Protagonistin herauszuarbeiten.
- Analyse der Darstellung der Innensicht in beiden Werken
- Vergleich der unterschiedlichen Möglichkeiten der Innensicht-Darstellung in Novelle und Graphic Novel
- Bedeutung des Inneren Monologs als stilistisches Merkmal der Novelle
- Analyse der "Entblößungsszene" in beiden Werken
- Diskussion der These, dass die Graphic Novel die Darstellung des Inneren Monologs vielschichtiger umsetzen kann
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit vor und erläutert die Motivation für die Analyse. Sie beleuchtet die Besonderheiten der Innensicht in Schnitzlers Novelle und die Rezeption der Graphic Novel durch die Kritik.
Das zweite Kapitel befasst sich mit der Darstellung der Innensicht in der Novelle. Es werden die Kategorien Stimme und Modus im Sinne Genettes eingeführt und auf ihre Relevanz für die Darstellung der inneren Welt der Protagonistin hingewiesen. Dabei wird insbesondere die Rolle des Erzählers und die Verwendung von Figurenrede beleuchtet.
Das dritte Kapitel behandelt die Innensicht in der Graphic Novel und stellt die spezifischen Möglichkeiten der Graphic Novel in Bezug auf die Darstellung der Innensicht dar. Es werden die Erkenntnisse Genettes, Martinez', Scheffels und Blanks herangezogen, um die Besonderheiten der Graphic Novel als Adaptionsmedium zu beleuchten.
Das vierte Kapitel analysiert die "Entblößungsszene" in beiden Werken. Es werden die Panels der Graphic Novel zitiert und mit dem entsprechenden Text der Novelle verglichen. Die Analyse soll zeigen, wie die Graphic Novel den inneren Monolog durch die Kombination von Bild und Text auf eine neue Ebene hebt.
Das fünfte Kapitel fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und diskutiert die eingangs aufgestellte These. Es wird herausgestellt, inwieweit die Graphic Novel die Darstellung des Inneren Monologs vielschichtiger umsetzen kann.
Schlüsselwörter
Innensicht, innerer Monolog, Novelle, Graphic Novel, Arthur Schnitzler, Manuele Fior, "Fräulein Else", Entblößungsszene, Adaption, Erzähltheorie, Genette, Martinez, Scheffel, Blank, Panels
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Besondere an Arthur Schnitzlers „Fräulein Else“?
Die Novelle von 1924 nutzt fast konsequent den inneren Monolog, um die psychologische Innensicht und die intimsten Gefühle der Protagonistin darzustellen.
Wie setzt Manuele Fior den inneren Monolog in der Graphic Novel um?
Fior nutzt genrespezifische Mittel der Graphic Novel, wie die Kombination von Bildsequenzen (Panels) und Text, um die Innensicht vielschichtiger zu visualisieren.
Was wird in der „Entblößungsszene“ verglichen?
Die Arbeit analysiert, wie die schutzlose und gedemütigte Situation Elses sprachlich in der Novelle und visuell-narrativ in der Graphic Novel dargestellt wird.
Welche erzähltheoretischen Begriffe werden genutzt?
Es werden die Kategorien „Stimme“ und „Modus“ im Sinne von Gérard Genette herangezogen, um die Erzählperspektive zu analysieren.
Warum eignet sich die Graphic Novel gut für die Darstellung von Innensicht?
Durch die bildliche Ebene können Emotionen und Gedanken parallel zum Text dargestellt werden, was die Distanz zwischen Leser und Figur weiter verringern kann.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2019, Die Darstellung der Innensicht in Arthur Schnitzlers "Fräulein Else" und Manuele Fiors gleichnamiger Graphic Novel, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/514252