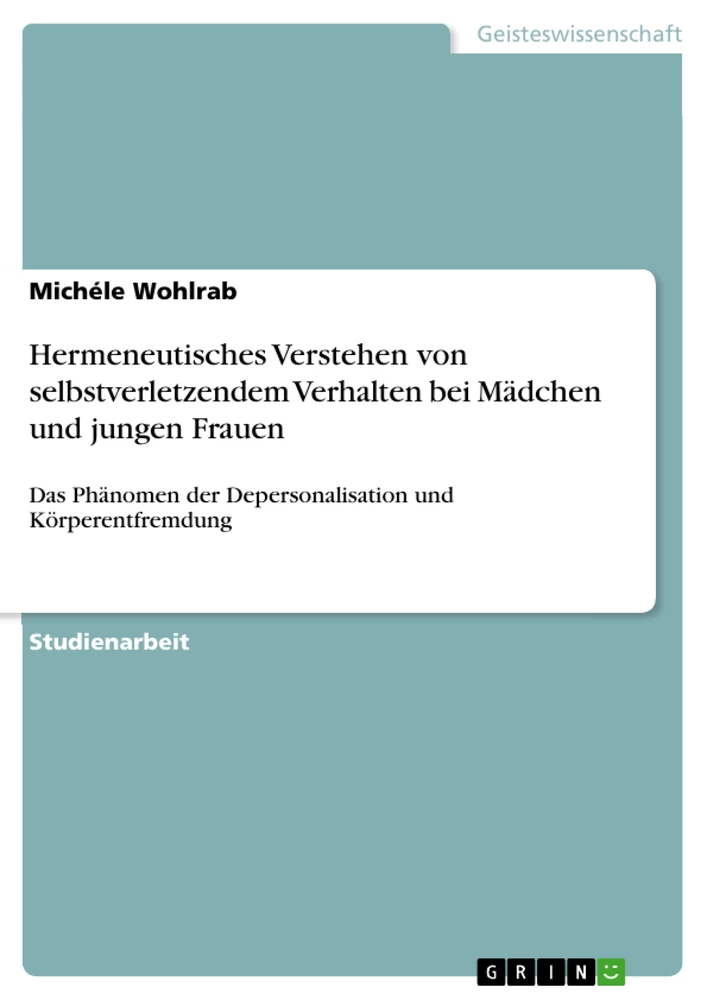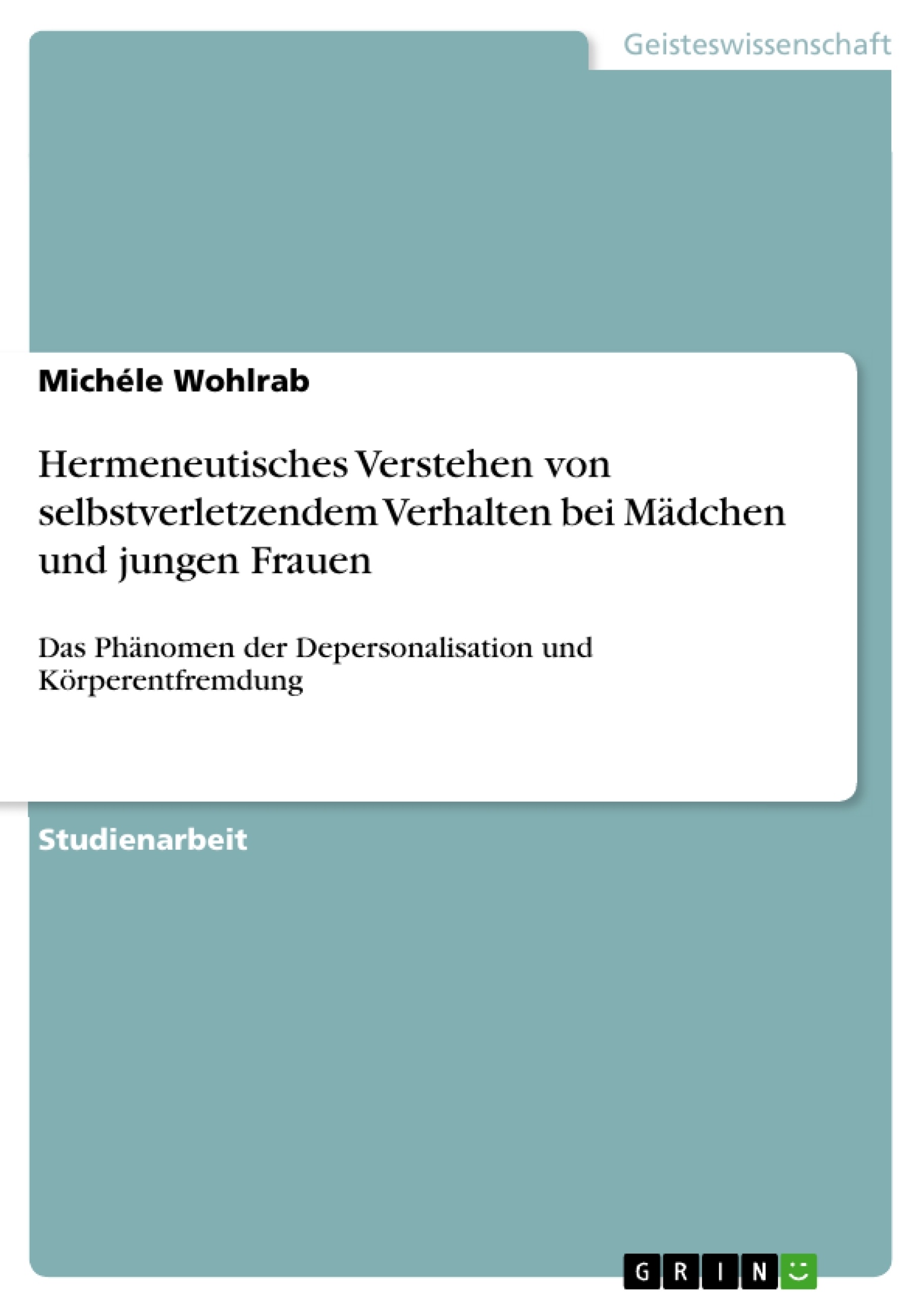Wie spüren und fühlen Mädchen und junge Frauen in Entfremdungszuständen ihren Körper und wie äußern sie das? Was beendet den Zustand der Körperentfremdung? Diese Fragen sollen in der vorliegenden Studienarbeit untersucht und beantwortet werden.
Selbstverletzendes Verhalten wird in zwei Hauptgruppen unterteilt. Zum einen in kulturell sanktionierte Selbstverletzung – darunter zählen Piercingformen und Tattoos - und zum anderen in deviantes selbstverletzendes Verhalten bei Menschen mit psychischen Erkrankungen, wobei das Phänomen der Depolarisation und Körperentfremdung wirken kann (vgl. Schoppmann 2003, S. 18). Dieser Arbeit wird sich auf die letzte Kategorie beschränken.
Diese Fragestellungen der Arbeit sollen dazu beitragen, das Phänomen der Körperentfremdung und der Depersonalisation aus der Perspektive der Betroffenen – die als Experten ihres Leidens verstanden werden sollten – mit besonderer Beachtung ihres Empfindens zu verstehen und zu erklären. Dafür wird zu Beginn erläutert, was Selbstverletzung ist und welche Theorien zur Entstehung dieser bestehen. Da selbstverletzendes Verhalten – wie oben erwähnt - einen engen Zusammenhang mit Entfremdungserlebnissen aufweist, wird der Schwerpunkt der Arbeit darauf gelegt und die damit verbundenen Theorien, Auslöser, Stadien und Funktionen beleuchtet, wie auch die Möglichkeiten der Rückkehr aus solchen Empfindungen beschrieben. Um die Bedeutung der Selbstverletzung für die Betroffenen allumfassend verstehen zu können, soll ein Verständnis für die einzelnen Elemente des Verletzungsprozesses entwickelt werden.
Außerdem bezieht sich das Erkenntnisinteresse dieser Studienarbeit auf das persönliche Erleben von Mädchen und jungen Frauen, weshalb aus der Perspektive der hermeneutischen Phänomenologie an das Thema herangegangen werden soll. Dafür werden möglichst viele Zitate von Betroffenen verwendet, welche mit dem hermeneutischen Zirkel vertieft werden und damit ein Verständnis für das Empfinden entwickeln und einen Zugang zu der Perspektive der betroffenen Mädchen und jungen Frauen finden – mit dem Gedanken, dass professionelles Handeln Verstehen voraus setzt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Selbstverletzung - Begriffsannäherung und Bedeutung
- Möglichkeiten zur Entstehung von selbstverletzendem Verhalten bei Mädchen und jungen Frauen
- Neurobiologie des selbstverletzenden Verhaltens
- Selbstverletzendes Verhalten und Entfremdungserlebnisse
- Körperempfinden in Bezug auf Depersonalisation und Entfremdung
- Auslöser für Entfremdungserleben
- Alleinsein
- Ausgeliefertsein an vergangene Schrecken
- Selbsthass
- Stadien der Entfremdung
- Das Entfremdungserleben
- Entfremdungserleben als Schutz
- Entfremdungserleben als Qual
- Kälte und Müdigkeit
- Sprachlosigkeit
- Der Druck
- Das Entfremdungserleben
- Die Rückkehr des Entfremdungserlebens
- Musik
- Körpergrenzen spüren
- Selbstverletzendes Verhalten
- Verstehen der Elemente von Selbstverletzenden Verhalten
- Blut
- Schmerz
- Narben
- Scham
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Studienarbeit befasst sich mit dem hermeneutischen Verstehen von selbstverletzendem Verhalten bei Mädchen und jungen Frauen, wobei das Phänomen der Depersonalisation und Körperentfremdung im Vordergrund steht. Ziel ist es, das Erleben und die Gefühle von betroffenen Mädchen und jungen Frauen nachzuvollziehen und ein tieferes Verständnis für ihre Situation zu entwickeln.
- Entfremdungserlebnisse im Zusammenhang mit selbstverletzendem Verhalten
- Neurobiologische Aspekte von selbstverletzendem Verhalten
- Auslöser und Stadien von Entfremdungserlebnissen
- Die Rolle von Musik, Körpergrenzen und Selbstverletzung bei der Rückkehr aus Entfremdungszuständen
- Elemente des Selbstverletzungsprozesses wie Blut, Schmerz, Narben und Scham
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problematik von selbstverletzendem Verhalten dar und erläutert die Relevanz des Themas. Sie verdeutlicht die Notwendigkeit, das Erleben von Betroffenen zu verstehen und setzt den Fokus auf die Depersonalisation und Körperentfremdung. Kapitel 2 nähert sich dem Begriff der Selbstverletzung an und verdeutlicht verschiedene Arten von selbstverletzendem Verhalten. Kapitel 3 beschäftigt sich mit den neurobiologischen Grundlagen von selbstverletzendem Verhalten. Kapitel 4 untersucht den Zusammenhang zwischen selbstverletzendem Verhalten und Entfremdungserlebnissen, wobei das Körperempfinden in Bezug auf Depersonalisation und Entfremdung im Mittelpunkt steht. Kapitel 5 beleuchtet die verschiedenen Auslöser für Entfremdungserlebnisse sowie die verschiedenen Stadien der Entfremdung. Kapitel 6 beschreibt die Rückkehr aus Entfremdungszuständen und die Rolle von Musik, Körpergrenzen und Selbstverletzung bei diesem Prozess. Kapitel 7 analysiert die einzelnen Elemente des Selbstverletzungsprozesses, wie Blut, Schmerz, Narben und Scham.
Schlüsselwörter
Selbstverletzung, Depersonalisation, Körperentfremdung, Entfremdungserleben, hermeneutisches Verstehen, Neurobiologie, Auslöser, Stadien, Rückkehr, Elemente, Blut, Schmerz, Narben, Scham.
Häufig gestellte Fragen
Warum verletzen sich Mädchen und junge Frauen selbst?
Selbstverletzung dient oft dazu, Zustände von Körperentfremdung oder Depersonalisation zu beenden und sich selbst wieder zu spüren.
Was versteht man unter "Körperentfremdung"?
Es ist ein Zustand, in dem Betroffene ihren eigenen Körper als fremd, gefühllos oder nicht zugehörig wahrnehmen, oft begleitet von einem Gefühl der Sprachlosigkeit.
Was sind Auslöser für Entfremdungserlebnisse?
Häufige Auslöser sind tiefes Alleinsein, das Gefühl des Ausgeliefertseins an vergangene Traumata oder massiver Selbsthass.
Welche Rolle spielt der Schmerz bei der Selbstverletzung?
Der Schmerz wirkt oft als "Rückkehr" in die Realität. Er durchbricht die emotionale Taubheit und ermöglicht es den Betroffenen, ihre Körpergrenzen wieder wahrzunehmen.
Warum wird in der Arbeit die hermeneutische Phänomenologie genutzt?
Dieser Ansatz ermöglicht es, die Perspektive der Betroffenen als "Experten ihres Leidens" ernst zu nehmen und ihr Erleben durch Zitate und tiefes Verstehen nachzuvollziehen.
Gibt es andere Wege aus der Entfremdung außer Selbstverletzung?
Die Arbeit nennt unter anderem Musik oder das bewusste Spüren von Körpergrenzen als alternative Methoden zur Rückkehr aus Entfremdungszuständen.
- Citar trabajo
- Michéle Wohlrab (Autor), 2018, Hermeneutisches Verstehen von selbstverletzendem Verhalten bei Mädchen und jungen Frauen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/514292