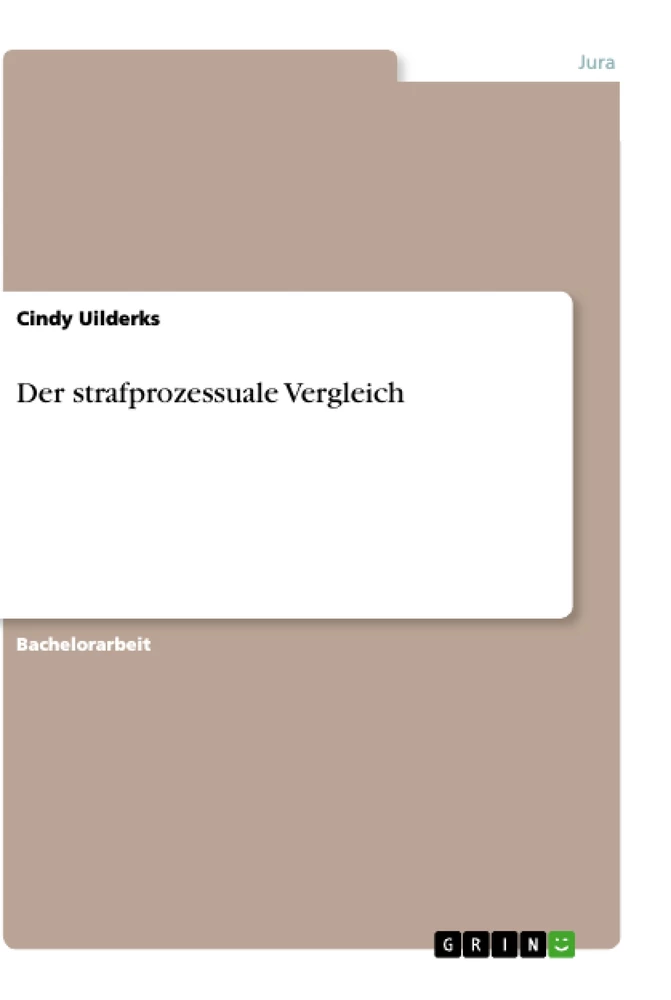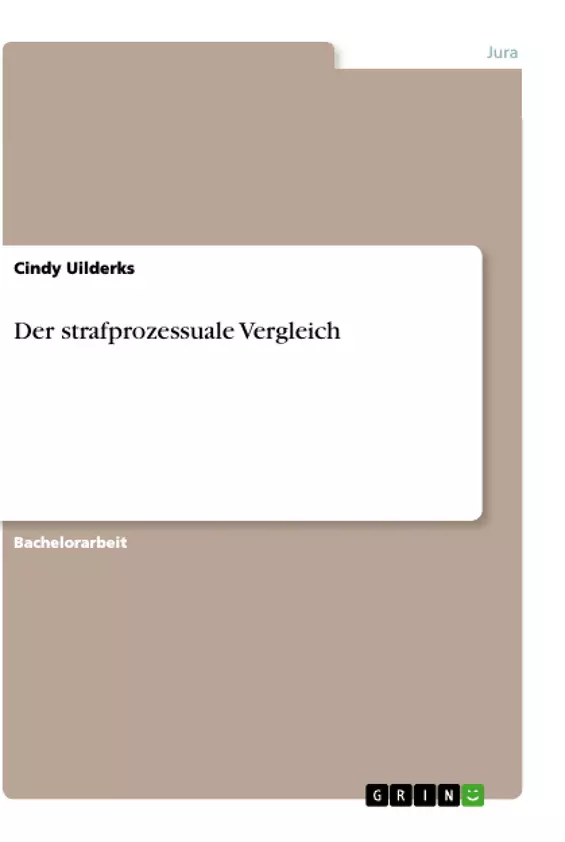Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit dem strafprozessualen Vergleich im Sinne des § 257c StPO, der im Rahmen des im Jahre 2009 in Kraft getretenen Verständigungsgesetzes in die StPO eingefügt wurde und seitdem für vielfältige Kritik gesorgt hat. Nach einer kurzen Einleitung und Definition in Bezug auf den prozessualen Vergleich (im Folgenden auch synonym als Verständigung oder Absprache betitelt) soll zunächst auf die Normhistorie, Ursachen und Entstehungsgründe eingegangen werden. Anschließend wird § 257c StPO als Zentralnorm der Verständigung mit seinen Voraussetzungen und Rechtsfolgen erläutert. In diesem Zusammenhang wird zunächst auf die systematische Einordnung der Norm sowie die allgemeine Zulässigkeit der Verständigung eingegangen. Neben den möglichen Gegenständen einer Verständigung wird insbesondere das in deren Rahmen abgelegte Geständnis, den Verfahrensablauf, die Bindungswirkung sowie Mitteilungs- und Dokumentationspflichten thematisiert.
Im Zweiten Teil der Arbeit sollen die vielfältigen vorherrschenden Kritikpunkte in Bezug auf die Verständigung angerissen und insbesondere auch auf deren Vereinbarung mit den im Strafprozess vorherrschenden Verfahrensgrundsätzen und Prozessmaximen eingegangen werden. Neben der prozessualen Bedeutung für die Verfahrensbeteiligten werden abschließend insbesondere auch deren Strafbarkeitsrisiken in Bezug auf eine Verständigung thematisiert. Die Arbeit mündet sodann in einem Fazit bezüglich der Praxistauglichkeit und weiterer Entwicklungen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Verständigung als Verfahren eigener Art im Strafprozess
- Normhistorie, Ursachen und Entstehungsgründe
- Normgrundlagen des § 257c StPO
- Systematische Einordnung der Norm
- Zulässigkeit und Amtsaufklärungspflicht (Abs. 1)
- Verfahrensbeteiligte
- Geeignete Fälle
- Amtsaufklärungsgrundsatz gemäß § 244 II StPO
- Zulässige Gegenstände und Geständnis (Abs. 2)
- Gegenstand der Verständigung
- Verständigungsfähige Rechtsfolgen eines Urteils
- Verständigungsfähige Rechtsfolgen dazugehöriger Beschlüsse
- Prozessverhalten der Verfahrensbeteiligten
- Sonstige verfahrensbezogene Maßnahmen
- Das Geständnis im Kontext der Verständigung
- Gegenstand der Verständigung
- Verfahrensablauf (Abs. 3)
- Initiativrecht des Gerichts
- Stellungnahme der übrigen Verfahrensbeteiligten / Einverständnis
- Rechtsfolgen, Bindungswirkung und Mitteilungspflicht (Abs. 4)
- Rechtsfolgen
- Bindungswirkung
- Bindungswirkung für das Gericht
- Übersehen oder Hinzukommen von bedeutsamen Umständen (Abs. 4 S. 1)
- Abweichendes Prozessverhalten des Beschuldigten (Abs. 4 S. 2)
- Bindungswirkung für die Staatsanwaltschaft
- Bindungswirkung für den Angeklagten
- Bindungswirkung für das Gericht
- Mitteilungspflicht (Abs. 4 S. 4)
- Verwertungsverbot (Abs. 4 S. 3)
- Belehrungspflicht (Abs. 5)
- Einlegen von Rechtsmitteln
- Kritik an der gesetzlichen Regelung
- Vereinbarung mit den Verfahrensgrundsätzen / Prozessmaximen
- Offizialprinzip und Ermittlungsgrundsatz
- Legalitätsprinzip
- Unmittelbarkeits- und Mündlichkeitsprinzip sowie Öffentlichkeitsgrundsatz
- Grundsatz der Unabhängigkeit des Richters
- Fair-Trial Grundsatz
- Gleichheitsgrundsatz
- Unschuldsvermutung
- Nemo-tenetur- Grundsatz
- Fazit und Kernthesen des BVerfG
- Reichweite des Aufklärungsgrundsatzes
- Gegenstand der Verständigung
- Mitteilung gemäß § 243 IV 1 StPO
- Mitteilung gemäß § 243 IV 2 StPO
- Mitteilungs- und Dokumentationspflichten
- Prozessuale Bedeutung der Verständigung
- Prozessuale Bedeutung für die Justiz
- Prozessuale Bedeutung für den Angeklagten
- Prozessuale Bedeutung für den Verletzten
- Strafbarkeitsrisiken für die Verfahrensbeteiligten
- Strafbarkeitsrisiken für den Richter
- Risiko einer Strafbarkeit gemäß § 339 StGB
- Strafbarkeit gemäß § 240 IV 2 Nr. 3 StGB
- Strafbarkeit gemäß § 258a StGB
- Strafbarkeit gemäß § 348 I StGB
- Weitere strafrechtliche Risiken
- Strafbarkeitsrisiken für den Staatsanwalt
- Strafbarkeit gemäß § 339 StGB
- Strafbarkeit gemäß § 258a StGB
- Strafbarkeitsrisiken für die Verteidigung
- Strafbarkeit gemäß § 258 StGB
- Strafbarkeit gemäß §§ 339, 26, 27 StGB
- Strafbarkeitsrisiken für den Richter
- Ausblick, Praxistauglichkeit und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit analysiert den strafprozessualen Vergleich im Sinne des § 257c StPO, der im Rahmen des Verständigungsgesetzes von 2009 in die StPO eingeführt wurde. Die Arbeit beleuchtet die Normhistorie, die Ursachen und Entstehungsgründe des Vergleichs sowie die zentralen Elemente des § 257c StPO, einschließlich seiner Voraussetzungen und Rechtsfolgen. Darüber hinaus werden die vielfältigen Kritikpunkte im Zusammenhang mit dem strafprozessualen Vergleich aufgezeigt und die Vereinbarkeit der Verfahrensweise mit den im Strafprozess geltenden Verfahrensgrundsätzen und Prozessmaximen diskutiert. Abschließend werden die prozessuale Bedeutung der Verständigung für die Verfahrensbeteiligten sowie deren Strafbarkeitsrisiken untersucht.
- Normhistorie und Entstehung des strafprozessualen Vergleichs
- Rechtliche Grundlagen des § 257c StPO
- Kritik an der gesetzlichen Regelung
- Vereinbarkeit des strafprozessualen Vergleichs mit den Verfahrensgrundsätzen
- Prozessuale Bedeutung und Strafbarkeitsrisiken der Verständigung
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema des strafprozessualen Vergleichs ein und beleuchtet dessen Bedeutung im Kontext des deutschen Strafprozessrechts.
- Die Verständigung als Verfahren eigener Art im Strafprozess: Dieses Kapitel beschreibt die Besonderheiten des strafprozessualen Vergleichs als Verfahren eigener Art und erläutert dessen Zielsetzung und Abgrenzung zu anderen Verfahren im Strafprozess.
- Normhistorie, Ursachen und Entstehungsgründe: Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung des strafprozessualen Vergleichs, analysiert die Ursachen für dessen Einführung und diskutiert die Hintergründe und Ziele der Gesetzgebung.
- Normgrundlagen des § 257c StPO: Dieses Kapitel widmet sich der rechtlichen Grundlage des strafprozessualen Vergleichs, dem § 257c StPO, und analysiert dessen Voraussetzungen und Rechtsfolgen im Detail.
- Kritik an der gesetzlichen Regelung: Dieses Kapitel behandelt die verschiedenen Kritikpunkte an der gesetzlichen Regelung des strafprozessualen Vergleichs.
- Vereinbarung mit den Verfahrensgrundsätzen / Prozessmaximen: Dieses Kapitel untersucht die Vereinbarkeit des strafprozessualen Vergleichs mit den grundlegenden Verfahrensgrundsätzen und Prozessmaximen des deutschen Strafprozessrechts.
- Prozessuale Bedeutung der Verständigung: Dieses Kapitel analysiert die prozessuale Bedeutung des strafprozessualen Vergleichs für die beteiligten Akteure, insbesondere für die Justiz, den Angeklagten und den Verletzten.
- Strafbarkeitsrisiken für die Verfahrensbeteiligten: Dieses Kapitel untersucht die strafrechtlichen Risiken, denen die Verfahrensbeteiligten im Zusammenhang mit dem strafprozessualen Vergleich ausgesetzt sein können.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen und Begriffe der Arbeit sind Strafprozessrecht, strafprozessualer Vergleich, Verständigung, Absprache, § 257c StPO, Verfahrensgrundsätze, Prozessmaximen, Strafbarkeitsrisiken, Rechtsstaatlichkeit, Verfahrensbeendigung, Geständnis, Strafmilderung, Kritik, Diskussion, Rechtsfolgen, Bindungswirkung, Prozessbeteiligte, Angeklagter, Staatsanwaltschaft, Gericht, Verteidigung, Justiz.
Häufig gestellte Fragen
Was regelt § 257c der Strafprozessordnung (StPO)?
§ 257c StPO regelt die Verständigung im Strafverfahren, auch bekannt als „Deal“ oder strafprozessualer Vergleich, bei dem unter bestimmten Voraussetzungen Absprachen über das Urteil getroffen werden können.
Welche Rolle spielt das Geständnis bei einer Verständigung?
Das Geständnis ist meist zentraler Bestandteil der Verständigung. Das Gericht muss jedoch trotz Geständnis seiner Amtsaufklärungspflicht nachkommen und darf nicht ungeprüft darauf vertrauen.
Gibt es eine Bindungswirkung für das Gericht bei Absprachen?
Ja, grundsätzlich ist das Gericht an die Zusage gebunden. Diese Bindung entfällt jedoch, wenn rechtlich bedeutsame Umstände übersehen wurden oder neu hinzukommen.
Warum wird der strafprozessuale Vergleich kritisiert?
Kritiker sehen Konflikte mit Prozessmaximen wie dem Legalitätsprinzip, der Unschuldsvermutung und dem Grundsatz der Wahrheitsfindung.
Welche Strafbarkeitsrisiken bestehen für Richter und Staatsanwälte?
Bei unzulässigen Absprachen besteht das Risiko der Rechtsbeugung (§ 339 StGB) oder der Strafvereitelung im Amt (§ 258a StGB).
- Quote paper
- Cindy Uilderks (Author), 2019, Der strafprozessuale Vergleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/514763