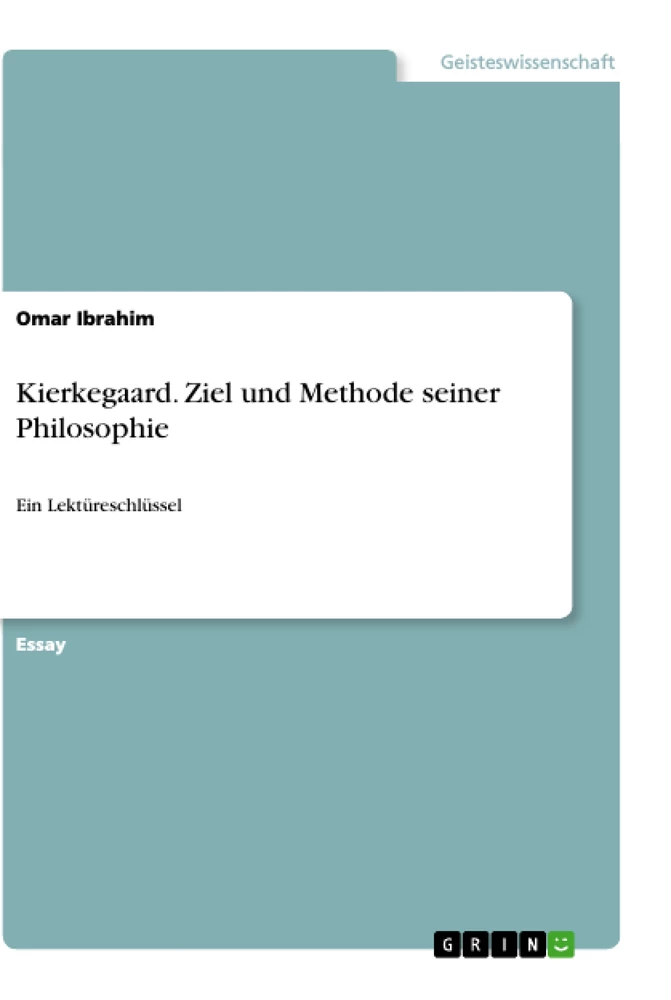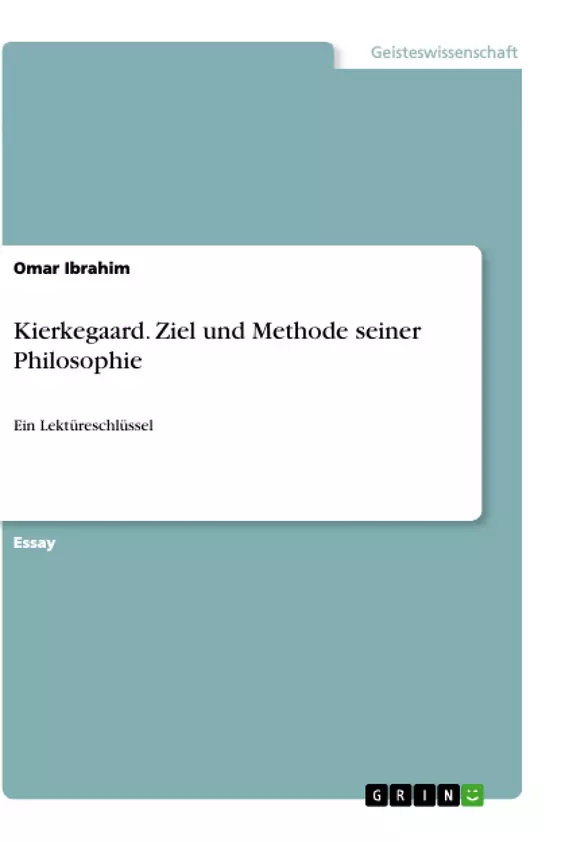Das Gesamtwerk Kierkegaards besticht nicht nur durch seinen Umfang und seinen Einfluss auf die Geisteswissenschaften sondern genauso durch den Umfang an möglichen Interpretationen und analytischen Zugängen. Kierkegaard selbst erschwert durch seinen Schreibstil, seine verschachtelten Pseudonyme und durch die dialektischen Beweisführungen eine einförmige und kohärente Exegese. Daher verwundert es auch nicht, dass die Anzahl und Differenz der Interpretationen einen einstimmigen Lektüreschlüssel sprengen. Während dem ihn einige religiös verstehen (vgl. Camus, 2013), sehen andere in ihm wiederum einen Philosophen, den man säkularisieren sollte (vgl. Heidegger, 2006). Ebenfalls gibt es Betrachtungen, die ihn in die Tradition Hegels stellen (vgl. Theunissen, 1993) und andere, die ihn umgekehrt als Vater des Existenzialismus betrachten (vgl. Diem in Kierkegaard, 2017). Ebenso findet man Versuche, Kierkegaard überhaupt nicht als Philosophen zu verstehen, sondern als gehaltvollen Literaten, welcher verschiedene existenziale Positionen beschreibt und damit Belletristik betreibt (vgl. Hüsch, 2014). Denn kaum ein anderer Philosoph oder eine andere Philosophin hat sich so ausführlich mit unterschiedlichen existenzialen Positionen und Lebensverständnissen auseinandergesetzt wie Kierkegaard. Doch weshalb das alles? Dass es nur biografische Gründe waren, die Kierkegaard dazu veranlassten, sein Werk unter so vielen verschiedenen Pseudonymen zu veröffentlichen, scheint nicht plausibel zu sein. Denn er bekannte sich später öffentlich zu allen Schriften (Cappelörn in Deuser & Kleinert, 2017: 26f). Ebenfalls scheint es unwahrscheinlich, dass die Pseudonyme und ihr Verhalten zueinander, schlicht als literarischer Kunstgriff zu verstehen sind (vgl. Schlette in Deuser & Kleinert, 2017). Die vorliegende Arbeit versucht also im Hinblick auf Kierkegaards Werk einen möglichst umfassenden, philosophischen Lektüreschlüssel darzulegen. Dabei werden wir uns an den Begriff philosophische Anthropologie von Wesche (2013) halten und diesen nach fünf Punkten strukturieren und in gegebener Hinsicht ausdifferenzieren. Dies wird nicht nur für die allgemeine Interpretationsweise von Kierkegaard relevant sein, sondern führt am Schluss auch zu einem Abriss einer noch auszudifferenzierenden philosophischen Methode (Erkenntnis) und anhand Kierkegaards Literatur zu einer verbesserten Lebensorientierung (Verständnis). Die vorliegende Arbeit wird mit einigen Schlussbemerkungen abgerundet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Philosophische Anthropologie: Kierkegaards Methode
- Dialogisches Denken
- Maieutische Methode
- Problemorientierte Philosophie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Philosophie von Søren Kierkegaard und verfolgt das Ziel, einen umfassenden philosophischen Lektüreschlüssel für sein Werk zu entwickeln. Der Fokus liegt dabei auf der philosophischen Anthropologie und der Methode, die Kierkegaard anwendet, um den Menschen zu einem richtigen Existieren zu verhelfen.
- Philosophische Anthropologie als Weiterentwicklung der traditionellen Philosophie
- Der Mensch und seine Vergessenheit des Menschseins
- Kierkegaards Methode der philosophischen Anthropologie: Dialog, Maieutik, Problemorientierung
- Die Bedeutung des Dialogs und der Reflexion für die Selbsterkenntnis
- Die Bedeutung des Fragenstellens und der Herausarbeitung existentieller Positionen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die Vielfältigkeit von Interpretationen und Zugängen zu Kierkegaards Werk und die Schwierigkeiten, einen einheitlichen Lektüreschlüssel zu finden. Sie führt den Begriff der philosophischen Anthropologie ein, der als Grundlage für die Analyse von Kierkegaards Methode dient.
Im zweiten Kapitel werden fünf Punkte herausgearbeitet, die Kierkegaards Methode im Hinblick auf die philosophische Anthropologie charakterisieren: dialogisches Denken, maieutische Methode und problemorientierte Philosophie.
- Der Dialog als Methode der Selbsterkenntnis und der Überwindung von Selbsttäuschungen
- Die maieutische Methode als Mittel, um den Leser zum selbstständigen Denken und Urteilen anzuregen
- Die problemorientierte Philosophie als Abkehr von doktrinären Ansätzen und Fokus auf das Stellen von Fragen
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: philosophische Anthropologie, Søren Kierkegaard, Dialog, Maieutik, Problemorientierung, Selbsterkenntnis, Lebensverständigkeit, Existenzialismus, Pseudonyme, Ironie.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel von Kierkegaards Philosophie?
Sein Ziel ist es, dem Individuum zu helfen, die „Vergessenheit des Menschseins“ zu überwinden und zu einer authentischen, existentiellen Selbsterkenntnis zu gelangen.
Warum verwendete Kierkegaard Pseudonyme?
Die Pseudonyme dienen als literarische und maieutische Methode, um verschiedene Lebensanschauungen (z. B. ästhetisch, ethisch) darzustellen, ohne dem Leser eine fertige Lehre aufzudrängen.
Was versteht man unter der maieutischen Methode?
In Anlehnung an Sokrates ist es eine „Hebammenkunst“ des Geistes: Der Autor leitet den Leser so an, dass dieser die Wahrheit in sich selbst entdeckt und zum eigenen Urteil gelangt.
Was ist dialogisches Denken bei Kierkegaard?
Es beschreibt eine Denkweise, die nicht dogmatisch festschreibt, sondern im ständigen Austausch mit existentiellen Problemen und verschiedenen Perspektiven steht.
Ist Kierkegaard ein Philosoph oder ein Literat?
Interpretationen variieren: Einige sehen ihn als Vater des Existenzialismus, andere als religiösen Denker oder als brillanten Literaten, der Belletristik mit philosophischem Gehalt betrieb.
Was ist „problemorientierte Philosophie“?
Anstatt abstrakte Systeme (wie Hegel) zu bauen, konzentriert sich Kierkegaard auf die konkreten Nöte und Fragen der menschlichen Existenz.
- Quote paper
- Omar Ibrahim (Author), 2019, Kierkegaard. Ziel und Methode seiner Philosophie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/515317