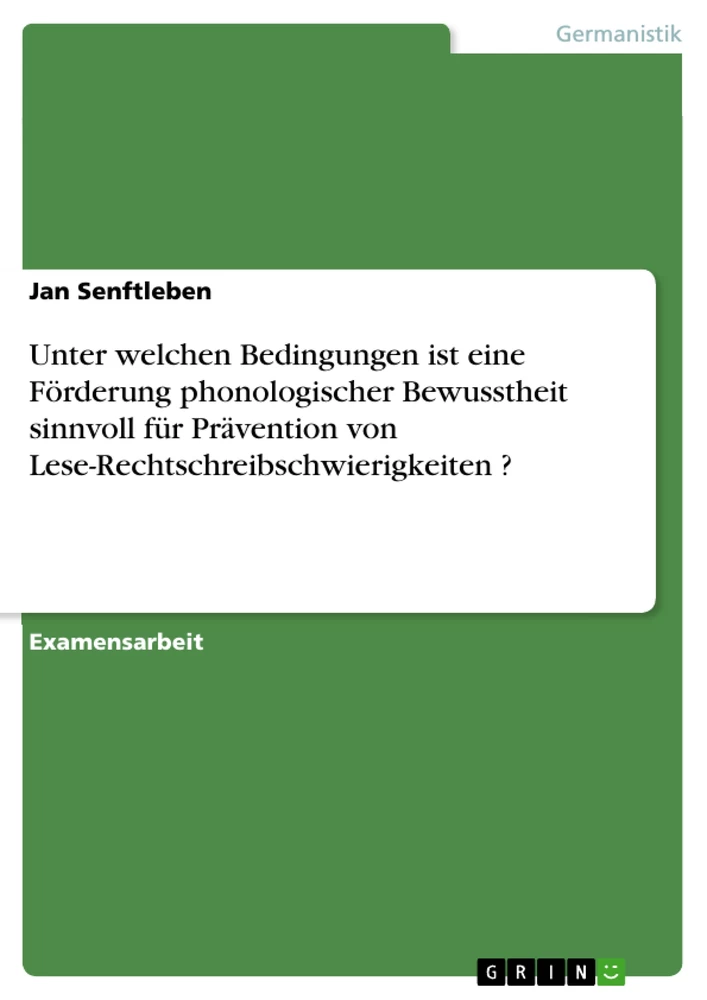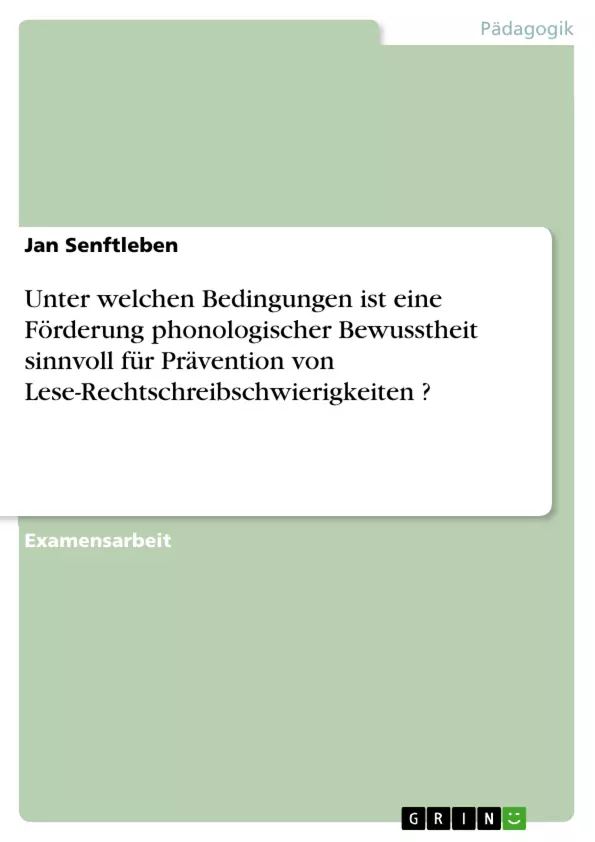Scheitern Kinder schon im Anfangsunterricht am Lesen und Schreiben führt dies im Verlauf ihres weiteren Schulbesuchs zur Beeinträchtigung des gesamten schulischen Lernens und ihres Selbstwertgefühls. Einen Teil der Versuche, dem entgegenzuwirken, stellen Konzepte zur präventiven Förderung von Kindern dar. In den letzten Jahren haben vor allem Trainingsprogramme zur präventiven Förderung phonologischer Bewusstheit größere Verbreitung und Aufmerksamkeit gefunden. Phonologische Bewusstheit wird zu den für den Schriftspracherwerb bedeutsamen Voraussetzungen gezählt. Die Trainingsprogramme erwiesen sich in verschieden Studien offenbar als wirksame Maßnahmen zur Prävention von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten. Bezüglich der Frage, unter welchen Bedingungen eine frühe Förderung im Bereich phonologische Bewusstheit für die Prävention von LRS sinnvoll ist und der Frage, ob sie im Vorschulbereich nötig ist, gibt es jedoch unterschiedliche, ja gegensätzliche Einschätzungen. Aufgrund der zumindest in empirischen Studien erwiesenen Wirksamkeit der Trainingsprogramme, aber auch der gleichzeitigen Kritik an ihnen, scheint es mir sinnvoll, mich mit der Frage auseinanderzusetzen, unter welchen Bedingungen eine Arbeit mit diesen Programmen Sinn macht.
Die Kritik an den Programmen führt mich zu drei Fragen bezüglich der Förderung phonologischer Bewusstheit, denen ich in dieser Arbeit nachgehe:
1. Ist eine präventive Förderung der Fähigkeiten zur Analyse und Synthese von Phonemen, die den Umgang mit Schriftsprache ausspart, sinnvoll?
2. Ist der Stellenwert phonologischer Bewusstheit für den Erfolg im SSE derart groß, dass eine effektive Prävention eine vorschulische Förderung der Fähigkeiten zur Analyse und Synthese von Phonemen notwendig macht?
3. Ist eine Förderung phonologischer Bewusstheit, deren Durchführung und inhaltliche Planung allein von der Feststellung eines Entwicklungsrückstandes im Bereich phonologischer Bewusstheit abhängig gemacht wird, angemessen?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Schwierigkeiten im SSE und Kritik an Konzepten zur Förderung phonologischer Bewusstheit
- Verständnis von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten vor dem Hintergrund einer entwicklungsorientierten Sichtweise des Schriftspracherwerbs
- Entwicklungsorientierte Sichtweise des SSE am Beispiel des Entwicklungsmodells von Klaus B. Günther
- Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb
- Zur Bedeutung von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten für Schüler mit Förderbedarf im Bereich Lernen
- Kritik an Konzepten zur Förderung phonologischer Bewusstheit
- Verständnis von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten vor dem Hintergrund einer entwicklungsorientierten Sichtweise des Schriftspracherwerbs
- Positionen zur Bedeutung von phonologischer Bewusstheit für die Entstehung von LRS und deren Prävention
- Definitionen phonologischer Bewusstheit und Unterscheidungen
- Phonologische Bewusstheit und Schriftspracherwerb
- Bedeutung phonologischer Bewusstheit für den SSE vor dem Hintergrund neuerer Entwicklungsmodelle
- Aspekte der Entwicklung phonologischer Bewusstheit
- Phonologische Bewusstheit und Schwierigkeiten im SSE
- Untersuchungen zu phonologischer Bewusstheit
- Kritik an einigen Prämissen der Frühdiagnostik und Frühprävention auf der Grundlage empirischer Studien
- Entwicklungsrückstände im Bereich phonologischer Bewusstheit und ihre Verbindung mit anderen Bereichen des SSE
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Bedingungen, unter denen die Förderung phonologischer Bewusstheit sinnvoll zur Prävention von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten (LRS) oder deren Förderung eingesetzt werden kann. Die Arbeit hinterfragt kritisch bestehende Konzepte und erörtert die Bedeutung phonologischer Bewusstheit für den Schriftspracherwerb.
- Definition und Bedeutung phonologischer Bewusstheit
- Zusammenhang zwischen phonologischer Bewusstheit und Schriftspracherwerb
- Kritische Auseinandersetzung mit bestehenden Förderkonzepten
- Auswertung empirischer Studien zur Wirksamkeit von Förderprogrammen
- Bestimmung optimaler Bedingungen für die Förderung phonologischer Bewusstheit
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt das Problem von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten und deren Auswirkungen auf den Schulbesuch und das Selbstwertgefühl von Kindern. Sie führt in die Thematik der präventiven Förderung phonologischer Bewusstheit ein und benennt die zentrale Forschungsfrage der Arbeit: Unter welchen Bedingungen ist eine Förderung phonologischer Bewusstheit sinnvoll für die Prävention oder Förderung von LRS? Die Einleitung umreißt den Aufbau der Arbeit und formuliert drei zentrale Fragen, die im weiteren Verlauf beantwortet werden sollen.
Schwierigkeiten im SSE und Kritik an Konzepten zur Förderung phonologischer Bewusstheit: Dieses Kapitel erläutert das Verständnis von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten aus entwicklungspsychologischer Perspektive, basierend auf dem Entwicklungsmodell von Klaus B. Günther. Es werden Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb detailliert beschrieben und deren Auswirkungen auf Schüler mit Förderbedarf im Bereich Lernen beleuchtet. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der kritischen Auseinandersetzung mit bestehenden Konzepten zur Förderung phonologischer Bewusstheit, die die Grundlage für die Fragestellungen der Arbeit bilden.
Positionen zur Bedeutung von phonologischer Bewusstheit für die Entstehung von LRS und deren Prävention: Dieses Kapitel definiert den Begriff "phonologische Bewusstheit" und differenziert verschiedene Definitionen. Es untersucht die Rolle der phonologischen Bewusstheit im Schriftspracherwerb und umgekehrt, indem es die Bedeutung für die Aneignung der alphabetischen Strategie und die Entwicklung phonologischer Bewusstheit im Vorschulalter beleuchtet. Der Fokus liegt auf dem Bedingungsverhältnis zwischen phonologischer Bewusstheit und Schriftspracherwerb und den Konsequenzen für die Notwendigkeit einer frühkindlichen Förderung. Das Kapitel analysiert empirische Studien zum Zusammenhang zwischen phonologischer Bewusstheit und LRS sowie Studien zur Wirksamkeit von Förderprogrammen, um die Relevanz der frühkindlichen Förderung zu bewerten.
Schlüsselwörter
Phonologische Bewusstheit, Lese-Rechtschreibschwierigkeiten (LRS), Schriftspracherwerb, Prävention, Förderung, empirische Studien, Frühdiagnostik, Entwicklungsmodelle, Kindergarten, Schule, Analyse und Synthese von Phonemen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse der Förderung phonologischer Bewusstheit zur Prävention von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten
Was ist das zentrale Thema dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht, unter welchen Bedingungen die Förderung phonologischer Bewusstheit sinnvoll zur Prävention oder Förderung von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten (LRS) eingesetzt werden kann. Sie hinterfragt kritisch bestehende Konzepte und erörtert die Bedeutung phonologischer Bewusstheit für den Schriftspracherwerb.
Welche Aspekte der phonologischen Bewusstheit werden behandelt?
Die Arbeit behandelt Definitionen und Bedeutung phonologischer Bewusstheit, den Zusammenhang zwischen phonologischer Bewusstheit und Schriftspracherwerb, die kritische Auseinandersetzung mit bestehenden Förderkonzepten, die Auswertung empirischer Studien zur Wirksamkeit von Förderprogrammen und die Bestimmung optimaler Bedingungen für die Förderung phonologischer Bewusstheit.
Wie wird das Verständnis von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten dargestellt?
Lese-Rechtschreibschwierigkeiten werden aus entwicklungspsychologischer Perspektive, basierend auf dem Entwicklungsmodell von Klaus B. Günther, erläutert. Die Arbeit beschreibt Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb detailliert und beleuchtet deren Auswirkungen auf Schüler mit Förderbedarf im Bereich Lernen.
Welche Rolle spielen empirische Studien?
Empirische Studien spielen eine entscheidende Rolle. Die Arbeit analysiert Studien zum Zusammenhang zwischen phonologischer Bewusstheit und LRS sowie Studien zur Wirksamkeit von Förderprogrammen, um die Relevanz der frühkindlichen Förderung zu bewerten und die Kritik an bestehenden Konzepten zu untermauern.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb und Kritik an Förderkonzepten, ein Kapitel zu Positionen zur Bedeutung phonologischer Bewusstheit für die Entstehung von LRS und deren Prävention und einen Schluss. Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte der Thematik, wie in der Inhaltsübersicht detailliert dargestellt.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Phonologische Bewusstheit, Lese-Rechtschreibschwierigkeiten (LRS), Schriftspracherwerb, Prävention, Förderung, empirische Studien, Frühdiagnostik, Entwicklungsmodelle, Kindergarten, Schule, Analyse und Synthese von Phonemen.
Welche Forschungsfrage steht im Mittelpunkt?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Unter welchen Bedingungen ist eine Förderung phonologischer Bewusstheit sinnvoll für die Prävention oder Förderung von LRS?
Welche konkreten Fragen werden beantwortet?
Die Arbeit beantwortet drei zentrale Fragen, die in der Einleitung formuliert werden und sich auf die Definition und Bedeutung phonologischer Bewusstheit, den Zusammenhang mit dem Schriftspracherwerb und die Wirksamkeit von Förderprogrammen beziehen.
Wie wird der Begriff "phonologische Bewusstheit" definiert?
Der Begriff "phonologische Bewusstheit" wird definiert und verschiedene Definitionen werden differenziert. Die Arbeit beleuchtet seine Bedeutung für die Aneignung der alphabetischen Strategie und die Entwicklung im Vorschulalter.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Schlussfolgerungen werden im Schlusskapitel zusammengefasst und beziehen sich auf die Wirksamkeit der Förderung phonologischer Bewusstheit unter Berücksichtigung der in der Arbeit analysierten Studien und kritischen Auseinandersetzung mit bestehenden Konzepten.
- Citar trabajo
- Jan Senftleben (Autor), 2004, Unter welchen Bedingungen ist eine Förderung phonologischer Bewusstheit sinnvoll für Prävention von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten ?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/51638