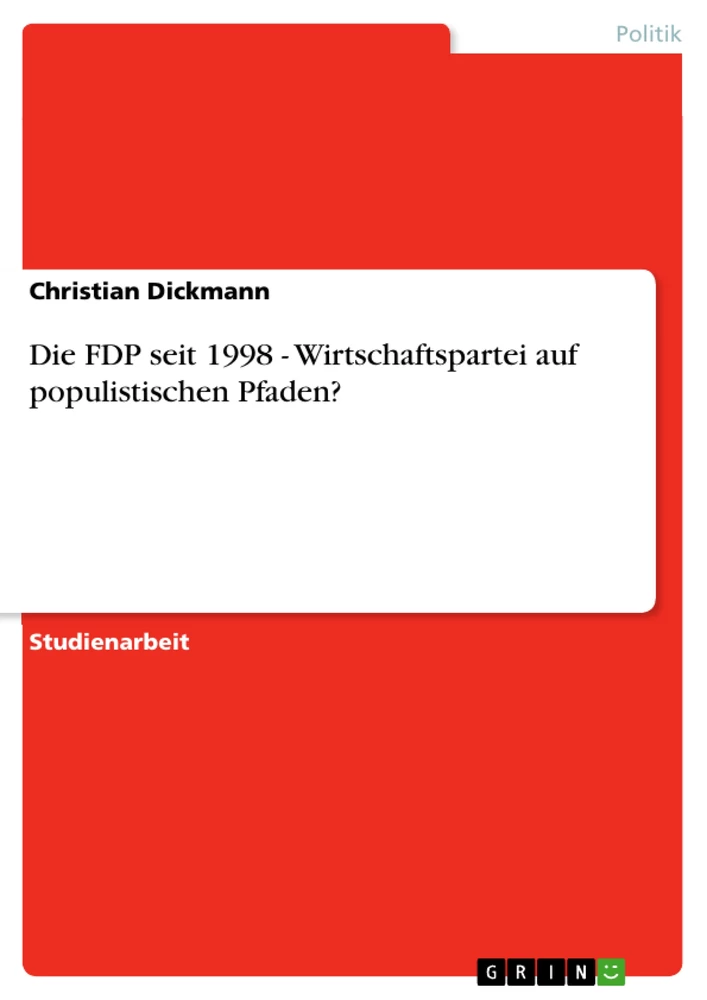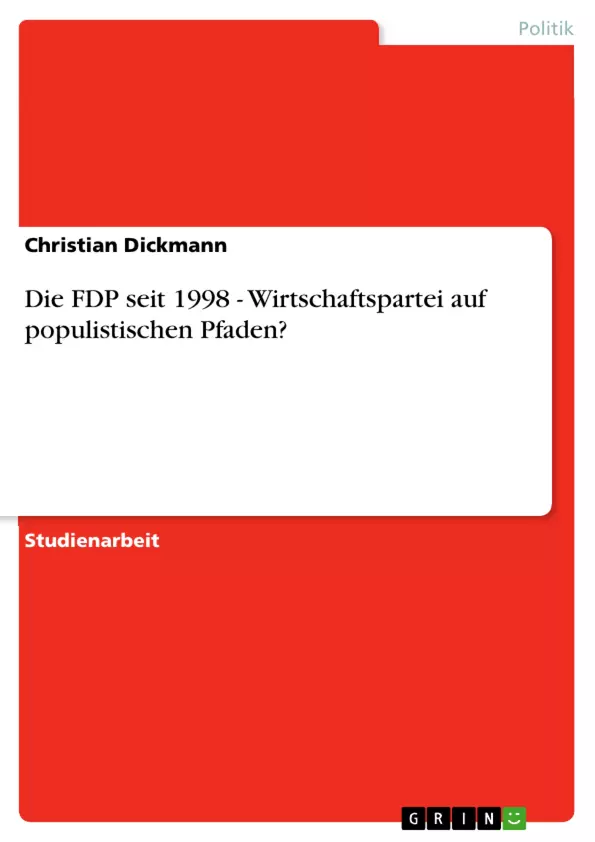Die FDP hat seit Beginn der neunziger Jahre bewegte Zeiten hinter sich gebracht. Die Partei beginnt das letzte Jahrzehnt des alten Jahrhunderts im Stimmungs- und im Stimmenhoch bei der Bundestagswahl 1990. Doch schon bald darauf setzt eine elektorale Krise ein, die der FDP regelmäßige Stimmenverluste bei Landtagswahlen und eine deutlich sinkende Zahl an Mandaten in Landes- und Kommunalparlamenten einbringt. Verbunden damit ist der Verlust von Macht und politischen Gestaltungsmöglichkeiten unterhalb der Bundesebene, denn auch die Zahl der Koalitionen auf Landesebene, an denen die FDP als kleinerer Partner der Regierung beteiligt ist, sinkt. Die FDP bleibt dennoch bis 1998 Teil der Koalition mit der CDU/CSU im Bund und wird damit ihrem Ruf als „ewiger“ Regierungspartei im Bund gerecht. In bis dahin 49 Jahren bundesrepublikanischer Geschichte ist sie nur in zwei Bundesregierungen (Adenau-er ab 1957 und Kiesinger ab 1966) nicht mit Ministern vertreten.
1998 mit dem Ende der Kanzlerschaft Kohls und der erstmaligen Etablierung einer rot-grünen Regierung auf Bundesebene verliert die FDP auch im Bund die Regierungsmacht. Gegenstand dieser Arbeit wird die Zeit nach dem Machtverlust mit einem Schwerpunkt auf die 14. Wahlperiode des Deutschen Bundestages 1998 - 2002 sein. Dieser Zeitraum beinhaltet sowohl ei-nen drohenden Niedergang als auch einen vermeintlichen steilen Aufstieg der Partei. Diese vier Jahre lehren jenseits der konkreten Ereignisse einiges über die Stellung der Partei im deutschen Parteiensystem und über die längerfristigen Probleme sowohl inhaltlicher als auch struktureller Art.
Intensiv diskutiert wird in diesem Zusammenhang das Projekt 18, also das strategische Leit-motto der FDP für den Bundestagswahlkampf. Neben dem Verlauf des Wahlkampfes stehen dabei die Gründe für das gemessen an den eigenen Zielen schwache Wahlergebnis im Mittel-punkt. Ziel ist es, die Alleinschuld-These Möllemanns, die nach der Wahl in der FDP entwickelt wird, kritisch zu hinterfragen.
Münden werden diese Betrachtungen in eine Schlussfolgerung, wie die Partei sich in Zukunft inhaltlich und strategisch positionieren kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Nach der Wahl '98 - Funktionspartei ohne Funktion
- Die FDP erfindet sich neu - Das Projekt 18
- Fehler im Bundestagswahlkampf der FDP
- Konsequenzen des Projektes 18
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Entwicklung der FDP nach dem Verlust der Regierungsmacht im Jahr 1998, mit besonderem Fokus auf die 14. Wahlperiode des Deutschen Bundestages (1998-2002). Sie untersucht die Gründe für den vermeintlichen Aufstieg und Niedergang der Partei in dieser Zeit und beleuchtet die Herausforderungen, die sich aus dem strategischen Leitmotto "Projekt 18" für die FDP ergeben haben.
- Die Positionierung der FDP als wirtschaftsliberale Partei im Kontext der veränderten politischen Landschaft nach 1998
- Die Auswirkungen des "großen Lauschangriffs" auf das Selbstverständnis der FDP und ihre Positionierung im Parteiensystem
- Die strategische Bedeutung des "Projekts 18" und die damit verbundenen inhaltlichen und strategischen Herausforderungen für die FDP
- Die Analyse der Fehler im Bundestagswahlkampf der FDP und die daraus resultierenden Konsequenzen für die Partei
- Die Rolle der FDP im deutschen Parteiensystem und die langfristigen Probleme der Partei in Bezug auf Inhalt und Struktur
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel legt die Grundlage für die Untersuchung, indem es die Situation der FDP vor dem Hintergrund der Bundestagswahl 1998 beleuchtet. Es beleuchtet die elektorale Krise der Partei in den neunziger Jahren und die damit verbundenen Veränderungen in ihrem Selbstverständnis.
Kapitel Zwei analysiert die Positionierung der FDP als "Funktionspartei ohne Funktion" nach der Bundestagswahl 1998. Es untersucht die Auswirkungen des "großen Lauschangriffs" und die Konsequenzen der wirtschaftsliberalen Schwerpunktsetzung für die Partei.
Kapitel Drei befasst sich mit dem "Projekt 18" und der damit verbundenen strategischen Neuausrichtung der FDP. Es analysiert die Ziele, die Inhalte und die Herausforderungen des Projekts.
Kapitel Vier setzt sich mit den Fehlern im Bundestagswahlkampf der FDP auseinander und beleuchtet die Gründe für das schwache Wahlergebnis.
Kapitel Fünf betrachtet die Konsequenzen des "Projekts 18" für die FDP. Es analysiert die Auswirkungen der strategischen Neuausrichtung auf die Positionierung der Partei im Parteiensystem.
Schlüsselwörter
Die Arbeit thematisiert die FDP im deutschen Parteiensystem, die Rolle der wirtschaftsliberalen Ideologie, das "Projekt 18", die Bundestagswahl 1998, die Folgen des "großen Lauschangriffs", den "Reformmotor" der Bundesrepublik, die Bedeutung der Steuerpolitik, die Herausforderungen der Koalitionspolitik und die Bedeutung der strategischen Positionierung.
Häufig gestellte Fragen
Wie entwickelte sich die FDP nach der Bundestagswahl 1998?
Nach dem Verlust der Regierungsmacht befand sich die FDP in einer Identitätskrise und versuchte, sich als „Funktionspartei ohne Funktion“ neu zu erfinden.
Was war das „Projekt 18“ der FDP?
Es war ein strategisches Leitmotto für den Bundestagswahlkampf 2002 mit dem Ziel, 18 % der Wählerstimmen zu erreichen und die FDP als eigenständige Kraft zu positionieren.
Warum scheiterte das Projekt 18 bei der Wahl 2002?
Die Arbeit analysiert strategische Fehler, inhaltliche Probleme und die kontroverse Rolle von Jürgen Möllemann als Gründe für das schwache Ergebnis.
Welchen Einfluss hatte der „große Lauschangriff“ auf die FDP?
Dieses Thema belastete das liberale Selbstverständnis der Partei und führte zu intensiven internen Diskussionen über die bürgerrechtliche Positionierung.
Wurde die FDP in dieser Zeit zur populistischen Partei?
Die Arbeit hinterfragt kritisch, ob die FDP unter dem Deckmantel einer Wirtschaftspartei zunehmend populistische Pfade einschlug, um Wähler zu gewinnen.
- Citar trabajo
- Christian Dickmann (Autor), 2005, Die FDP seit 1998 - Wirtschaftspartei auf populistischen Pfaden?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/51649