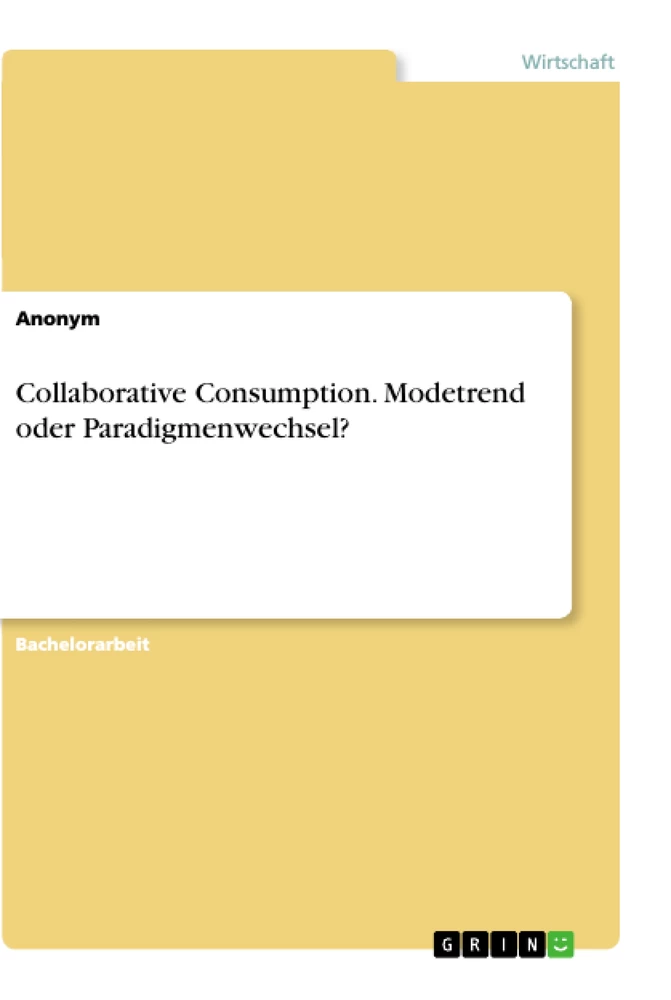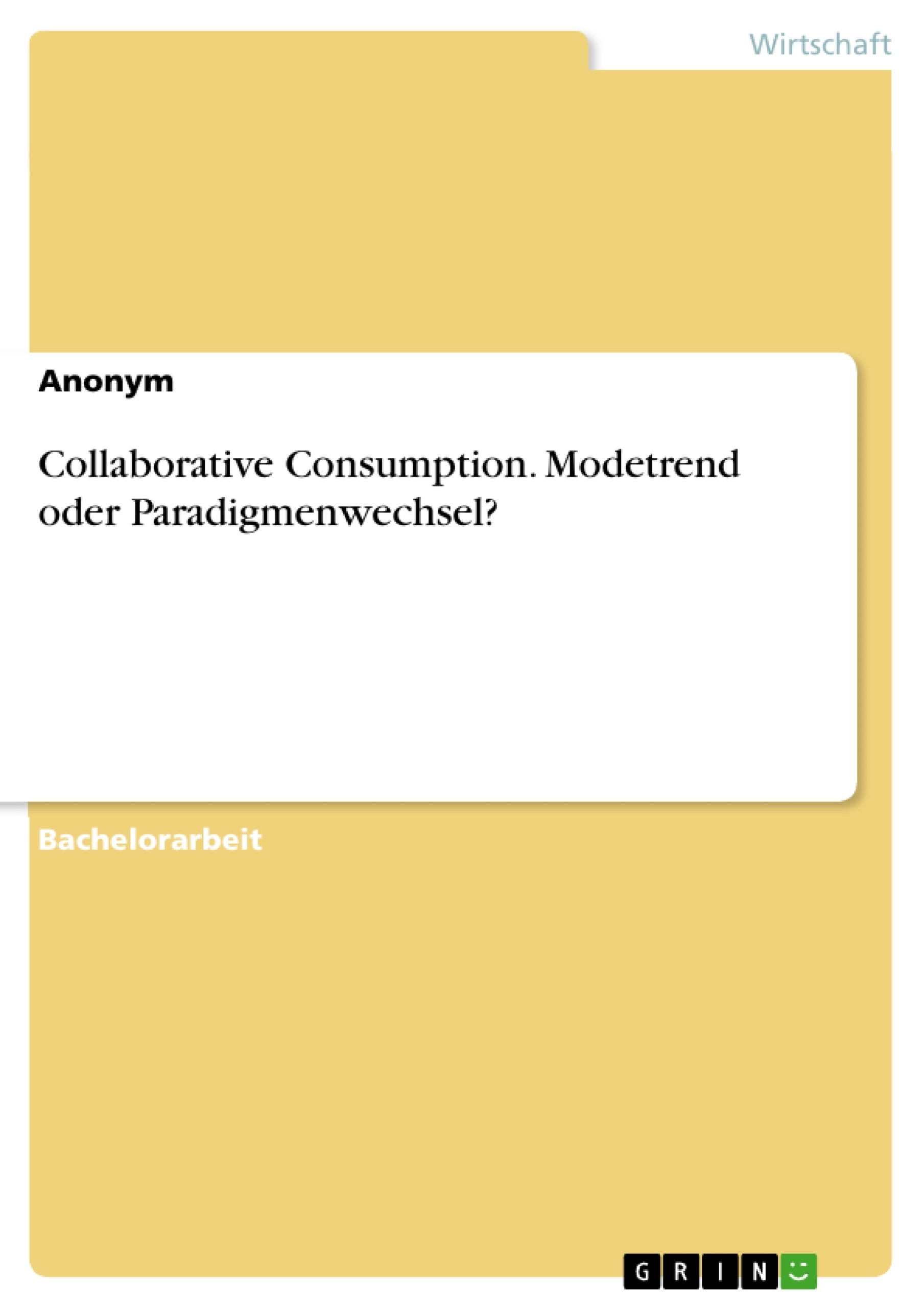Handelt es sich bei der Sharing Economy um einen temporär bestehenden Modetrend, welcher beispielsweise durch einen gesellschaftlichen Wandel verebben oder durch gesetzliche Regularien gestoppt werden wird? Denkbar ist aber auch, dass in den letzten Jahren tatsächlich ein Umbruch passiert ist. Die Kohortensukzession, prägende Themen wie die Finanzkrise und eine steigende Umweltbelastung haben zu einer nicht aufzuhaltenden Bewegung geführt, welcher unter Umständen ein hohes Wachstum zu unterstellen ist.
Diese Fragestellung soll im Fokus der vorliegenden Arbeit stehen. Unter der Berücksichtigung verschiedener Aspekte, welche als fördernde sowie auch als hemmende Faktoren bewertet werden können, soll schlussendlich die Frage, ob die Collaborative Consumption einen Modetrend oder einen Paradigmenwechsel darstellt, beantwortet werden. Einschränkend sei ergänzt, dass sich diese Betrachtung auf Deutschland begrenzt. Neben der Bereitstellung theoretischer Überlegungen soll mittels einer Primärerhebung geprüft werden, welche Einschätzung zur Zukunft der Collaborative Consumption realistische Chancen hat.
Die Befragung konzentriert sich dabei auf die Generationen Y und Z. Diese Einschränkung erfolgt, da diesen beiden Gruppen eine hohe Technikaffinität sowie ein gesteigertes Interesse an Umwelt- und Gesellschaftsaspekten unterstellt werden darf. Diese Grundeinstellung der Probanden stellt eine erhöht positive Basis für die Bestimmung der Zukunftsausrichtung der Collaborative Consumption dar.
Im Rahmen der Befragung wird von einem Betrachtungshorizont von zwei Jahren ausgegangen, d.h. die Befragten geben eine Einschätzung zu ihren Aktivitäten in den kommenden zwei Jahren. Diese Ergebnisse bieten eine Basis, von der aus sich eine Tendenz ableiten lässt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Zielsetzung
- 1.3 Gang der Arbeit
- 2. Allgemeine Grundlagen und Definitionen
- 2.1 Ursprung und historische Einordnung
- 2.2 Consumption
- 2.3 Collaborative Consumption
- 2.4 Modetrend
- 2.5 Paradigmen
- 2.6 Generationen Y und Z
- 3. Theoretische Auseinandersetzung mit den Zukunftsperspektiven der Collaborative Consumption
- 4. Gründe für die Entstehung einer Sharing Economy
- 4.1 Gesellschaftlicher Wandel unter dem Einfluss der Generationen Y und Z
- 4.2 Digitalisierung sowie technologischer Wandel
- 4.3 Nutzertypen
- 4.4 Nutzungsmotive
- 4.5 Geschäftsmodelle und Angebote
- 4.5.1 Gewinnerzielungsabsicht
- 4.5.2 Soziales Sharing
- 5. Fördernde und hemmende Faktoren
- 5.1 Ressourcenschutz und Nachhaltigkeit
- 5.2 Wachstum sowie neue Eintrittschancen in den Arbeitsmarkt
- 5.3 Rechtliche Hintergründe
- 5.4 Verdrängungseffekte
- 5.5 Informationsasymmetrien
- 6. Empirischer Zugang
- 6.1 Methodenwahl, Auswahl der Befragten sowie Ablauf der Befragung
- 6.2 Deskriptive Erkenntnisse
- 7. Kritische Analyse der Ergebnisse im Hinblick auf die Forschungsfrage
- 8. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit untersucht Collaborative Consumption und hinterfragt, ob es sich dabei um einen bloßen Modetrend oder einen grundlegenden Paradigmenwechsel handelt. Die Arbeit analysiert die Entstehungsgründe der Sharing Economy und beleuchtet sowohl fördernde als auch hemmende Faktoren. Ein empirischer Teil mittels einer Befragung liefert Erkenntnisse zur Praxis und Akzeptanz von Collaborative Consumption.
- Definition und Einordnung von Collaborative Consumption
- Analyse der treibenden Kräfte der Sharing Economy
- Untersuchung der gesellschaftlichen Auswirkungen von Collaborative Consumption
- Bewertung der Nachhaltigkeit und der ökonomischen Implikationen
- Auswertung empirischer Daten zur Akzeptanz und Nutzung von Collaborative Consumption
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel führt in das Thema Collaborative Consumption ein, beschreibt die Problemstellung und die Zielsetzung der Arbeit sowie den methodischen Ablauf.
2. Allgemeine Grundlagen und Definitionen: Dieses Kapitel liefert grundlegende Definitionen zu den zentralen Begriffen wie Consumption, Collaborative Consumption, Modetrend und Paradigmenwechsel. Es beleuchtet den historischen Ursprung des Phänomens und ordnet es in einen gesellschaftlichen Kontext ein, unter besonderer Berücksichtigung der Generationen Y und Z.
3. Theoretische Auseinandersetzung mit den Zukunftsperspektiven der Collaborative Consumption: Dieses Kapitel analysiert die theoretischen Grundlagen und diskutiert verschiedene Zukunftsperspektiven von Collaborative Consumption. Es werden verschiedene Modelle und Theorien vorgestellt, die das Phänomen erklären und prognostizieren.
4. Gründe für die Entstehung einer Sharing Economy: Dieses Kapitel untersucht die Faktoren, die zur Entstehung der Sharing Economy beigetragen haben. Es beleuchtet den gesellschaftlichen Wandel im Kontext der Generationen Y und Z, die zunehmende Digitalisierung und den technologischen Fortschritt. Es werden verschiedene Nutzertypen und deren Nutzungsmotive detailliert analysiert, sowie vorherrschende Geschäftsmodelle vorgestellt.
5. Fördernde und hemmende Faktoren: Hier werden die Faktoren beleuchtet, die Collaborative Consumption fördern oder hemmen. Ressourcenschutz und Nachhaltigkeit, Wachstumspotenziale und neue Arbeitsmarktchancen werden den rechtlichen Aspekten, Verdrängungseffekten und Informationsasymmetrien gegenübergestellt.
6. Empirischer Zugang: Dieses Kapitel beschreibt die Methodik der durchgeführten empirischen Untersuchung. Es erläutert die Auswahl der Befragten, den Ablauf der Befragung und die verwendeten Methoden der Datenanalyse. Die gewonnenen deskriptiven Erkenntnisse werden präsentiert.
Schlüsselwörter
Collaborative Consumption, Sharing Economy, Modetrend, Paradigmenwechsel, Generation Y, Generation Z, Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Ressourcenschutz, ökonomische Auswirkungen, gesellschaftlicher Wandel, empirische Forschung, Nutzertypen, Geschäftsmodelle.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: Collaborative Consumption - Modetrend oder Paradigmenwechsel?
Was ist der Gegenstand der Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht Collaborative Consumption (auch Sharing Economy genannt) und analysiert, ob es sich dabei um einen kurzlebigen Modetrend oder einen fundamentalen Paradigmenwechsel handelt. Die Arbeit beleuchtet die Entstehungsgründe, fördernde und hemmende Faktoren sowie die gesellschaftlichen Auswirkungen dieser Entwicklung.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit umfasst die Definition und Einordnung von Collaborative Consumption, die Analyse der treibenden Kräfte der Sharing Economy, die Untersuchung der gesellschaftlichen Auswirkungen, die Bewertung der Nachhaltigkeit und der ökonomischen Implikationen sowie die Auswertung empirischer Daten zur Akzeptanz und Nutzung von Collaborative Consumption. Dabei werden verschiedene Nutzertypen, Geschäftsmodelle und deren Motive berücksichtigt.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in acht Kapitel: Einleitung (Problemstellung, Zielsetzung, Methodik), Allgemeine Grundlagen und Definitionen (Consumption, Collaborative Consumption, historische Einordnung, Generationen Y und Z), Theoretische Auseinandersetzung mit den Zukunftsperspektiven, Gründe für die Entstehung der Sharing Economy (gesellschaftlicher Wandel, Digitalisierung, Nutzertypen, Nutzungsmotive, Geschäftsmodelle), Fördernde und hemmende Faktoren (Ressourcenschutz, Nachhaltigkeit, rechtliche Aspekte, Verdrängungseffekte), Empirischer Zugang (Methodenwahl, Befragung, deskriptive Ergebnisse), Kritische Analyse der Ergebnisse und Fazit/Ausblick.
Welche Methoden werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit kombiniert eine theoretische Auseinandersetzung mit dem Thema Collaborative Consumption mit einer empirischen Untersuchung. Der empirische Teil basiert auf einer Befragung, deren Methodik detailliert beschrieben und deren Ergebnisse deskriptiv ausgewertet werden.
Welche Schlüsselfaktoren werden im Hinblick auf Collaborative Consumption untersucht?
Die Arbeit analysiert sowohl fördernde Faktoren wie Ressourcenschutz, Nachhaltigkeit und neue Arbeitsmarktchancen als auch hemmende Faktoren wie rechtliche Unsicherheiten, Verdrängungseffekte und Informationsasymmetrien. Dabei wird der Einfluss der Digitalisierung und der gesellschaftlichen Veränderungen durch die Generationen Y und Z besonders berücksichtigt.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, Collaborative Consumption umfassend zu definieren, die Ursachen für dessen Entstehung zu analysieren und die damit verbundenen Chancen und Risiken zu bewerten. Die empirische Untersuchung soll Aufschluss über die Akzeptanz und Nutzung von Collaborative Consumption in der Praxis geben.
Wer ist die Zielgruppe der Arbeit?
Die Arbeit richtet sich an ein akademisches Publikum, insbesondere an Leser, die sich für die Themen Collaborative Consumption, Sharing Economy, gesellschaftlicher Wandel und digitale Transformation interessieren.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit am besten?
Collaborative Consumption, Sharing Economy, Modetrend, Paradigmenwechsel, Generation Y, Generation Z, Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Ressourcenschutz, ökonomische Auswirkungen, gesellschaftlicher Wandel, empirische Forschung, Nutzertypen, Geschäftsmodelle.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2019, Collaborative Consumption. Modetrend oder Paradigmenwechsel?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/516549