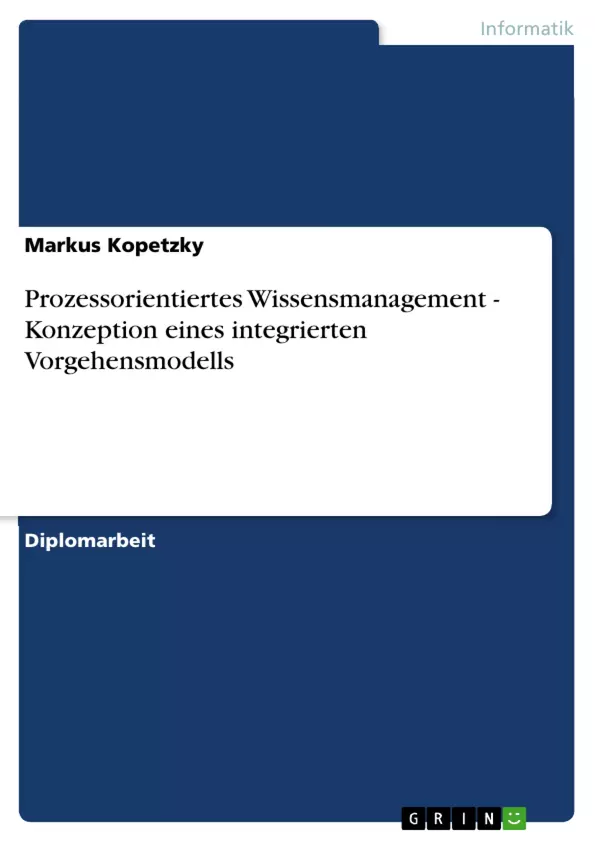Die Vielzahl der Veröffentlichungen deutet seit Beginn der Neunziger Jahre auf zwei exponierte Schwerpunkte bis heute aktuellen Managementinteresses hin. Prozess- und Wissensmanagement sind in den Fokus weltweiter Aufmerksamkeit unternehmerischer Entscheider gerückt. Die vorliegende Arbeit stellt Integrationsopportunitäten und daraus resultierende Synergieeffekte beider Konzepte heraus und kulminiert in einem integrierten Vorgehensmodell. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich im zweiten und dritten Kapitel mit fundamentalen Ausführungen zum Wissens- und Prozessmanagement und liefert Antworten auf die Fragen: # Wie stellt sich die aktuelle Entwicklung des jeweils relevanten, unternehmerischen Umfeldes überblicksartig dar? # Wie werden die terminologischen Grundlagen definiert? # Wo liegt der strategische Nutzen des jeweiligen Konzepts? # Wie wird der jeweilige Managementansatz in der Praxis beurteilt und welche Verbreitung findet dieser? Im vierten Kapitel wird auf die Beziehungen und wechselseitigen Bedingungen zwischen dem Prozess- und Wissensmanagement eingegangen, um die Notwendigkeit einer integrativen, synergetischen Betrachtung zu unterstreichen. Das fünfte Kapitel analysiert aktuelle Ansätze des Wissens- und Prozessmanagements unter Berücksichtigung eines im Vorfeld entwickelten Ordnungsrahmens, um diese zu einem Vorgehensmodell im letzten Schritt zu synthetisieren. Ein Resümee bzw. einen Ausblick auf die prospektive Entwicklung dieser Thematik liefert abschließend das sechste Kapitel.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einführung
- 2 Grundlagen
- 2.1 Wissensmanagement
- 2.1.1 Empirische Phänomene
- 2.1.2 Grundlagen und Überblick
- 2.1.3 Grundlagen des strategischen Managements
- 2.1.4 Wissensmanagement und Kernkompetenz
- 2.1.5 Empirische Studien
- 2.2 Prozessmanagement
- 2.2.1 Funktionsorientierung versus Prozessorientierung
- 2.2.2 Terminologische Grundlagen
- 2.2.3 Prozessmanagement und Kernkompetenz
- 2.2.4 Explorative Studien
- 2.3 Interdependenzen und Synergien
- 2.3.1 Konnex aus Geschäftsprozessen und Wissen
- 2.3.2 Prozess „Wissensmanagement“
- 3 Integriertes Vorgehensmodell
- 3.1 Vorgehensweise
- 3.2 Modellrahmen
- 3.3 Konzeptanalysen
- 3.3.1 Konzepte des Wissensmanagements
- 3.3.2 Konzepte des Prozessmanagements
- 3.4 Konzeptsynthese
- 3.4.1 Strategieableitung
- 3.4.2 Aufgaben
- 3.4.3 Rahmenbedingungen
- 3.4.4 Vorgehensmodell
- Prozessorientiertes Wissensmanagement
- Integration von Wissensmanagement und Prozessmanagement
- Konzeption eines integrierten Vorgehensmodells
- Analyse bestehender Konzepte des Wissens- und Prozessmanagements
- Strategische Implikationen für das Wissensmanagement
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit verfolgt das Ziel, ein integriertes Vorgehensmodell für prozessorientiertes Wissensmanagement zu konzipieren. Die Arbeit untersucht die Interdependenzen zwischen Wissensmanagement und Geschäftsprozessen und entwickelt darauf basierend ein praxisorientiertes Modell.
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einführung: Dieses Kapitel dient als Einleitung in die Thematik des prozessorientierten Wissensmanagements und liefert eine erste Übersicht über die Relevanz des Themas. Es skizziert den Aufbau der Arbeit und benennt die zentrale Forschungsfrage.
2 Grundlagen: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für die spätere Modellentwicklung. Es beleuchtet das Wissensmanagement umfassend, beginnend mit empirischen Phänomenen wie dem Anstieg des Wissensangebots und der Fragmentierung von Wissen. Weiterhin werden grundlegende Konzepte des strategischen Managements, insbesondere der Ressourcen-basierte Ansatz, im Kontext des Wissensmanagements diskutiert. Es werden auch relevante empirische Studien vorgestellt, um den aktuellen Stand der Forschung darzustellen. Der Abschnitt zum Prozessmanagement erläutert die Unterschiede zwischen funktions- und prozessorientierten Ansätzen und die Bedeutung von Prozessmanagement für die Kernkompetenzentwicklung. Schliesslich werden die Interdependenzen zwischen Geschäftsprozessen und Wissen systematisch analysiert.
3 Integriertes Vorgehensmodell: In diesem Kapitel steht die Entwicklung des integrierten Vorgehensmodells im Mittelpunkt. Es werden verschiedene Konzepte des Wissens- und Prozessmanagements analysiert und miteinander verglichen, um eine fundierte Konzeptsynthese zu ermöglichen. Die Strategieableitung, die Definition von Aufgaben und die Berücksichtigung von Rahmenbedingungen bilden weitere Schwerpunkte. Das Kapitel mündet in der Präsentation des entwickelten Vorgehensmodells.
Schlüsselwörter
Prozessorientiertes Wissensmanagement, Geschäftsprozessmanagement, Wissensmanagement, Kernkompetenz, Integriertes Vorgehensmodell, Strategisches Management, Ressourcenbasierter Ansatz, Konzeptanalyse, Modellentwicklung.
Häufig gestellte Fragen zur Diplomarbeit: Integriertes Vorgehensmodell für prozessorientiertes Wissensmanagement
Was ist der Hauptfokus dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit konzentriert sich auf die Konzeption eines integrierten Vorgehensmodells für prozessorientiertes Wissensmanagement. Sie untersucht die enge Verknüpfung von Wissensmanagement und Geschäftsprozessen und entwickelt daraus ein praxisorientiertes Modell.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: prozessorientiertes Wissensmanagement, die Integration von Wissensmanagement und Prozessmanagement, die Konzeption eines integrierten Vorgehensmodells, die Analyse bestehender Konzepte im Wissens- und Prozessmanagement sowie die strategischen Implikationen für das Wissensmanagement.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in drei Hauptkapitel: Kapitel 1 (Einführung) bietet einen Überblick über die Thematik und die Forschungsfrage. Kapitel 2 (Grundlagen) legt die theoretischen Grundlagen zu Wissens- und Prozessmanagement dar, inklusive empirischer Studien und der Analyse von Interdependenzen. Kapitel 3 (Integriertes Vorgehensmodell) präsentiert die Entwicklung des Modells, die Analyse bestehender Konzepte und die resultierende Konzeptsynthese, inklusive Strategieableitung, Aufgabendefinition und Berücksichtigung von Rahmenbedingungen.
Welche theoretischen Grundlagen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt grundlegende Konzepte des Wissensmanagements, beginnend mit empirischen Phänomenen wie dem Anstieg des Wissensangebots und der Fragmentierung von Wissen. Es werden Konzepte des strategischen Managements, insbesondere der ressourcenbasierte Ansatz, im Kontext des Wissensmanagements diskutiert. Weiterhin werden relevante empirische und explorative Studien vorgestellt, um den aktuellen Stand der Forschung darzustellen. Der Abschnitt zum Prozessmanagement erläutert die Unterschiede zwischen funktions- und prozessorientierten Ansätzen und die Bedeutung von Prozessmanagement für die Kernkompetenzentwicklung.
Was ist das Ergebnis der Arbeit?
Das Ergebnis der Arbeit ist ein entwickeltes, integriertes Vorgehensmodell für prozessorientiertes Wissensmanagement. Dieses Modell basiert auf einer umfassenden Analyse bestehender Konzepte und berücksichtigt strategische Implikationen sowie relevante Rahmenbedingungen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Prozessorientiertes Wissensmanagement, Geschäftsprozessmanagement, Wissensmanagement, Kernkompetenz, Integriertes Vorgehensmodell, Strategisches Management, Ressourcenbasierter Ansatz, Konzeptanalyse, Modellentwicklung.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für alle, die sich mit Wissensmanagement, Prozessmanagement und der Integration beider Bereiche beschäftigen, insbesondere in akademischen und praktischen Kontexten. Sie bietet wertvolle Erkenntnisse für die Entwicklung und Implementierung von prozessorientierten Wissensmanagement-Strategien.
Wo finde ich das vollständige Inhaltsverzeichnis?
Das vollständige Inhaltsverzeichnis mit detaillierter Gliederung der Kapitel und Unterkapitel ist im Anfangsteil der Diplomarbeit enthalten. (siehe oben)
- Citation du texte
- Markus Kopetzky (Auteur), 2005, Prozessorientiertes Wissensmanagement - Konzeption eines integrierten Vorgehensmodells, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/51654