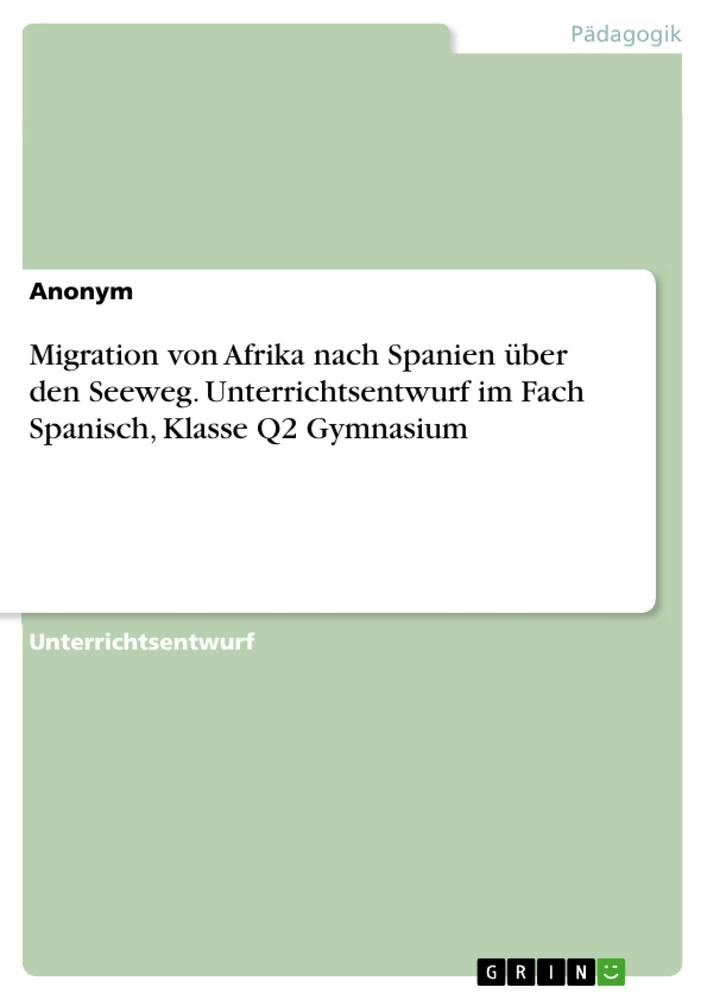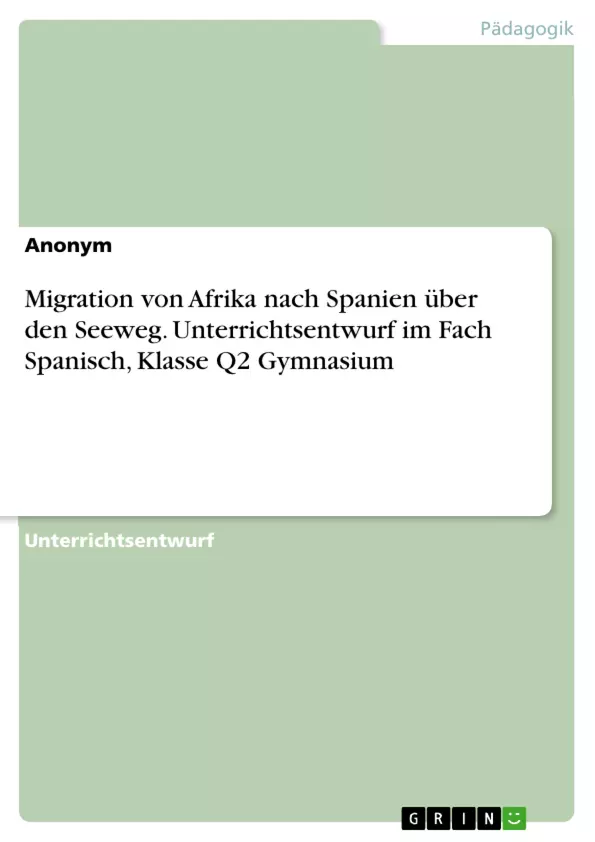Kompletter Unterrichtsentwurf einer Examensstunde im Fach Spanisch einer Q2. Das zentrale Unterrichtsanliegen der hier dargestellten Unterrichtsstunde bildet die Schulung und Förderung der funktionalen kommunikativen Kompetenz im Bereich des Leseverstehens. Die Schülerinnen und Schüler sollen sich dazu mit einem authentischen Artikel der spanischen Zeitung El País befassen.
Folgt man den Hinweisen des Kernlehrplans für das Fach Spanisch in der gymnasialen Oberstufe ist eines der Leitziele des modernen Fremdsprachenunterrichts die Förderung der interkulturellen Handlungsfähigkeit und Kompetenz. Dem wird in der Unterrichtsreihe Rechnung getragen, indem die Schülerinnen und Schüler sich eingehend mit der Lebenswirklichkeit von (illegalen) Migranten nach und in Spanien auseinandersetzen.
Die EU gilt als Haupteinwanderungsregion für afrikanische Zuwanderer, wo sie sich bessere Lebensumstände erhoffen. Dabei stehen die Flüchtlingsströme von Afrika nach Spanien exemplarisch für ein globales Phänomen von Migrationsbewegungen auf der Welt. Die Aktualität dieser Thematik, die uns durch tägliche Schlagzeilen begegnet, spielt eine wichtige Rolle.
Inhaltsverzeichnis
- Planungsentscheidungen zur Unterrichtsreihe
- Hinweise zur Lernausgangslage
- Legitimation der Unterrichtsreihe
- Didaktisch-methodische Überlegungen zur Unterrichtsreihe
- Tabellarische Planung der Unterrichtsreihe
- Planungsentscheidungen zur Unterrichtsstunde
- Hinweise zur Lernausgangslage
- Lernziele und Kompetenzen der Unterrichtsstunde
- Kernanliegen der Unterrichtsstunde
- Teillernziele
- Didaktisch-methodische Überlegungen zur Unterrichtsstunde
- Geplanter Stundenverlauf
- Literatur
- Fachliteratur
- Lehrpläne
- Verwendete Arbeitsmittel/Links
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Unterrichtsreihe befasst sich mit der Thematik der illegalen Migration aus Afrika nach Spanien auf dem Seeweg, wobei die Schülerinnen und Schüler die lebensbedrohlichen Bedingungen dieser Migrationsroute anhand eines Artikels aus El País kennenlernen. Die Reihe verfolgt das Ziel, die interkulturelle Handlungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler zu fördern und sie mit der Lebenswirklichkeit von Migranten vertraut zu machen. Die Unterrichtsreihe konzentriert sich dabei auf die Herausforderungen der Migration, die unterschiedlichen Motivationsfaktoren der Migranten und die Gefahren, denen sie auf ihrer Reise ausgesetzt sind.
- Lebensumstände von Migranten in Afrika und Spanien
- Herausforderungen und Gefahren auf der Migrationsroute
- Motivationsfaktoren für die Migration
- Politische und gesellschaftliche Aspekte der Migration
- Interkulturelle Kompetenz und Empathie
Zusammenfassung der Kapitel
Der erste Teil der Unterrichtsreihe befasst sich mit den planungsentscheidenden Aspekten, darunter die Hinweise zur Lernausgangslage und die Legitimation der Unterrichtsreihe. Dieser Teil bietet einen Überblick über die Lerngruppe, die Unterrichtskonzeption und die didaktisch-methodischen Überlegungen. Im zweiten Teil werden die planungsentscheidenden Aspekte für die Unterrichtsstunde, insbesondere die Lernziele und Kompetenzen, detailliert beleuchtet.
Schlüsselwörter
Migration, Illegalität, Afrika, Spanien, El País, Lebensbedingungen, Gefahren, Motivationsfaktoren, interkulturelle Kompetenz, Empathie, Push- und Pull-Faktoren, Lebenswirklichkeit, Migrationsprobleme, Integration.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dem Unterrichtsentwurf für das Fach Spanisch?
Das Thema ist die illegale Migration von Afrika nach Spanien über den Seeweg, basierend auf einem Artikel aus der Zeitung El País.
Welche Kompetenzen sollen die Schüler fördern?
Im Fokus stehen das Leseverstehen (funktionale kommunikative Kompetenz) und die interkulturelle Handlungsfähigkeit.
Was sind Push- und Pull-Faktoren in diesem Kontext?
Push-Faktoren sind Gründe zur Flucht aus Afrika (Armut, Krieg), Pull-Faktoren sind die Hoffnung auf bessere Lebensumstände in der EU.
Warum ist das Thema für die gymnasiale Oberstufe geeignet?
Es behandelt ein hochaktuelles globales Phänomen und entspricht den Anforderungen des Kernlehrplans zur Förderung von Empathie und interkultureller Kompetenz.
Welche Materialien werden im Unterricht verwendet?
Es wird ein authentischer Zeitungsartikel von El País sowie begleitende didaktisch-methodische Arbeitsmittel genutzt.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2018, Migration von Afrika nach Spanien über den Seeweg. Unterrichtsentwurf im Fach Spanisch, Klasse Q2 Gymnasium, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/516808