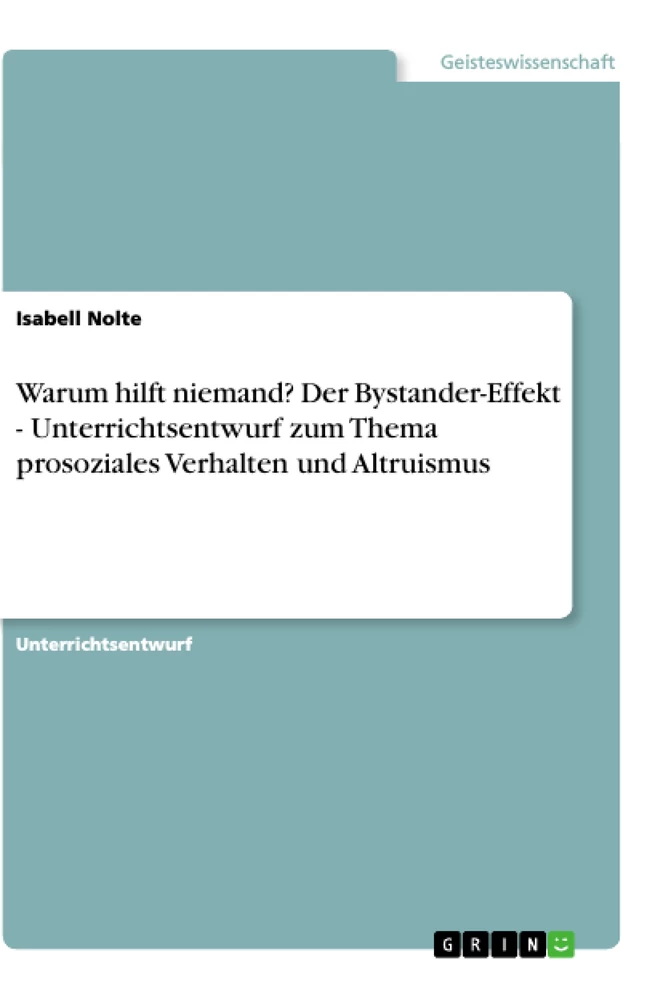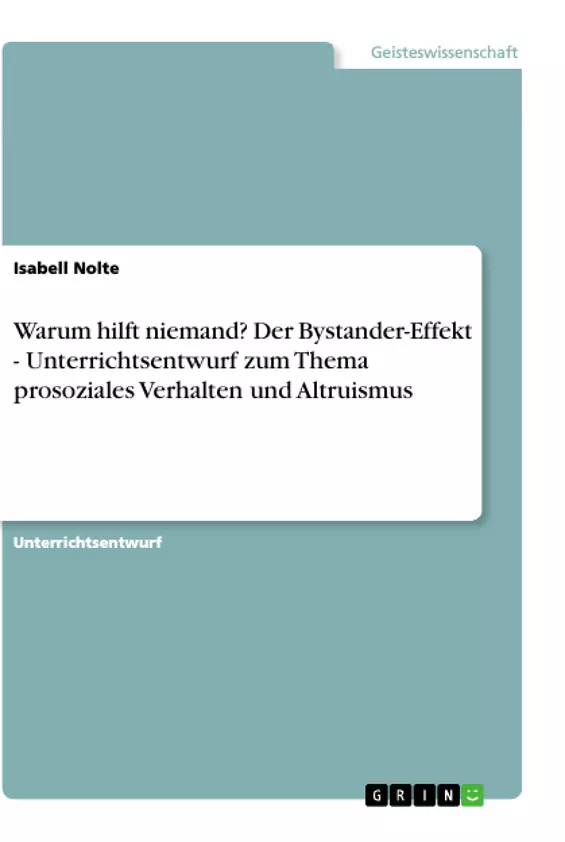Thema der Unterrichtsstunde ist das Hilfeverhalten von Menschen und warum weniger Menschen helfen, desto mehr in einer Notsituation anwesend sind. In der Einstiegsphase sehen die Schüler einen Filmausschnitt, in dem die Hilfsbereitschaft in einer U-Bahn getestet wurde. Nachdem über das Gesehene gesprochen wurde, liest jeder Schüler einen von zwei Texten, die sich mit dem Fall Kitty Genovese und jeweils einem Experiment von Darley und Latané beschäftigen. Die herausgearbeiteten Ergebnisse werden anschließend anhand von Folien vorgestellt, die anderen Schüler und der Lehrer ergänzen. Die Hausaufgabe vertieft das Thema Hilfsbereitschaft noch einmal und schafft einen Transfer zur nächsten Stunde.
Die Schüler können die Begriffe Hilfeverhalten, Bystander-Effekt, Verantwortungsdiffusion und das Definitionsproblem anhand des Textes erläutern. Sie können sozialpsychologische Feldexperimente analysieren und bewerten. Sie erkennen Situationen, in denen es schnell zu Verantwortungsdiffusion kommen kann und können ihr Wissen darüber nutzen, auf den Alltag übertragen und eingreifen. Außerdem können die Schüler Möglichkeiten zur Förderung prosozialen Verhaltens erörtern.
Inhaltsverzeichnis
1. Tabellarischer Unterrichtsentwurf
2. Überblick Stunde
3. Lernziel der Stunde
4. Bedingungsanalyse
5. Verankerung im Lehrplan
6. Kurze Sachanalyse
7. Paradigmatischer Bezug
8. Begründung didaktisch-methodischer Entscheidungen
Anhang
Abbildungen
Quellen
1. Tabellarischer Unterrichtsentwurf
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
2. Überblick Stunde
T hema der Unterrichtsstunde ist das Hilfeverhalten von Menschen und warum weniger Menschen helfen, desto mehr in einer Notsituation anwesend sind. In der Einstiegsphase sehen die SuS ein Filmausschnitt, in dem die Hilfsbereitschaft in einer U-Bahn getestet wurde. Nachdem über das Gesehene gesprochen wurde, liest jeder Schüler einen von zwei Texten, die sich mit dem Fall Kitty Genovese und jeweils einem Experiment von Darley und Latané beschäftigen. Die herausgearbeiteten Ergebnisse werden anschließend anhand von Folien und einem OHP vorgestellt, die anderen SuS und der Lehrer ergänzen ggf. Die Hausaufgabe vertieft das Thema Hilfsbereitschaft noch einmal und schafft einen Transfer zur nächsten Stunde.
3. Lernziel der Stunde
Die SuS können die Begriffe Hilfeverhalten, Bystander-Effekt, Verantwortungsdiffusion und das Definitionsproblem anhand des Textes „warum hilft niemand“ (…) erläutern. Sie können sozialpsychologische Feldexperimente (Kriterien orientiert/nach ihren ethischen Aspekten) analysieren und bewerten. Sie erkennen Situationen, in denen es schnell zu Verantwotungsdiffusion kommen kann und können ihr Wissen darüber nutzen und auf den Alltag übertragen und eingreifen. Außerdem können die SuS Möglichkeiten zur Förderung prosozialen Verhaltens erörtern.
4. Bedingungsanalyse
- LK 12.1
- 15 SuS (11 Mädchen & 4 Jungen zwischen 16 und 18 Jahren)
- Leistungsheterogene Lerngruppe: In der Klasse sind 7 Schüler mit Migrationshintergrund, deren Deutschkenntnisse gut bis sehr gut sind. Es gibt einen etwas kürzeren und einen etwas längeren Text. Vom Schwierigkeitsgrad unterscheiden sich die beiden kaum voneinander.
- Stundenvolumen: zwei 90-minütige und eine 45-minütige Unterrichtseinheit pro Woche
- Eingliederung in die Unterrichtsreihe „prosoziales Verhalten und Altruismus“ (20 Stunden LK, 12 GK)
- (Vorher: Einstellung und Einstellung und Verhalten)
- Nachher behandelt: : Prozessmodell nach Darley & Latané; Kosten-Nutzen-Modell nach Piliavin & Piliavin; Empathie - Altruismus - Hypothese nach Batson
5. Verankerung im Lehrplan
Inhaltsfeld 2: Das Individuum in Interaktion in Interaktion mit anderen, Thema: prosoziales Verhalten und Altruismus
Konkretisierte Kompetenzerwartungen:
Die SuS:
„…erläutern situative Determinanten und kognitive Aspekte anhand von Falldarstellungen und empirischen Untersuchungen von Hilfeverhalten“ (SK) (KLP, S. 25
„…analysieren Feldexperimente kriterienorientiert“ (SK) (KLP, S. 25)
Übergeordnete Kompetenzerwartungen:
Die SuS:
„… bewerten ethische Aspekte und Implikationen sozialpsychologischer Experimente“ (UK) (KLP, S. 26)
„...beurteilen die mit sozialpsychologischen Methoden erworbenen Daten“ (UK) (???)
Übergeordnete Kompetenzerwartungen für den Leistungskurs:
Die SuS:
„…analysieren situative Determinanten und kognitive Aspekte von Hilfeleistung anhand von Falldarstellungen und empirischen Untersuchungen“ (SK) (KLP, S.33)
„…erörtern Möglichkeiten zur Förderung prosozialen Verhaltens“ (UK) (KLP, S. 33)
6. Kurze Sachanalyse
- Hilfeverhalten bezeichnet „jede freiwillig durchgeführte Tat, die das Ziel hat, eine andere Person zu unterstützen“ (Lexikon der Psychologie (2000). Hilfeverhalten)
- Jeder Mensch erwartet vermutlich von anderen, dass sie ihm in einer Notsituation helfen, solange ihr eigenes Wohl nicht gefährdet ist. Doch oftmals tritt leider das Gegenteil ein, die Person, die Hilfe benötigt, wird allein gelassen. Experimente von Darley und Latané zeigten, dass je mehr Personen Zeuge einer Hilfesituation sind, desto unwahrscheinlicher ist es, dass zumindest einer helfen wird („bystander effect“).
- Das Abschieben der Verantwortung auf andere Personen wird als Verantwortungsdiffusion bezeichnet (Lexikon der Psychologie (2000). Verantwortungsdiffusion.)
- pluralistische Ignoranz „ tritt auf, wenn mehrere Personen eine Notsituation beobachten. Jeder einzelne Beobachter nimmt dann an, es bestünde kein Problem, da kein anderer Beobachter betroffen wirkt oder Anzeichen von Panik zeigt“ (Lexikon der Psychologie (2000). Pluralistische Ignoranz.)
- positiv: wenn alle Beobachter ruhig bleiben, kommt es nicht so schnell zu einer Massenpanik; das Individuum schützt sich vor möglichen Konsequenzen, die aus der Verantwortung entstehen; wenn sich jeder verantwortlich fühlen würde und helfen wollen würde, käme es wahrscheinlich schnell zu Konflikten, da jeder seine eigene Vorstellung von Hilfe hat und evtl. durchsetzen will
- Negativ: In Notsituationen nicht handeln (à unterlassene Hilfeleistung ist strafbar); à kann bis hin zum Tod führen
- Wissen über Verantwortungsdiffusion und pluralistische Ignoranz hilft uns in Notsituationen einzuschreiten, während alle anderen die Verantwortung auf die anderen schieben und sich an den Reaktionen der anderen orientieren.
7. Paradigmatischer Bezug
Ganzheitspsychologie: Psychische Phänomene werden als Ganzheiten betrachtet und die einzelnen Teile der Ganzheit beeinflussen sich gegenseitig. So ist auch das Verhalten des Einzelnen durch das Ganze bestimmt. Dazu gehört auch in welcher Situation sich die Person befindet. Hier besteht ein offensichtlicher Zusammenhang zum Hilfeverhalten und zur Verantwortungsdiffusion. Die Gruppengröße wirkt sich je nach Anzahl an Mitgliedern unterschiedlich auf das Hilfeverhalten des Einzelnen aus. Es entwickelt sich ganz automatisch eine Gruppendynamik, in der fast alle die Verantwortung auf die anderen schieben. Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Ganzheiten können bewirken, dass sich Einzelne in ihrem Handeln gehemmt fühlen, da der Rest gelassen wirkt und nichts tut, sodass sie Notfallsituationen nicht als solche erkennen, abwarten und nicht einschreiten. à Grund dafür: Verantwortungsdiffusion und pluralistische Ignoranz. (vgl. Sämmer, 1993)
8. Begründung didaktisch-methodischer Entscheidungen
- Filmsequenz als Einstieg: Alltagsnahes Beispiel, das den SuS bekannt ist- Einführung in das Thema: SuS können Reaktionen der Fahrgäste beobachten, überlegen wie sie sich in dieser Situation verhalten hätten und, ob sie vergleichbare Situationen erlebt haben
Textbearbeitung:
- Handlungsorientiert (vgl. Jank & Meyer, 2002): Stunde zielt auf Handlungsprodukt, das aktiv erstellt wird. Verknüpfung von Kopf- und Handarbeit: Informationen aus dem Text auf die Folien (Handlungsprodukt) bringen. - Lehrergesteuerte und schülerorientierte Form der Individualisierung: Lehrer teilt Gruppen zu (achtet auf gleichmäßige Verteilung leistungsstarker und –schwacher SuS). Die Texte und Aufgaben sind ihrem Umfang her daran angepasst.
Anhang
I. Arbeitsaufträge
Filmausschnitt: Beschreiben Sie die Reaktionen der Fahrgäste. Wie hätten Sie sich wohl in dieser Situation verhalten? Haben Sie schon mal vergleichbare Situationen erlebt?
Textberabeitung:
Gruppe A
1. Lesen Sie zunächst den Text „Warum hilft niemand“ (Spiegel online (2006) . Warum hilft niemand?)
2. Bestimmen Sie zwei Personen, die die bearbeiteten Aufgaben auf Folien schreibt und die nach möglichem Ergänzungsbedarf für alle kopiert werden.
3. Nun dürfen Sie sich für eine der beiden Aufgaben entscheiden. Jeweils zwei Personen können an den folgenden Aufgaben gemeinsam arbeiten. Am Ende stellen die beiden die bearbeiteten Aufgaben auf Folie vor.
a. Beschreiben Sie was es mit dem Fall Kitty Genovese auf sich hat.
b. Arbeiten Sie die Ergebnisse des Experiments (Verantwortungsdiffusion) von Darley und Latané heraus.
c. Konkretisieren Sie das Phänomen der Verantwortungsdiffusion.
d. Bewerten Sie die beiden Studien hinsichtlich ethischer Aspekte.
Gruppe B
1. Lesen Sie zunächst den Text „Warum hilft niemand“ (Spiegel online (2006) . Warum hilft niemand?)
2. Bestimmen Sie zwei Personen, die die bearbeiteten Aufgaben auf Folien schreibt und die nach möglichem Ergänzungsbedarf für alle kopiert werden.
3. Nun dürfen Sie sich für eine der beiden Aufgaben entscheiden. Jeweils zwei Personen können an den folgenden Aufgaben gemeinsam arbeiten. Am Ende stellen die beiden die bearbeiteten Aufgaben auf Folie vor.
a. Beschreiben Sie was es mit dem Fall Kitty Genovese auf sich hat.
b. Arbeiten Sie die Ergebnisse des Experiments (Definitionsproblem) von Darley und Latané heraus.
c. Konkretisieren Sie das Phänomen der Verantwortungsdiffusion.
d. Überlegen Sie sich, wie man mehr Menschen in Zukunft zum Handeln und Einschreiten in Notsituationen bringen kann.
Hausaufgabe
Informieren Sie sich über die Urban-Overload-Hypothese und schreiben Sie die wesentlichen Aspekte heraus.
Gruppe A
Warum hilft niemand?
Am 27. März 1964 druckte die New York Times einen der schockierendsten Artikel in ihrer 155-jährigen Geschichte. Er begann mit dem Satz: "Mehr als eine halbe Stunde lang schauten 38 achtbare, gesetzestreue Bürger in Queens zu, wie ein Mörder eine Frau in Kew Gardens belästigte und auf sie einstach." Die Frau hieß Kitty Genovese. Sie war 28 Jahre alt und starb in dieser Nacht.
Es war nicht so sehr ihr Tod, der die Leserinnen und Leser erschütterte - dafür kamen solche Verbrechen in New York zu häufig vor -, es war die Reaktion der Nachbarn. Laut dem Zeitungsbericht hatte die Frau wiederholt um Hilfe gerufen, doch hatte keiner der Bewohner, die aus den Fenstern blickten, während des Angriffs die Polizei alarmiert.
Nach den Gründen für die Passivität befragt, gab einer später an: "Ich wollte da nicht hineingezogen werden." Während die Medien die 38 Zeugen kollektiv als unbarmherzige Charakterlumpen darstellten und die Politiker den moralischen Zerfall der amerikanischen Gesellschaft beklagten, trafen sich zwei junge Psychologen in New York zu einem Abendessen. John Darley und Bibb Latané unterhielten sich fast den ganzen Abend über den Fall Kitty Genovese. "Wir betrachteten die Reaktion der Zeugen aus dem Blickwinkel der Sozialpsychologie. Nicht wie die Zeitungen, die sie als Monster abstempelten", erinnert sich Darley.
Die beiden konnten nicht glauben, dass alle Zeugen überdurchschnittlich schlechte Menschen waren. Dagegen sprach schon ihre große Zahl: 38! Als Sozialpsychologen misstrauten Darley und Latané grundsätzlich allen Erklärungen, welche die abnorme Persönlichkeit Einzelner für das Verhalten einer Gruppe verantwortlich machten. Vielmehr überlegten Darley und Latané, mit welchen ganz normalen Gruppenprozessen sich die Ereignisse jener Nacht erklären ließen. Sie stießen auf zwei Möglichkeiten:
1. Die Diffusion von Verantwortung: Je mehr andere Leute zugegen sind, desto weniger fühle ich mich in der Verantwortung zu helfen.
2. Das Definitionsproblem: Wenn die anderen nicht helfen, die vielleicht mehr wissen als ich, wird es sich wohl nicht um einen Notfall handeln.
Doch wie ließen sich diese Hypothesen prüfen? An diesem Abend begannen Darley und Latané mit der Planung dessen, was sich später als die berühmtesten Experimente ihrer Karriere erweisen sollte. John Darley ist darüber heute etwas unglücklich: "Kein Forscher ist gerne für etwas bekannt, was er vor langer Zeit vollbracht hat." Um herauszufinden, ob es den Diffusionseffekt wirklich gab, galt es eine Situation zu schaffen, in der dieser nicht vom Definitionsproblem überlagert wurde: weil die Forscher andernfalls nie herausfänden, welcher der beiden Effekte wie viel zur Passivität der Zeugen beitrug. Wie beim Mord an Kitty Genovese mussten Darley und Latané eine Notfallsituation kreieren, in der die Leute zwar wussten, dass andere Leute zugegen waren, in der sie aber deren Reaktion nicht beobachten konnten. Die Zeugen des Mordes konnten ja nicht wissen, ob einer der anderen Zeugen, die am Fenster standen, bereits etwas unternommen hatte. Die Lösung war wohl durchdacht: Wenn eine Versuchsperson ins Labor kam, fand sie einen langen Gang vor, von dem mehrere Kabinen abgingen. Der Versuchsleiter begleitete sie in eine davon, forderte sie auf, einen Kopfhörer mit Mikrofon anzulegen. Über den Kopfhörer erklärte er ihr dann, dass sie an einer Gruppendiskussion über Probleme des Studentenlebens teilnehme. Weil es vielen Leuten leichter falle, offen zu reden, wenn sie einander nicht sähen, säßen die anderen Gesprächsteilnehmer - über Kopfhörer und Mikrofon mit ihr verbunden - in Nachbarkabinen. In Wirklichkeit verhinderte die Isolation, dass sie sehen konnte, wie die anderen Gesprächsteilnehmer auf den nachfolgenden Notfall reagierten. Der Versuchsleiter erklärte nun, er selbst werde der Diskussion nicht zuhören, da sich das als gesprächshemmend erweisen könnte. Der Gesprächsverlauf werde von einem automatischen Schalter gesteuert. Alle Diskussionsteilnehmer hätten der Reihe nach zuerst zwei Minuten Zeit, um über ihre Probleme zu sprechen. Danach bekämen sie noch einmal je zwei Minuten, um das Gehörte zu kommentieren. Während einer sprach, seien die Mikrofone aller anderen ausgeschaltet. Was die Versuchsperson nicht wusste: Alle Stimmen kamen vom Band. Die erste gehörte einem jungen Mann, der von den Schwierigkeiten erzählte, sich an das Leben in New York zu gewöhnen. Er erwähnte auch, dass er epileptische Anfälle hatte, wenn er unter Stress geriet. Es folgten Gesprächspartner (vom Band) und am Schluss der Versuchsteilnehmer. In der zweiten Runde begann die erste Stimme zu stammeln: "Ich ... äh ... um ... ich glaube, ich ... ich brauche ... äh ... äh ... jemanden äh ... äh ... äh ... äh ... äh ... äh ... äh." Nach etwa 70 Sekunden war klar, dass der Student einen epileptischen Anfall hatte: "K... könnte jemand ... äh ... äh ... mir ... eh ... helfen [hustet]? Ich ... sterbe." Der Versuchsleiter stoppte die Zeit, welche die Versuchsperson vom Beginn des Gestammels an brauchte, bis sie ihre Kabine verließ, um zu helfen. Die Resultate waren erstaunlich klar: Von den Versuchspersonen, denen man gesagt hatte, sie führten ein Zweiergespräch (mit dem Opfer des epileptischen Anfalls), eilten 85 Prozent zu Hilfe - nach durchschnittlich 52 Sekunden. Wenn man die Versuchspersonen glauben ließ, es gebe einen weiteren Gesprächspartner, reagierten bloß noch 62 Prozent - nach durchschnittlich 93 Sekunden. Bei sechs Gesprächsteilnehmern schließlich kamen gerade mal 31 Prozent aus ihren Kabinen - nach über zwei Minuten. Tatsächlich scheint die Verantwortung in Notfällen umso stärker zu diffundieren, je mehr Leute zugegen sind. Die Situation ist paradox: Ein Opfer sollte nicht darauf hoffen, dass möglichst viele Leute seinen Unfall beobachten, sondern möglichst wenige - am besten nur eine einzige Person. Es war also ironischerweise ausgerechnet die große Zahl der Zeugen, die beim Mord an Kitty Genovese verhinderte, dass sie Hilfe erhielt. Hätte ihre Rufe nur ein Nachbar gehört, wäre sie vielleicht noch am Leben. Oder doch nicht? Mehr als vierzig Jahre nach dem Artikel in der New York Times stellte sich nämlich heraus, dass es der Reporter mit der Schilderung der Ereignisse nicht besonders genau genommen hatte. Der Anwalt Joseph De May, der in seiner Freizeit die Fakten einer akribischen Prüfung unterzog, kam zu dem Ergebnis, dass vieles von dem, was der Journalist geschrieben hatte, nicht stimmte: Zum Beispiel hatten die meisten der 38 Augenzeugen gar nichts gesehen, manche hatten zwar etwas gehört, dieses aber für den lautstarken Streit eines Paares gehalten. Auch konnte der Großteil des Angriffs von den Fenstern aus gar nicht beobachtet werden, weil er auf der anderen Seite des Hauses stattfand. Und überdies hatte sogar einer der Zeugen die Polizei alarmiert. Eines der bedeutendsten Experimente der Sozialpsychologie hat seinen Ursprung in einem zu dick aufgetragenen Artikel der New York Times. Das ändert allerdings nichts an den beeindruckenden Resultaten. […]Was kann man gegen diese lähmende Eigenschaft der menschlichen Natur tun? "Einem Opfer kann man nur empfehlen, eine einzelne Person aus einer Gruppe um Hilfe zu bitten, weil so die Diffusion der Verantwortung aufgebrochen wird", sagt Darley. Bei Rettungsschwimmern in den USA wird das Definitionsproblem in der Ausbildung behandelt. Ein Lebensretter darf sich nie an den Reaktionen anderer Leute orientieren, um herauszufinden, ob der Schwimmer da draußen wirklich in Schwierigkeiten ist oder nur herumplanscht. Einen Weg, die Leute zum Eingreifen zu bewegen, haben Sie eben selbst beschritten, indem Sie diesen Abschnitt lasen: Versuchspersonen, die das Experiment von Darley und Latané kannten, halfen in einem Notfall fast doppelt so häufig wie die anderen. (vgl. Spiegel online . 4. Teil Psychologie: Warum hilft niemand? 10.06.2006. Von http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/verrueckte-experimente-wenn-forscher-crash-test-dummy-spielen-a-627702-4.html)
[...]
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Bystander-Effekt?
Der Bystander-Effekt beschreibt das Phänomen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person in einer Notsituation hilft, sinkt, je mehr andere Personen anwesend sind.
Was bedeutet Verantwortungsdiffusion?
Verantwortungsdiffusion tritt auf, wenn Einzelne in einer Gruppe die Verantwortung für das Handeln (oder Nichthandeln) auf die anderen Gruppenmitglieder abschieben.
Wer war Kitty Genovese?
Kitty Genovese war ein Mordopfer (1964), bei dessen Angriff laut Medienberichten zahlreiche Zeugen zusahen oder zuhörten, ohne einzugreifen, was die Forschung zum Bystander-Effekt auslöste.
Was versteht man unter pluralistischer Ignoranz?
Es ist eine Situation, in der Zeugen eine Notlage nicht als solche interpretieren, weil niemand anderes Anzeichen von Panik zeigt oder eingreift.
Kann man prosoziales Verhalten fördern?
Ja, Wissen über diese psychologischen Effekte kann Menschen helfen, in Notsituationen bewusst einzugreifen und die Verantwortungsdiffusion zu durchbrechen.
- Quote paper
- Isabell Nolte (Author), 2017, Warum hilft niemand? Der Bystander-Effekt - Unterrichtsentwurf zum Thema prosoziales Verhalten und Altruismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/516826