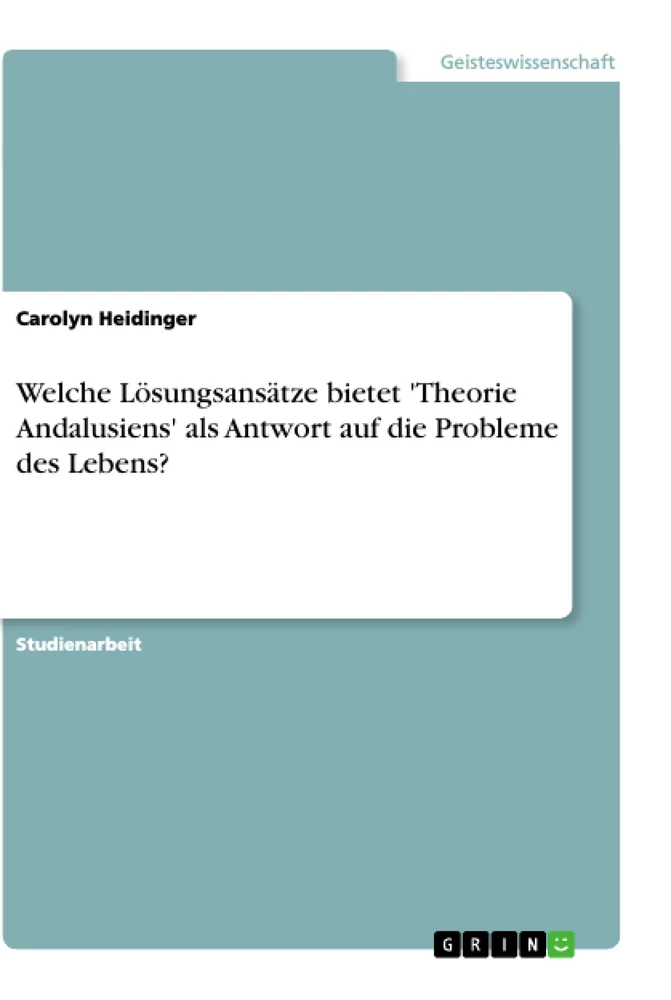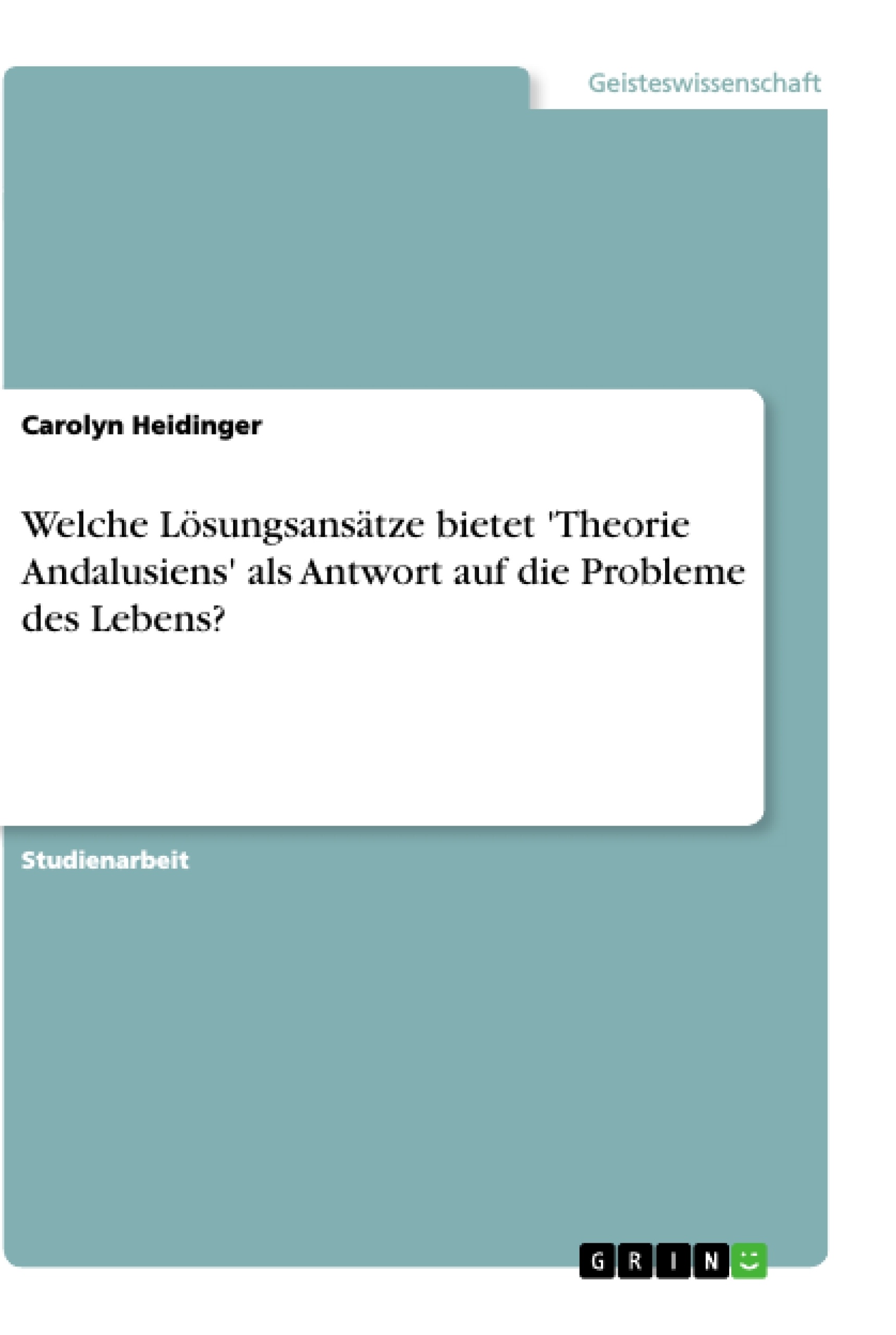Ein sonniger Fleck Erde ganz im Süden Spaniens, welcher milde Winter und heiße Sommer verspricht, dazu noch eine vielfältige Kultur zu bieten hat: Andalusien. Die andalusische Kultur ist unter anderem von den Griechen, den Römern, den Arabern, aber wohl am meisten von der Zeit geprägt. Denn "die Andalusier sind vielleicht das älteste Mittelmeervolk, älter als Griechen und Römer". Wodurch zeichnet sich die andalusische Kultur aus?
Unter anderem dieser Frage nahm sich bereits Jose Ortega y Gasset (1883 – 1955) an und verfasste die ‚Theorie Andalusiens‘ (1927). Auch ein Vergleich zu anderen Kulturen ist in Ortegas Werk zu finden, denn Ortega vergleicht die andalusische Kultur mit der chinesischen und der kastilischen. Auf diese beiden Aspekte gehe ich also im Folgenden ein. Zusätzlich beschäftige ich mich mit den Problemen des Lebens, denn auf manche dieser Fragen vermag die andalusische Kultur zu antworten. Um dies möglichst anschaulich darzustellen und um den Sinn der spanischen Philosophie verständlich zu machen, nehme ich einen Vergleich zu Arnold Gehlens ‚Über kulturelle Kristallisation‘ vor.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Tier
- Spezialisierter Organbau und Umwelt
- Der Bannkreis der Unmittelbarkeit
- Tierische Leistungen und Leistungsgrenzen
- Jakob Johann Baron von Uexküll
- Umwelt und Innenwelt der Tiere
- Wirkwelt und Merkwelt
- Beispiele wirbelloser Tiere
- Kritik an Uexküll
- Der Mensch
- Der Mensch als handelndes Wesen
- Die physisch-morphologische Sonderstellung des Menschen
- Das Mängelwesen
- Weltoffenheit
- Kultur als zweite Natur
- Symbolische Wahrnehmung
- Lebenswelt des Menschen
- Bewegungsskala
- Ein Vergleich zwischen Menschen und Tieren
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das vorliegende Werk befasst sich mit der Frage, was den Menschen vom Tier unterscheidet. Der Autor untersucht, wie Tiere in ihre Umwelt eingebunden sind, während der Mensch als "weltoffenes" Wesen keine natürliche Anpassung an eine bestimmte Umwelt besitzt und somit eine Kultur als Lebenswelt schafft.
- Das Tier und seine Anpassung an die Umwelt
- Der Mensch als Mängelwesen und seine Weltoffenheit
- Die Entstehung der Kultur als zweite Natur
- Die Bedeutung der symbolischen Wahrnehmung für den Menschen
- Der Vergleich zwischen dem Tier in der Umwelt und dem Menschen in der Kultur
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt die Grundthese des Werkes ein: Der Mensch ist ein weltoffenes Wesen, im Gegensatz zum Tier, das an seine Umwelt gebunden ist. Der Autor stellt die zentralen Fragen des Werkes vor, die sich mit den Unterschieden zwischen Mensch und Tier, sowie mit der Entstehung der Kultur als Lebenswelt des Menschen beschäftigen.
Das Tier
Dieses Kapitel behandelt die spezifischen Eigenschaften des Tieres, die es an seine Umwelt binden. Es wird auf den spezialisierten Organbau, die Instinkte und die Anpassung an bestimmte Situationen eingegangen. Der Autor verweist auf die Arbeiten von Arnold Gehlen und Jakob Johann Baron von Uexküll, die sich mit den Zusammenhängen zwischen Umwelt, Organausstattung und Verhalten von Tieren auseinandersetzen.
Der Mensch
Dieses Kapitel widmet sich der besonderen Situation des Menschen als weltoffenes Wesen. Es wird deutlich, dass der Mensch aufgrund seiner fehlenden Spezialisierung als Mängelwesen bezeichnet werden kann. Der Autor erklärt, wie der Mensch durch seine Fähigkeiten zur Handlung, Intelligenz und Vernunft die Nachteile seiner Unspezialisiertheit kompensiert und eine Kultur als seine Lebenswelt entwickelt.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter des Werkes sind: Weltoffenheit, Mängelwesen, Kultur, Umwelt, Tier, Mensch, Spezialisierung, Instinkt, zweite Natur, symbolische Wahrnehmung. Das Werk befasst sich mit der Frage, wie sich der Mensch als ein "weltoffenes" Wesen von den an ihre Umwelt angepassten Tieren unterscheidet und wie er durch die Entwicklung von Kultur eine eigene Lebenswelt schafft.
Häufig gestellte Fragen
Was unterscheidet den Menschen laut Arnold Gehlen vom Tier?
Gehlen bezeichnet den Menschen als "Mängelwesen", da er im Gegensatz zum Tier keine spezialisierten Organe oder Instinkte für eine bestimmte Umwelt besitzt.
Was bedeutet "Weltoffenheit"?
Weltoffenheit bedeutet, dass der Mensch nicht an eine spezifische ökologische Nische gebunden ist, sondern fähig ist, sich in fast jeder Umgebung durch Kultur eine Lebenswelt zu schaffen.
Warum wird Kultur als "zweite Natur" bezeichnet?
Weil der Mensch seine physischen Mängel durch technische und soziale Errungenschaften (Kultur) kompensiert, die für ihn lebensnotwendig wie eine natürliche Umgebung sind.
Wer war Jakob Johann Baron von Uexküll?
Ein Biologe, der das Konzept der "Umwelt" entwickelte, wonach jedes Tier in einem spezifischen Ausschnitt der Welt lebt, der durch seine Sinnesorgane (Merkwelt) und Handlungsmöglichkeiten (Wirkwelt) definiert ist.
Welche Rolle spielt die symbolische Wahrnehmung?
Sie ermöglicht dem Menschen, über die unmittelbare Reiz-Reaktions-Kette hinaus zu denken, Sinnzusammenhänge zu stiften und komplexe soziale Systeme aufzubauen.
- Citation du texte
- Carolyn Heidinger (Auteur), 2019, Welche Lösungsansätze bietet 'Theorie Andalusiens' als Antwort auf die Probleme des Lebens?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/517318