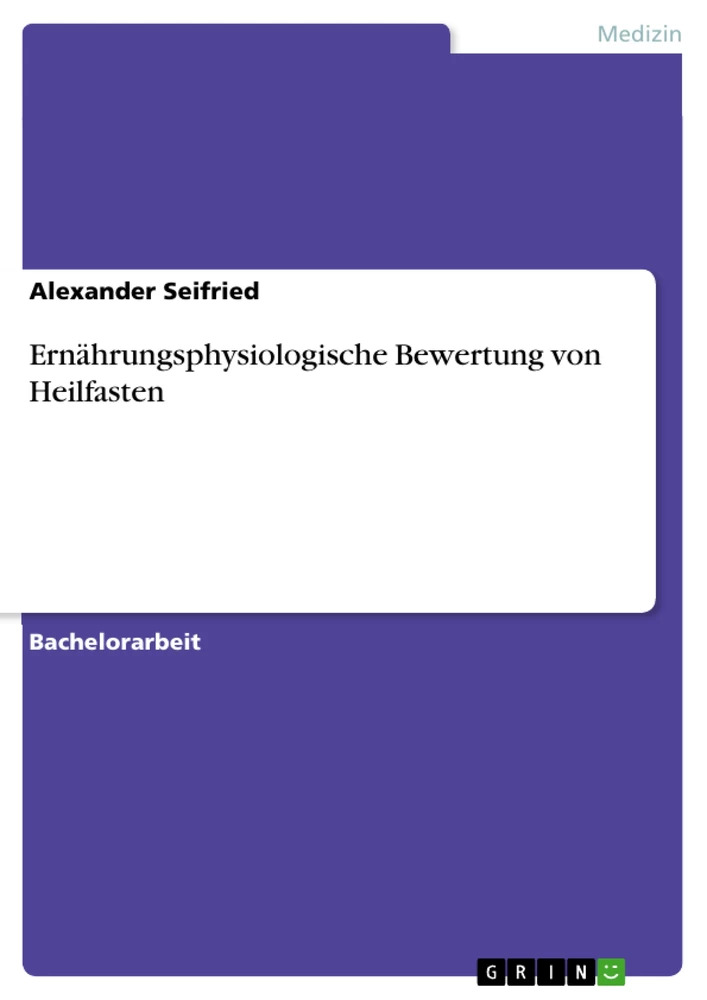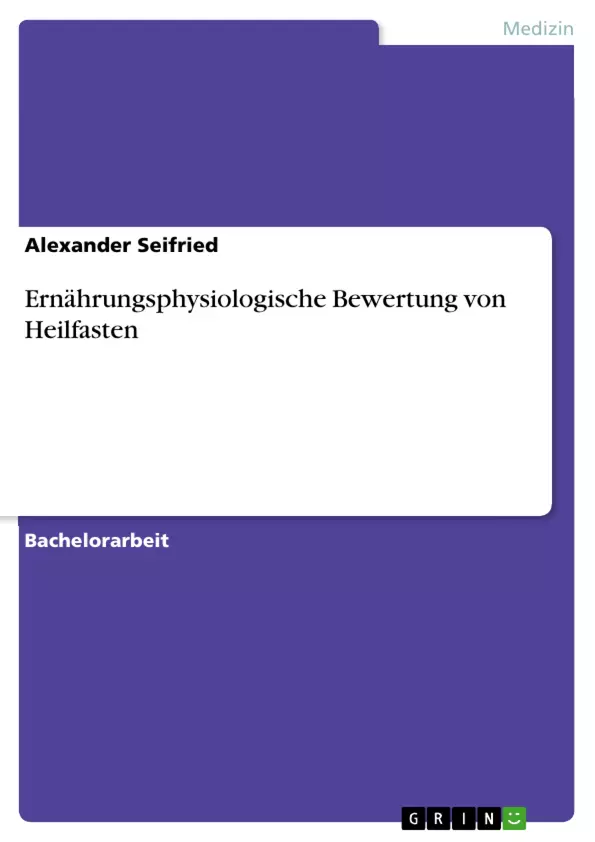Das Fasten hat eine jahrtausendealte Geschichte und findet schon in Schriften des griechischen Arztes Hippokrates von Kos Erwähnung. Dieser empfahl kleine körperliche Leiden durch Fasten zu kurieren. Seitdem entwickeln sich bis heute verschiedenste Praktiken der Nahrungsrestriktion mit unterschiedlichen Herangehensweisen und Beweggründen.
Neben dem Fasten aus gesundheitlichen Gründen ist hier vor allem das religiös motivierte Fasten, wie die christliche Fastenzeit oder der muslimische Fastenmonat Ramadan, zu nennen. Historisch bedingt war ursprünglich keine klare Trennung zwischen den beiden genannten Motivationen möglich. Das medizinische Fasten rückte bis zu Publikationen von naturheilkundlich geprägten Ärzten im 19. Jahrhundert in den Hintergrund.
In den 50er- und 60er Jahren des 20. Jahrhunderts wurde das therapeutische Fasten besonders für die Therapie der Adipositas geschätzt.
Das Heilfasten ist eine alternativmedizinische, multidisziplinäre Praktik. Diese geht auf den deutschen Arzt Otto Buchinger (1878-1966) zurück.
Heilfasten wird in erster Linie stationär und unter Aufsicht durchgeführt. In seinen Ausführungen schildert Buchinger unter anderem, wie er allein durch das Fasten multiple Beschwerden gelindert habe.
Die physischen Aspekte werden durch psychosoziale und spirituelle Elemente ergänzt.
Fastenbefürworter suggerieren, dass eine phasenweise durchgeführte Energierestriktion evolutionär gesehen die Normalität darstellt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hintergrund des Fastens in Deutschland
- Definition des Heilfastens nach Buchinger und Begriffsabgrenzungen
- Mechanismen des Hungerstoffwechsels
- Das Risiko des Eiweißkatabolismus und der Erhalt der Leistungsfähigkeit
- Wissenschaftliche Bewertung des Heilfastens bei ausgewählten Indikationen laut ÄGHE
- Adipositas
- Diabetes Mellitus Typ 2
- Diabetes Mellitus Typ 1
- Hypertonie
- Hyperlipidämie
- Rheumatoide Arthritis
- Entschlackung
- Fasten für Gesunde
- Weitere mögliche Anwendungsbereiche des Heilfastens
- Auswirkungen einer Kalorienrestriktion auf Alterungsprozesse
- Effekte des Fastens in der Therapie der Epilepsie
- Kontraindikationen gegen das Heilfasten und mögliche Risiken
- Zusammenfassung
- Fazit
- Abstract
- Danksagung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende wissenschaftliche Arbeit setzt sich zum Ziel, das Heilfasten nach Buchinger aus ernährungsphysiologischer Perspektive zu beleuchten und seine Anwendung bei verschiedenen Indikationen zu bewerten.
- Historische und aktuelle Bedeutung des Fastens
- Physiologische Mechanismen des Hungerstoffwechsels
- Anwendung des Heilfastens bei verschiedenen Krankheitsbildern
- Kontraindikationen und Risiken des Heilfastens
- Wissenschaftliche Evidenz für die Wirksamkeit des Heilfastens
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Die Einleitung gibt eine Einführung in das Thema Fasten und seine lange Geschichte. Es wird die unterschiedliche Motivation für das Fasten, sowohl medizinisch als auch religiös, beleuchtet.
- Kapitel 2: In diesem Kapitel wird der Hintergrund des Fastens in Deutschland untersucht, mit einem Fokus auf die Bedeutung der Fastenzeit.
- Kapitel 3: Die Definition des Heilfastens nach Buchinger wird vorgestellt und abgegrenzt. Es werden die spezifischen Prinzipien und Praktiken des Heilfastens erläutert.
- Kapitel 4: Die Mechanismen des Hungerstoffwechsels werden erklärt, einschließlich der Auswirkungen auf den Proteinabbau und die Leistungsfähigkeit.
- Kapitel 5: Dieses Kapitel beleuchtet die wissenschaftliche Bewertung des Heilfastens bei verschiedenen Indikationen, basierend auf den Empfehlungen der ÄGHE. Es werden die Auswirkungen des Heilfastens auf Adipositas, Diabetes Mellitus Typ 2 und 1, Hypertonie, Hyperlipidämie, Rheumatoide Arthritis, Entschlackung und gesunde Personen betrachtet.
- Kapitel 6: Es werden weitere mögliche Anwendungsgebiete des Heilfastens diskutiert, wie z. B. die Auswirkungen auf Alterungsprozesse und die Therapie der Epilepsie.
- Kapitel 7: In diesem Kapitel werden die Kontraindikationen gegen das Heilfasten und die möglichen Risiken ausführlich erläutert.
Schlüsselwörter
Heilfasten, Buchinger, Hungerstoffwechsel, Adipositas, Diabetes Mellitus, Hypertonie, Hyperlipidämie, Rheumatoide Arthritis, Entschlackung, Alterungsprozesse, Epilepsie, Kontraindikationen, Risiken, wissenschaftliche Evidenz, ÄGHE.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Heilfasten nach Buchinger?
Das Heilfasten nach Buchinger ist eine alternativmedizinische Methode, die auf den deutschen Arzt Otto Buchinger zurückgeht. Es handelt sich um eine multidisziplinäre Praktik, die neben physischer Nahrungsrestriktion auch psychosoziale und spirituelle Elemente einbezieht und meist stationär unter Aufsicht durchgeführt wird.
Bei welchen Krankheitsbildern wird Heilfasten wissenschaftlich bewertet?
Die wissenschaftliche Bewertung (u.a. durch die ÄGHE) umfasst Indikationen wie Adipositas, Diabetes Mellitus Typ 2, Hypertonie (Bluthochdruck), Hyperlipidämie und Rheumatoide Arthritis.
Was versteht man unter dem Hungerstoffwechsel?
Der Hungerstoffwechsel beschreibt die physiologischen Anpassungen des Körpers an eine fehlende Energiezufuhr. Ein zentraler Aspekt in der Forschung ist dabei das Risiko des Eiweißkatabolismus (Muskelabbau) und der Erhalt der körperlichen Leistungsfähigkeit während des Fastens.
Gibt es Kontraindikationen gegen das Heilfasten?
Ja, es gibt medizinische Gründe, bei denen vom Fasten dringend abgeraten wird. Die Arbeit erläutert diese Kontraindikationen und potenziellen Risiken ausführlich, da Fasten einen massiven Eingriff in den Stoffwechsel darstellt.
Was ist das Ziel der ernährungsphysiologischen Bewertung des Heilfastens?
Das Ziel ist es, die Wirksamkeit und Sicherheit des Fastens aus wissenschaftlicher Sicht zu beleuchten, die Evidenz für verschiedene Krankheiten zu prüfen und die physiologischen Abläufe im Körper zu erklären.
Welche Rolle spielt die ÄGHE beim Heilfasten?
Die Ärztegesellschaft Heilfasten und Ernährung (ÄGHE) liefert die Leitlinien und wissenschaftlichen Bewertungen, auf denen die medizinische Einordnung des Heilfastens bei verschiedenen Indikationen basiert.
- Arbeit zitieren
- Alexander Seifried (Autor:in), 2016, Ernährungsphysiologische Bewertung von Heilfasten, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/520392