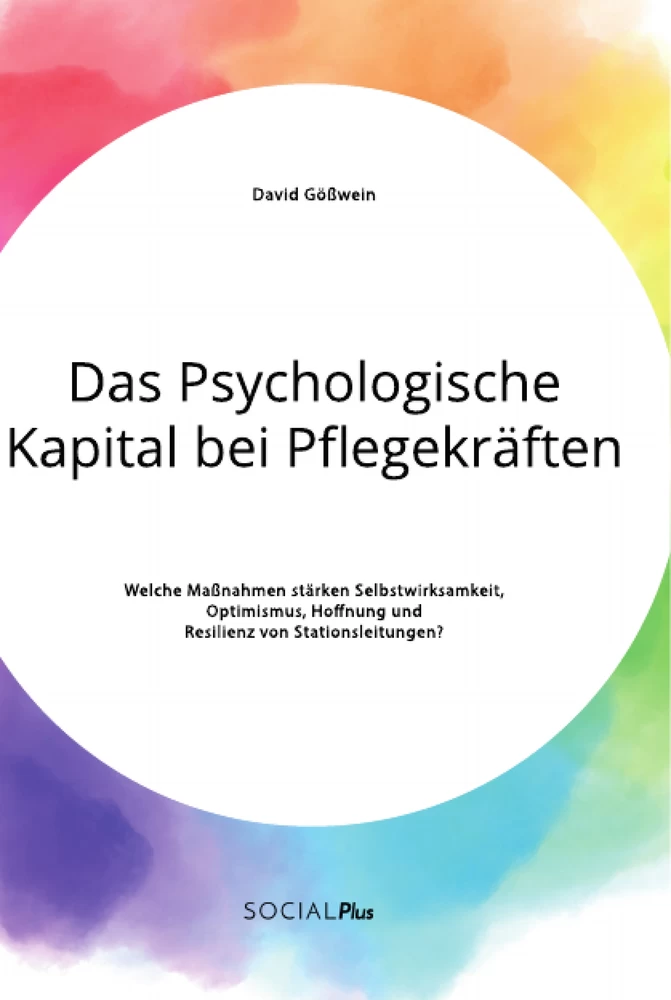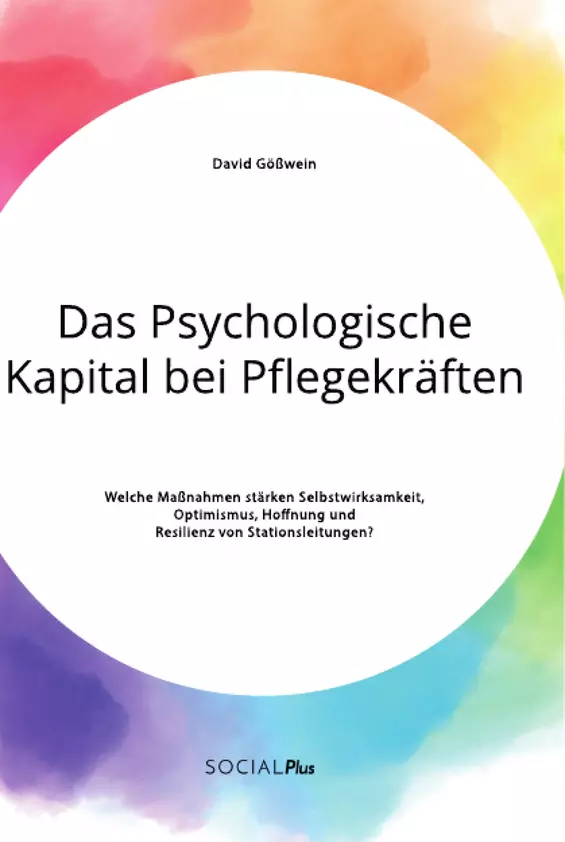Gesellschaftliche Faktoren wie der demographische Wandel oder auch die aktuelle Covid-19-Krise belasten das deutsche Gesundheitssystem. Immer deutlicher wird, wie wichtig ein funktionierendes System für unsere Gesellschaft ist. Die neuen Herausforderungen machen aber auch eine stetige Weiterentwicklung notwendig. Eine zentrale Rolle spielen dabei die Stationsleitungen.
Wie zufrieden sind Stationsleitungen in deutschen Krankenhäusern? Und wie steht es um ihre Arbeitsleistung? Gibt es Unterschiede zwischen den Geschlechtern? David Gößwein klärt diese Fragen mithilfe der Theorie des Psychologischen Kapitals.
Das Psychologische Kapital beschreibt, wie die Ressourcen Selbstwirksamkeit, Optimismus, Hoffnung und Resilienz in einer Person ausgeprägt sind. Alle vier Dimensionen tragen zu einer positiven Gemütslage bei und haben so Einfluss auf die persönliche Leistungsfähigkeit. Gößwein zeigt in seiner Publikation, wie es um das Psychologische Kapital in der Pflege bestellt ist und welche Maßnahmen dies positiv beeinflussen.
Aus dem Inhalt:
- Mitarbeiterzufriedenheit;
- Motivation;
- Mitarbeiterbindung;
- Pflege;
- Pflegemanagement
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Status Quo und Wandel im Krankenhaussektor
- Pflegepersonal im Krankenhaus
- (Pflege-)Management im Krankenhaus
- Schlüsselposition Stationsleitung
- Struktur, Zielsetzung und Forschungsfragen
- Theoretischer Hintergrund
- Psychologisches Kapital - Begriffsexplikation
- Kapitalformen im Überblick
- Psychologisches Kapital - Definition
- PsyCap als Forschungsgegenstand der Positiven Psychologie
- Positive Psychologie in der Arbeit: POS und POB
- Das Prinzip der Veränderbarkeit
- Die vier PsyCap-Dimensionen
- PsyCap als sekundäres Konstrukt
- Stand der Forschung / Externe Evidenz
- Methodisches Vorgehen
- Ergebnisse: PsyCap im Arbeitskontext
- Ergebnisse: PsyCap im Setting Pflege
- Limitationen, Diskussion und Fazit
- Empirie
- Methodik
- Ergebnisse
- Limitationen, Diskussion und Fazit
- Stärkung des Psychologischen Kapitals
- Antezedenzien als Anknüpfungspunkte
- Mikrointerventionen
- Strukturelle Interventionen
- Projektplanung
- Limitationen, Diskussion und Fazit
- Diskussion
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem psychologischen Kapital (PsyCap) von Pflegekräften und untersucht, welche Maßnahmen die Selbstwirksamkeit, den Optimismus, die Hoffnung und die Resilienz von Stationsleitungen stärken können. Sie beleuchtet den Status Quo und den Wandel im Krankenhaussektor, die Rolle des Pflegepersonals und das Management im Krankenhaus, sowie die Schlüsselposition der Stationsleitung. Die Arbeit greift auf den theoretischen Hintergrund des psychologischen Kapitals und seine vier Dimensionen zurück, betrachtet die Bedeutung der positiven Psychologie und analysiert den aktuellen Forschungsstand.
- Psychologisches Kapital von Pflegekräften
- Stärkung der Selbstwirksamkeit, des Optimismus, der Hoffnung und der Resilienz von Stationsleitungen
- Analyse des Status Quo und des Wandels im Krankenhaussektor
- Bedeutung der positiven Psychologie im Arbeitskontext
- Entwicklung von Maßnahmen zur Stärkung des psychologischen Kapitals
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über den Status Quo und den Wandel im Krankenhaussektor, beleuchtet die Rolle des Pflegepersonals und das Management im Krankenhaus und stellt die Schlüsselposition der Stationsleitung dar.
- Struktur, Zielsetzung und Forschungsfragen: In diesem Kapitel wird die Struktur der Arbeit, die Zielsetzung und die Forschungsfragen dargelegt.
- Theoretischer Hintergrund: Dieses Kapitel befasst sich mit dem theoretischen Hintergrund des psychologischen Kapitals, seiner Definition, seinen Kapitalformen und seinen vier Dimensionen. Außerdem werden die Bedeutung der positiven Psychologie und das Prinzip der Veränderbarkeit erläutert.
- Stand der Forschung / Externe Evidenz: Dieses Kapitel analysiert den aktuellen Forschungsstand zum psychologischen Kapital im Arbeitskontext und im Setting Pflege. Es werden methodische Vorgehensweisen, Ergebnisse und Limitationen diskutiert.
- Empirie: Dieses Kapitel präsentiert die Methodik der eigenen empirischen Untersuchung und stellt die Ergebnisse dar. Es werden außerdem Limitationen, Diskussion und Fazit der Untersuchung beleuchtet.
- Stärkung des Psychologischen Kapitals: Dieses Kapitel geht auf Antezedenzien des psychologischen Kapitals ein und stellt Mikrointerventionen, strukturelle Interventionen und Projektplanung zur Stärkung des psychologischen Kapitals vor.
Schlüsselwörter
Psychologisches Kapital, Pflegekräfte, Stationsleitung, Krankenhaus, Selbstwirksamkeit, Optimismus, Hoffnung, Resilienz, Positive Psychologie, POS, POB, Interventionen, Mikrointerventionen, Strukturelle Interventionen, Projektplanung, Management
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Psychologisches Kapital (PsyCap)?
Das Psychologische Kapital umfasst die vier Dimensionen Selbstwirksamkeit, Optimismus, Hoffnung und Resilienz, die zusammen die persönliche Leistungsfähigkeit und positive Einstellung stärken.
Warum ist PsyCap für Stationsleitungen in Krankenhäusern wichtig?
Stationsleitungen besetzen eine Schlüsselposition. Ein hohes psychologisches Kapital hilft ihnen, den Herausforderungen des demographischen Wandels und Krisen wie Covid-19 besser zu begegnen.
Wie hängen Mitarbeiterzufriedenheit und PsyCap zusammen?
Ein hohes psychologisches Kapital wirkt sich positiv auf die Gemütslage aus, was wiederum die Motivation, die Arbeitsleistung und die langfristige Mitarbeiterbindung in der Pflege steigert.
Welche Maßnahmen stärken die Resilienz in der Pflege?
Zur Stärkung der Resilienz und anderer PsyCap-Dimensionen können Mikrointerventionen und strukturelle Veränderungen im Pflegemanagement eingesetzt werden.
Ist das psychologische Kapital veränderbar?
Ja, ein zentrales Prinzip der Theorie ist die Veränderbarkeit. Durch gezielte Interventionen und Training können die psychologischen Ressourcen einer Person aktiv entwickelt werden.
- Quote paper
- David Gößwein (Author), 2020, Das Psychologische Kapital bei Pflegekräften. Welche Maßnahmen stärken Selbstwirksamkeit, Optimismus, Hoffnung und Resilienz von Stationsleitungen?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/520585