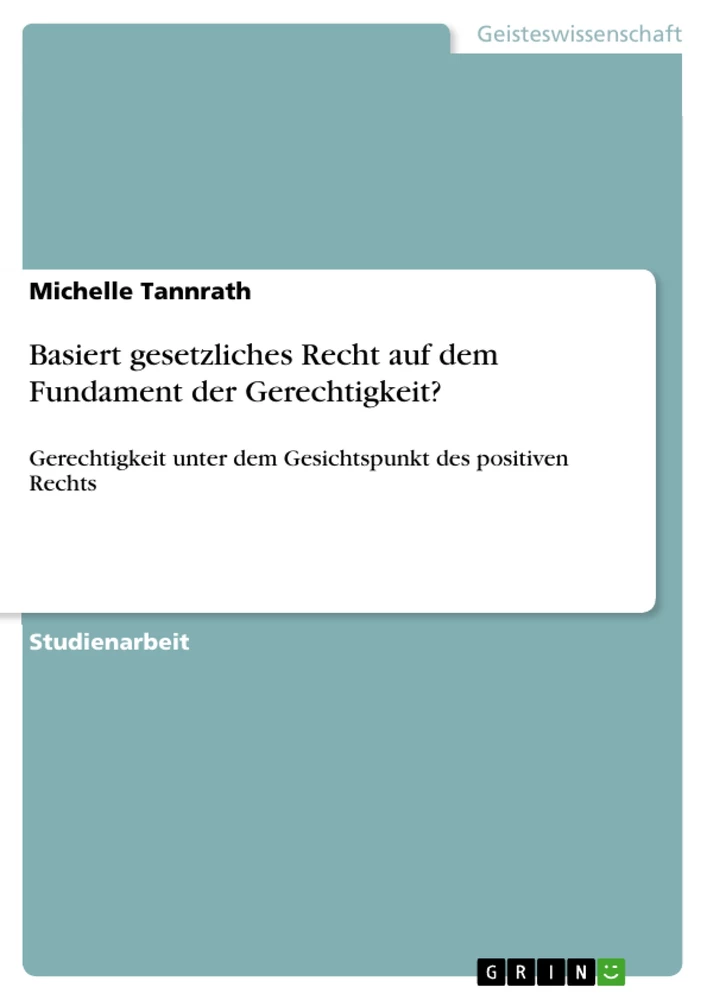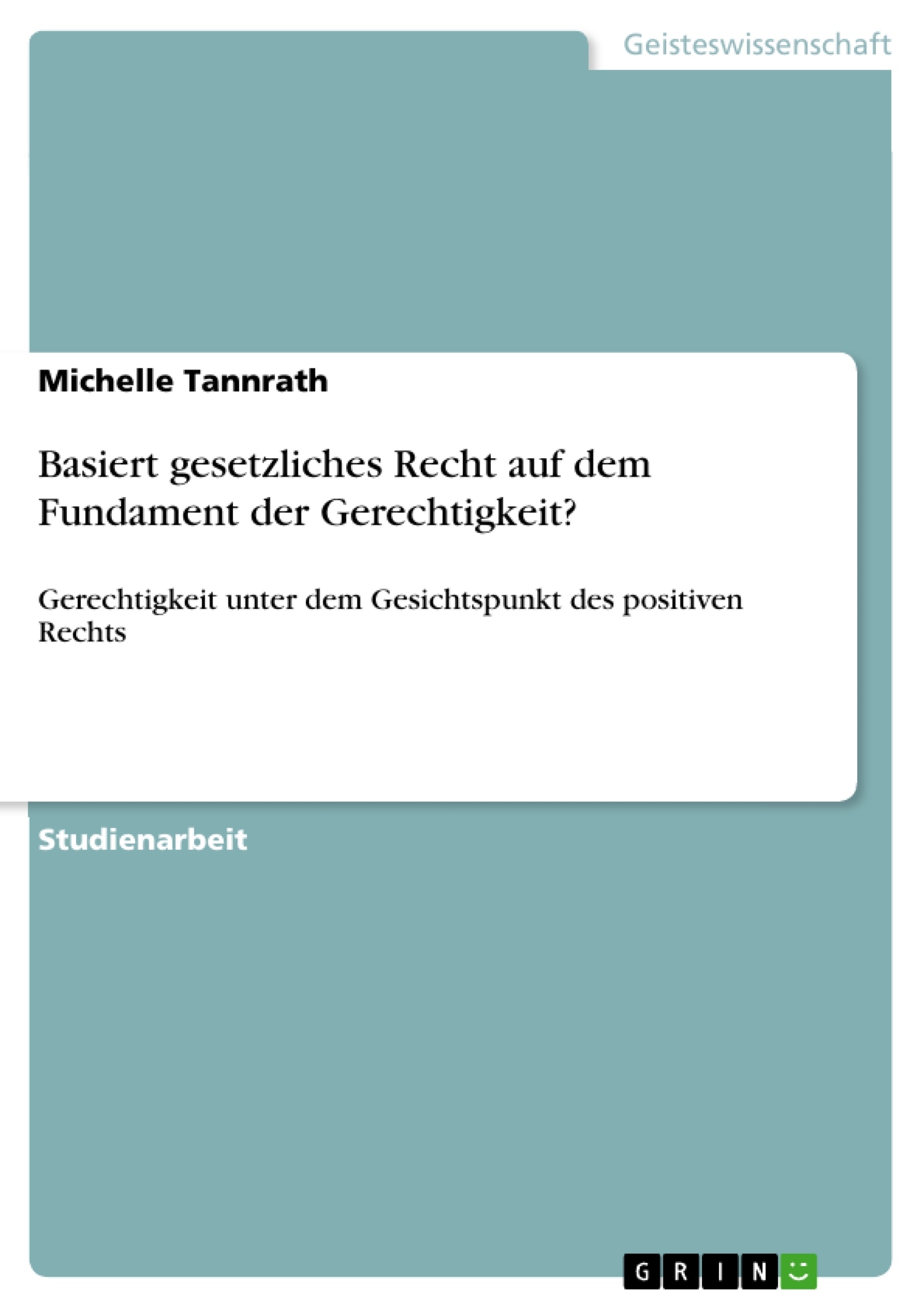Diese Arbeit greift den Themenkomplex der juristischen Gerechtigkeit auf und geht der Frage nach, ob gesetzliches Recht tatsächlich auf dem Fundament der Gerechtigkeit basiert. Hierfür muss die Konstituierung positiven Rechts genauer untersucht und im Hinblick auf moralische Aspekte hinterfragt werden. Beleuchtet wird die Fragestellung sowohl aus einem kontraktualistischen als auch aus einem relativistischen Blickwinkel. Letztlich wird beabsichtigt, die Frage nach einer Moralpflicht gegenüber dem gesetzlichen Recht zu stellen und Recht und Moral somit in ein Verhältnis zueinander zu setzen.
Das Adjektiv „positiv“ stammt von dem lateinischen Verb „ponere“ ab, was so viel wie „setzen“ heißt. Das dazugehörige Partizip „gesetzt“ ist auf „positum“ zurückzuführen. Das positive Recht ist also als ein gesetztes Recht zu verstehen. Verkörpert wird es durch die vom Menschen niedergeschriebenen Gesetze, welche für die Regulierung menschlichen Zusammenlebens verantwortlich sind. Legitimität erlangen die positiven Rechte allein durch den Akt ihres Beschlusses. Damit sind sie für alle im Staat lebenden Bürgerinnen und Bürger verbindlich und ihre Nichteinhaltung sanktionierbar. Diese Geltungsart des gesetzten Rechts repräsentiert demnach nicht die einzig wahre Gerechtigkeit, sondern bloß vom Menschen festgelegte Rechte. Aus der individuellen Satzung des Rechts resultiert also, dass das positive Recht verschiedene Gestalten annehmen kann. So unterscheiden sich beispielsweise vorgeschriebene Gesetze von Land zu Land.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das positive Recht
- Was ist das positive Recht?
- Das Naturrecht
- Als Gegenspieler des positiven Rechts
- Als Basis des positiven Rechts
- Begründungen des positiven Rechts
- Kontraktualistisch nach Thomas Hobbes
- Relativistisch nach Gustav Radbruch
- Im Vergleich
- „Unrechtsstaat“ am Beispiel des Nationalsozialismus
- Einordnung der NS-Herrschaft
- Kontraktualistisch nach Thomas Hobbes
- Relativistisch nach Gustav Radbruch
- Die Rolle des Richters
- Die Schuld / Unschuld der NS-Verbrecher
- Rechtliche Lehren aus der NS-Zeit
- Einordnung der NS-Herrschaft
- Das Verhältnis von Recht und Moral
- Die Verschiedenheit von Recht und Moral
- Das Spannungsverhältnis von Recht und Moral
- Das Recht verhindert Moral
- Das Recht fördert Moral
- Die Unabhängigkeit von Recht und Moral
- Moralpflicht?
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese schriftliche Arbeit widmet sich dem Thema der juristischen Gerechtigkeit und untersucht, ob positives Recht tatsächlich auf Gerechtigkeit basiert. Sie analysiert die Konstituierung des positiven Rechts unter Berücksichtigung moralischer Aspekte.
- Definition und Abgrenzung des positiven Rechts im Verhältnis zum Naturrecht
- Analyse von Begründungsmodellen für das positive Recht nach Thomas Hobbes und Gustav Radbruch
- Bewertung des "Unrechtsstaates" des Nationalsozialismus aus kontraktualistischer und relativistischer Perspektive
- Untersuchung des Spannungsverhältnisses zwischen Recht und Moral, insbesondere im Kontext des Nationalsozialismus
- Diskussion der Frage, ob eine Moralpflicht gegenüber dem gesetzlichen Recht besteht
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Fragestellung der Arbeit ein und erläutert die zentrale These, dass gesetzliches Recht nicht unbedingt auf Gerechtigkeit beruht. Sie definiert das positive Recht und das Naturrecht und beleuchtet deren komplexes Verhältnis. Die Arbeit setzt sich zum Ziel, die Begründungsweisen des positiven Rechts nach Thomas Hobbes und Gustav Radbruch zu analysieren, um deren Gerechtigkeitspotenzial zu bewerten.
Im zweiten Kapitel wird das positive Recht definiert und dessen Abgrenzung zum Naturrecht dargestellt. Die Rolle des Naturrechts als Gegenspieler und Basis des positiven Rechts wird untersucht. Anschließend werden die Begründungsweisen des positiven Rechts nach Thomas Hobbes und Gustav Radbruch vorgestellt.
Kapitel drei beleuchtet das Beispiel des "Unrechtsstaates" Nationalsozialismus. Es analysiert die Einordnung der NS-Herrschaft aus kontraktualistischer und relativistischer Sicht, betrachtet die Rolle des Richters und die Frage der Schuld der NS-Verbrecher, sowie die rechtlichen Lehren aus der NS-Zeit.
Das vierte Kapitel widmet sich dem Verhältnis von Recht und Moral. Es beschreibt die Verschiedenheit von Recht und Moral und untersucht deren Spannungsverhältnis, insbesondere in Bezug auf die Frage, ob Recht Moral verhindert oder fördert. Zudem wird die Unabhängigkeit von Recht und Moral diskutiert und die Frage einer Moralpflicht gegenüber dem gesetzlichen Recht gestellt.
Schlüsselwörter
Positives Recht, Naturrecht, Gerechtigkeit, Thomas Hobbes, Gustav Radbruch, Nationalsozialismus, "Unrechtsstaat", Recht und Moral, Moralpflicht, juristische Strafbarkeit, rechtliche Lehren.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen positivem Recht und Naturrecht?
Positives Recht ist vom Menschen „gesetztes“ Recht (Gesetze), während Naturrecht als übergeordnete, universelle Gerechtigkeit gilt, die unabhängig von menschlicher Satzung existiert.
Wie begründet Thomas Hobbes das positive Recht?
Hobbes vertritt einen kontraktualistischen Ansatz: Menschen schließen einen Vertrag zur Friedenssicherung, wodurch das gesetzte Recht des Souveräns absolute Verbindlichkeit erlangt.
Was besagt die Radbruchsche Formel?
Gustav Radbruch argumentiert, dass positives Recht dann der Gerechtigkeit weichen muss, wenn der Widerspruch des Gesetzes zur Gerechtigkeit ein „unerträgliches Maß“ erreicht (z. B. im NS-Unrechtsstaat).
Kann ein Staat ein „Unrechtsstaat“ sein, obwohl er Gesetze hat?
Ja, die Arbeit zeigt am Beispiel des Nationalsozialismus, dass formales Recht zur Begehung von Verbrechen genutzt werden kann, was die Frage nach der Moralpflicht gegenüber dem Recht aufwirft.
Besteht eine moralische Pflicht, jedem Gesetz zu gehorchen?
Die Arbeit diskutiert das Spannungsverhältnis zwischen Recht und Moral und hinterfragt, ob die Legalität eines Gesetzes automatisch dessen moralische Legitimität begründet.
- Citation du texte
- Michelle Tannrath (Auteur), 2018, Basiert gesetzliches Recht auf dem Fundament der Gerechtigkeit?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/520612