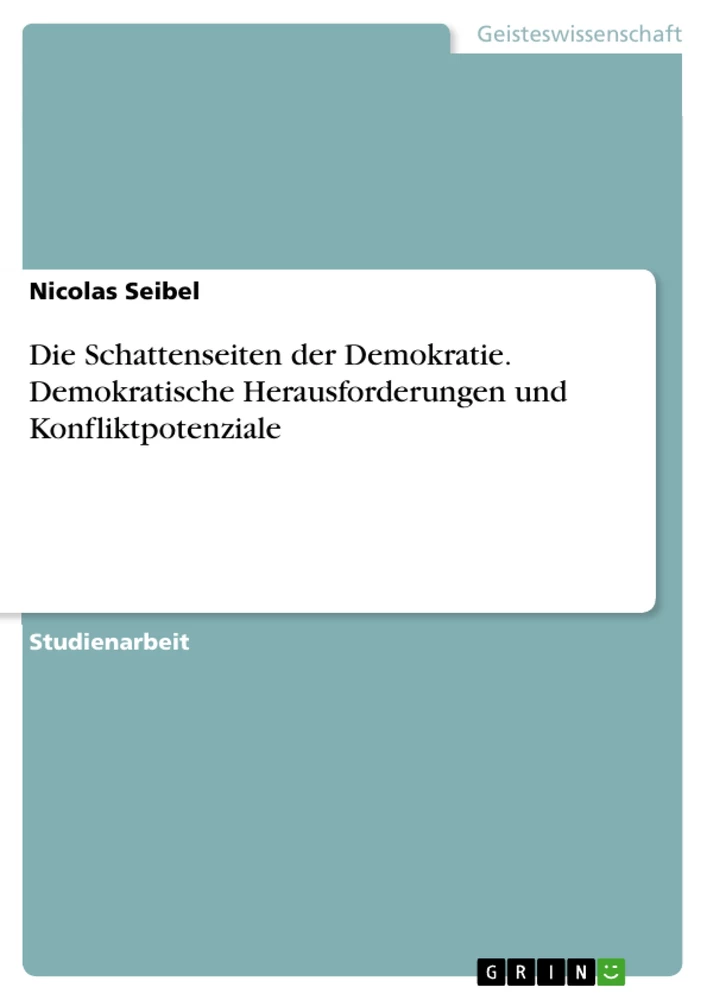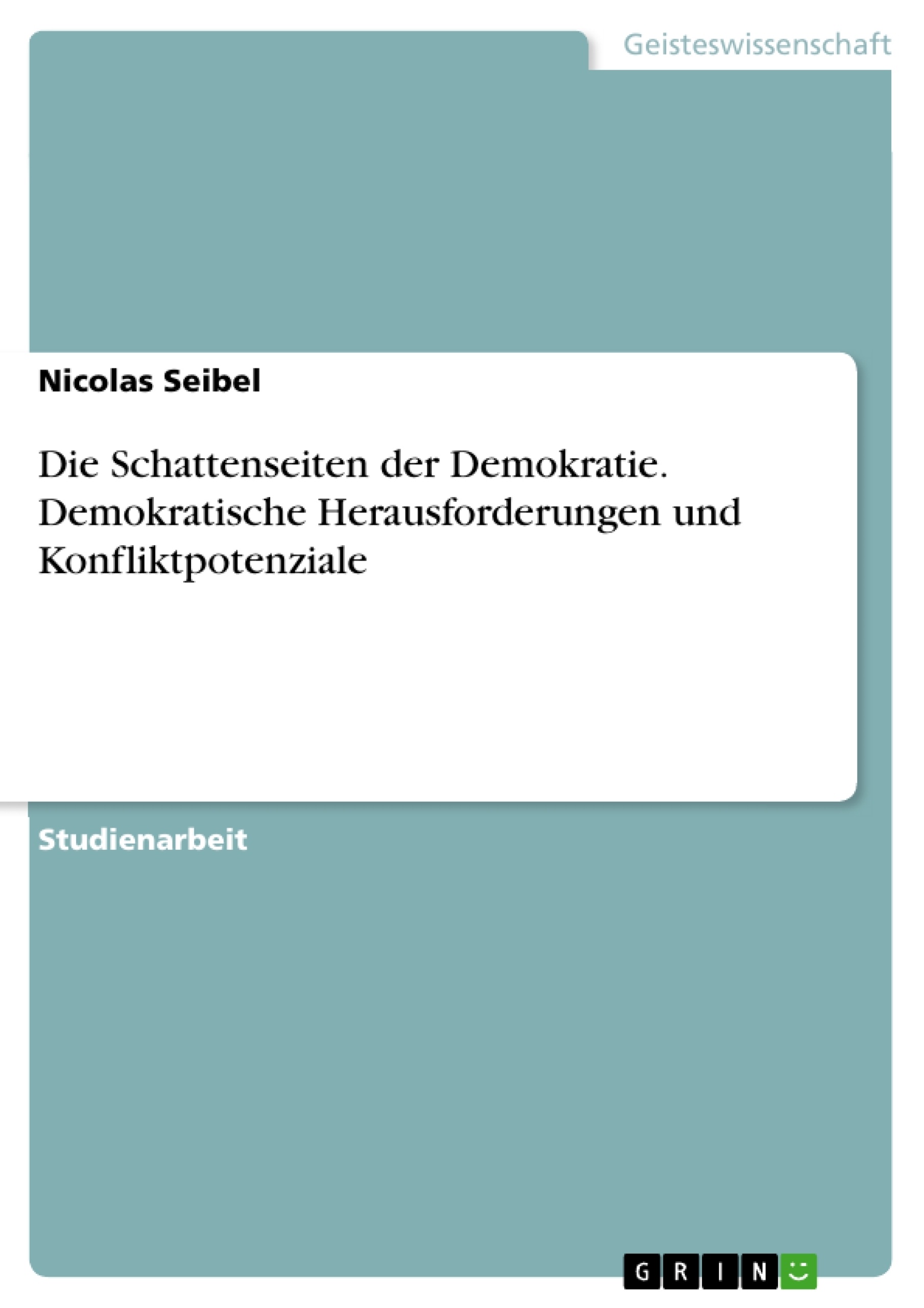Wie äußern sich die Schattenseiten der Demokratie und welche negativen Folgen können demokratische Entscheidungen haben? Zunächst erfolgt eine Begriffsbestimmung des Demokratiebegriffs sowie die Voraussetzungen und Dimensionen einer Demokratie. Anschließend werden die Schattenseiten einer Demokratie beleuchtet, die demokratische Entscheidungen mit sich bringen. Abschließend sollen die Gründe für das Ausmaß an Unzufriedenheit gegenüber der Politik erklärt werden.
Demokratische Voraussetzungen scheinen sich mit der Zeit zu wandeln. Immer häufiger hört man von sinkenden Zahlen bei Wahlbeteiligungen und neuen Tiefstrekorden bei der bürgerlichen Beteiligung an politischen Entscheidungen. Offensichtlich hat ein Wandel in der Erwartungshaltung der Bevölkerung gegenüber dem Regierungsapparat und den politischen Vertretern und somit, gegenüber der Demokratie selbst, stattgefunden. Negativbeispiele wie öffentliche Ausschreitungen oder Streiks machen den Unmut vieler Menschen sichtbar und verdeutlichen gleichzeitig die Herausforderungen, vor die sich die Politik gestellt sieht.
Der Versuch, diesen Spagat zwischen gegensätzlichen gesellschaftlichen Interessen zu bewältigen, stellt besondere Anforderungen an die Demokratie. Wo die Interessen der einen Gruppe umgesetzt werden, werden die Interessen anderer Gruppen vernachlässigt. Hier zeigt sich schnell das Paradoxon und damit die Schattenseiten der Demokratie: Obwohl sich die Demokratie als Herrschaft des Volkes versteht ist es ihr meist nicht möglich, die Interessen aller Mitglieder eines politischen Systems gleichermaßen zu vertreten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zum Demokratiebegriff
- Ursprung und Entstehung
- Begriffsklärung Demokratie
- Grundgedanken des demokratischen Systems
- Rechtsstaatlichkeit
- Partizipation und Inklusion
- Die Schattenseiten der Demokratie
- Herausforderungen und Risikofaktoren
- Soziale Konflikte und Gewaltpotenzial
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit den Schattenseiten der Demokratie und analysiert die Herausforderungen und Konfliktpotenziale, die mit dem demokratischen System einhergehen.
- Entwicklung des Demokratiebegriffs und seiner zentralen Elemente
- Analyse der Herausforderungen der Demokratie in der heutigen Zeit
- Untersuchung von sozialen Konflikten und Gewaltpotenzialen im Kontext der Demokratie
- Bedeutung von Partizipation und Inklusion für die Stabilität der Demokratie
- Verbindung von theoretischen Konzepten mit aktuellen Beispielen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die Problematik der Schattenseiten der Demokratie dar und führt in das Thema ein. Sie beleuchtet den Wandel der Erwartungshaltung der Bevölkerung gegenüber der Demokratie und die Auswirkungen auf die politische Praxis.
Zum Demokratiebegriff
Dieser Abschnitt untersucht den Ursprung und die Entwicklung des Demokratiebegriffs. Er geht auf die griechische Antike ein und vergleicht die antike Form der Demokratie mit der modernen repräsentativen Demokratie.
Grundgedanken des demokratischen Systems
In diesem Abschnitt werden die zentralen Prinzipien des demokratischen Systems wie Rechtsstaatlichkeit und Partizipation erläutert.
Die Schattenseiten der Demokratie
Dieser Abschnitt analysiert die Herausforderungen und Risikofaktoren, die mit der Demokratie verbunden sind. Er beleuchtet soziale Konflikte und das Potenzial für Gewalt, die aus dem demokratischen System erwachsen können.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Demokratie, Demokratiebegriff, Partizipation, Inklusion, Rechtsstaatlichkeit, soziale Konflikte, Gewaltpotenzial, Herausforderungen, Risikofaktoren, Politikverdrossenheit, Wahlmüdigkeit.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die "Schattenseiten" der Demokratie?
Damit sind negative Folgen demokratischer Entscheidungen gemeint, wie z.B. die Vernachlässigung von Minderheiteninteressen, politische Trägheit oder soziale Konflikte, die aus dem Mehrheitsprinzip resultieren.
Warum sinkt die Wahlbeteiligung?
Ein Grund ist der Wandel in der Erwartungshaltung gegenüber dem Regierungsapparat und eine wachsende Unzufriedenheit (Politikverdrossenheit), die zu Wahlmüdigkeit führt.
Was ist das Paradoxon der Demokratie?
Obwohl sie als Herrschaft des Volkes gilt, kann sie selten die Interessen aller Mitglieder gleichermaßen vertreten, was zwangsläufig zu Enttäuschungen bei unterlegenen Gruppen führt.
Welche Rolle spielt die Rechtsstaatlichkeit?
Rechtsstaatlichkeit ist ein Grundpfeiler, der sicherstellt, dass auch demokratische Mehrheitsentscheidungen an Recht und Gesetz gebunden sind, um Willkür zu verhindern.
Wie äußert sich Unmut in einer Demokratie?
Unmut zeigt sich oft durch öffentliche Ausschreitungen, Streiks oder eine Abkehr von etablierten politischen Prozessen.
- Quote paper
- Nicolas Seibel (Author), 2018, Die Schattenseiten der Demokratie. Demokratische Herausforderungen und Konfliktpotenziale, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/520766